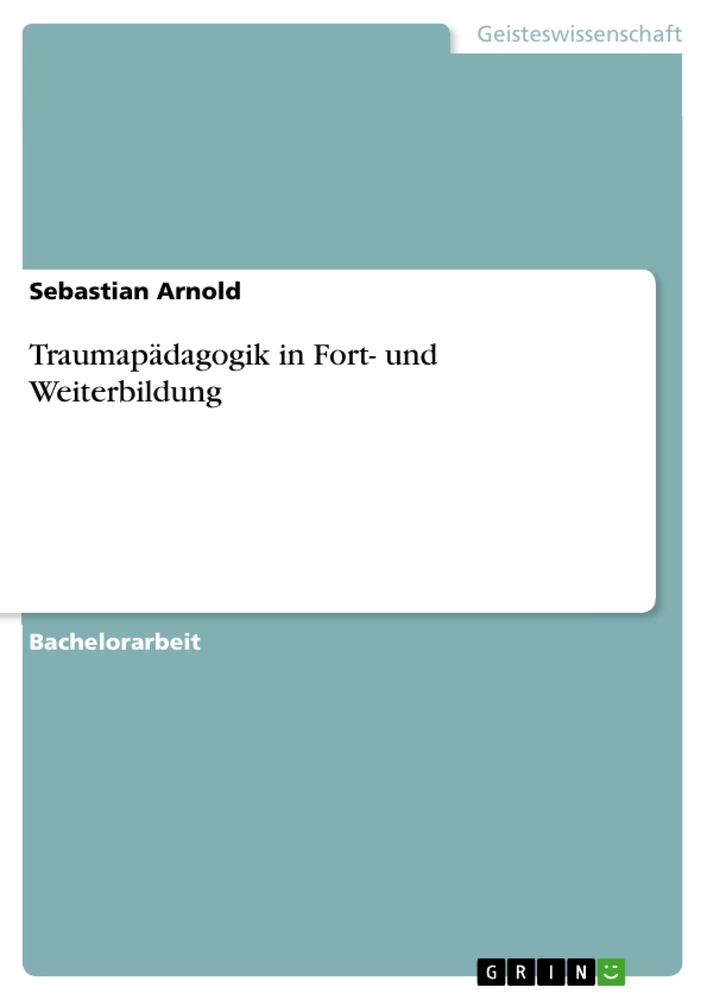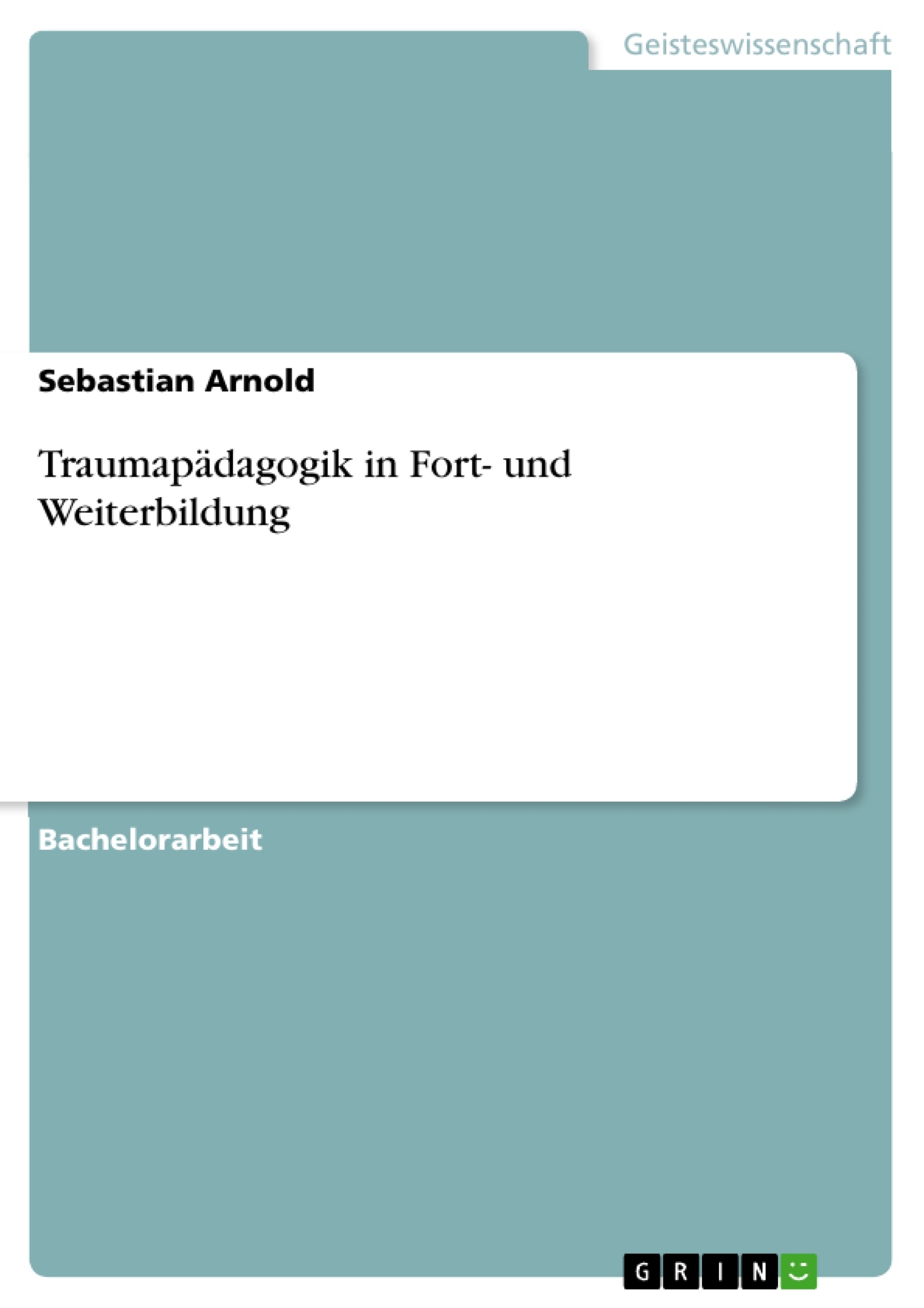Der Begriff der Traumapädagogik umfasst alle pädagogischen Ansätze und Methoden bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Die vorliegende Arbeit behandelt die Traumapädagogik im Bereich der Fort- und Weiterbildung.
Zunächst wird das Basiswissen dargelegt, welches einer traumapädagogischen Arbeitsweise in der vollstationären Jungendhilfe (Heimerziehung) zugrunde liegen sollte. Dazu wird das Fachwissen aus verschiedenen Hand-, Lehr- und Fachbüchern exzerpiert, welches Pädagogen in der Heimerziehung haben sollten. Diese Literatur ist die Basis für das Wissen, das Pädagogen brauchen, um traumapädagogisch/-sensibel mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können.
Schließlich wird die BAG Traumapädagogik vorgestellt, sowie die von ihr und der DeGPT formulierten empfohlenen Mindeststandards. Diese werden mit dem vorher zusammengestellten Basiswissen verglichen. Des Weiteren werden exemplarisch Weiterbildungskonzepte miteinander und mit den Mindeststandards verglichen. Außerdem soll in dieser Arbeit die Lenkungskraft der BAG Traumapädagogik, eine Fortbildungspflicht, sowie der Nutzen einer qualifizierten traumapädagogischen Weiterbildung für die Praxis diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Teil A Basiswissen Traumapädagogik
- 2.1 Einführung in Trauma und Traumatisierung
- 2.2 Bindungstheorie und Bindungsstörung
- 2.3 Konzept des guten Grundes
- 2.4 Gestaltung sicherer Orte
- 2.4.1 Pädagogik des Sicheren Ortes nach Martin Kühn
- 2.4.2 Pädagogik der fünf sicheren Orte nach Martin Baierl
- 2.4.3 Ziel: Therapeutisches Milieu
- 2.5 Partizipation
- 2.6 Selbstbemächtigung
- 2.7 Dissoziation
- 2.8 Übertragung und Gegenübertragung
- 2.9 Elternarbeit
- 3. Teil B – Traumapädagogik in Fort- und Weiterbildung
- 3.1 Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik
- 3.2 Lenkungskraft der BAG Traumapädagogik
- 3.3 Curricula zur Weiterbildung Traumapädagogik und Traumazentrierter Fachberatung
- 3.4 Vergleich Curricula und Basiswissen (Teil A der Arbeit)
- 3.5 Exemplarischer Vergleich von Weiterbildungskonzepten
- 3.6 Diskussion Fortbildungspflicht
- 4. Fazit: Nutze für die Praxis - Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Traumapädagogik im Kontext von Fort- und Weiterbildung. Sie gliedert sich in zwei Teile: Der erste Teil legt das Basiswissen für traumapädagogisches Handeln in der vollstationären Jugendhilfe dar. Der zweite Teil präsentiert die Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG TP), vergleicht deren Standards mit dem im ersten Teil dargestellten Basiswissen und analysiert exemplarische Weiterbildungskonzepte. Die Lenkungskraft der BAG TP, eine mögliche Fortbildungspflicht und der praktische Nutzen einer qualifizierten Weiterbildung werden ebenfalls diskutiert.
- Basiswissen Traumapädagogik
- Fort- und Weiterbildungsangebote in Traumapädagogik
- Vergleich verschiedener Weiterbildungskonzepte
- Standards und Empfehlungen der BAG Traumapädagogik
- Bedeutung von Fortbildungspflicht im Bereich Traumapädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufbau der Arbeit, die in zwei Teile gegliedert ist. Teil A behandelt das Basiswissen der Traumapädagogik für die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Heimerziehung, basierend auf ausgewählter Fachliteratur. Teil B fokussiert auf die BAG Traumapädagogik, deren Standards und den Vergleich verschiedener Weiterbildungskonzepte. Die Arbeit beschränkt sich auf pädagogische Aspekte und geht nicht vertiefend auf traumatherapeutische Ansätze oder die (Nach-)Sorge für Mitarbeiter ein.
2. Teil A - Basiswissen Traumapädagogik: Dieser Teil bietet eine Einführung in die Traumapädagogik als junge Disziplin, die aus der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe entstanden ist. Er beleuchtet die Notwendigkeit traumapädagogischer Ansätze für Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen, die oft auffällige Überlebensstrategien entwickeln. Der Abschnitt beschreibt zentrale Konzepte wie Traumadefinitionen, Bindungstheorie, sichere Orte, Partizipation und Selbstbemächtigung, und betont deren Bedeutung für die pädagogische Arbeit mit dieser Klientel. Die Zusammenhänge zwischen Trauma, Überlebensstrategien und dem Alltag der betroffenen Jugendlichen werden ausführlich erläutert.
2.1 Einführung in Trauma und Traumafolgestörung: Dieses Kapitel definiert ein psychisches Trauma als ein Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationen und den individuellen Bewältigungskapazitäten, das mit Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht. Es erläutert die körperlichen und psychischen Reaktionen auf Trauma, einschließlich der Fight-or-flight-Reaktionen sowie Freeze und Fragmentation als Schutzmechanismen. Der Abschnitt hebt hervor, dass nicht alle Menschen, die traumatischen Belastungen ausgesetzt sind, eine Traumafolgestörung entwickeln, und dass die Integration der traumatischen Erfahrung entscheidend für die psychische Gesundheit ist.
Schlüsselwörter
Traumapädagogik, Psychotraumatologie, Kinder- und Jugendhilfe, Heimerziehung, Traumatisierung, Bindungstheorie, sichere Orte, Partizipation, Selbstbemächtigung, Weiterbildung, Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG TP), Fortbildungspflicht, Mindeststandards.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Traumapädagogik in Fort- und Weiterbildung"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau auf eine Arbeit zum Thema Traumapädagogik in Fort- und Weiterbildung. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Basiswissen der Traumapädagogik und dem Vergleich verschiedener Weiterbildungskonzepte, insbesondere im Hinblick auf die Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG TP).
Welche Themen werden im ersten Teil der Arbeit behandelt?
Teil A behandelt das Basiswissen der Traumapädagogik für die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der vollstationären Jugendhilfe. Es umfasst Themen wie Trauma und Traumatisierung, Bindungstheorie, das Konzept des guten Grundes, die Gestaltung sicherer Orte (nach Kühn und Baierl), Partizipation, Selbstbemächtigung, Dissoziation, Übertragung und Gegenübertragung sowie Elternarbeit.
Was wird im zweiten Teil der Arbeit untersucht?
Teil B konzentriert sich auf die Fort- und Weiterbildung im Bereich Traumapädagogik. Er beleuchtet die Rolle der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG TP), vergleicht deren Standards mit dem in Teil A dargestellten Basiswissen und analysiert exemplarische Weiterbildungskonzepte. Die Lenkungskraft der BAG TP, eine mögliche Fortbildungspflicht und der praktische Nutzen einer qualifizierten Weiterbildung werden diskutiert.
Welche Schlüsselkonzepte der Traumapädagogik werden erläutert?
Die Arbeit erläutert zentrale Konzepte wie Traumadefinitionen, Bindungstheorie, die Bedeutung sicherer Orte für die Entwicklung traumatisierter Kinder und Jugendlicher, Partizipation, Selbstbemächtigung und den Umgang mit Dissoziation. Die Zusammenhänge zwischen Trauma, Überlebensstrategien und dem Alltag der betroffenen Jugendlichen werden ausführlich dargestellt.
Wie werden die verschiedenen Weiterbildungskonzepte verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Curricula zur Weiterbildung in Traumapädagogik und traumazentrierter Fachberatung mit dem im ersten Teil dargestellten Basiswissen. Ein exemplarischer Vergleich verschiedener Weiterbildungskonzepte wird durchgeführt, um Stärken und Schwächen aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt die Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG TP)?
Die BAG TP spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit. Ihre Standards und Empfehlungen werden mit dem Basiswissen verglichen, und ihre Lenkungskraft im Bereich der Traumapädagogik wird diskutiert. Die Arbeit untersucht auch die Frage einer möglichen Fortbildungspflicht im Bereich Traumapädagogik.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere in der Heimerziehung, sowie für Personen, die sich für Fort- und Weiterbildung im Bereich Traumapädagogik interessieren. Es bietet einen Überblick über das Basiswissen und die aktuellen Entwicklungen im Feld der Traumapädagogik.
Welche konkreten Kapitel sind im Dokument enthalten?
Das Dokument enthält Kapitel zu folgenden Themen: Abkürzungsverzeichnis, Einleitung, Basiswissen Traumapädagogik (inkl. Unterkapitel zu Trauma, Bindung, sicheren Orten, Partizipation etc.), Traumapädagogik in Fort- und Weiterbildung (inkl. Vergleich verschiedener Curricula und Diskussion der Fortbildungspflicht), Fazit und Literaturverzeichnis.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zeigt den praktischen Nutzen einer qualifizierten Weiterbildung im Bereich Traumapädagogik für die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen auf.
- Citar trabajo
- Sebastian Arnold (Autor), 2017, Traumapädagogik in Fort- und Weiterbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489356