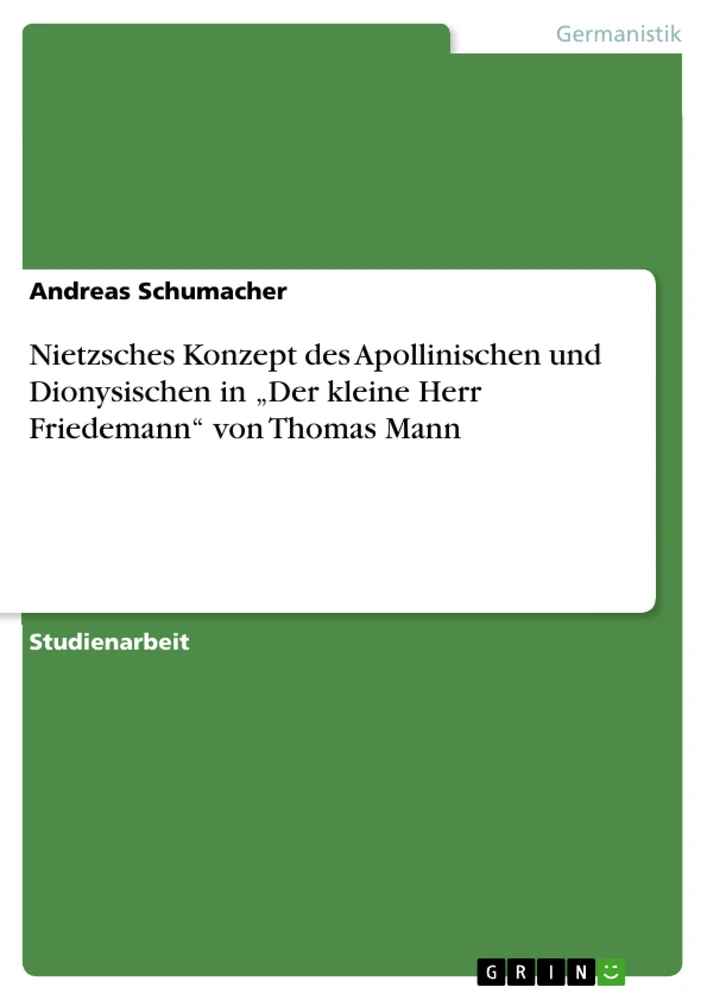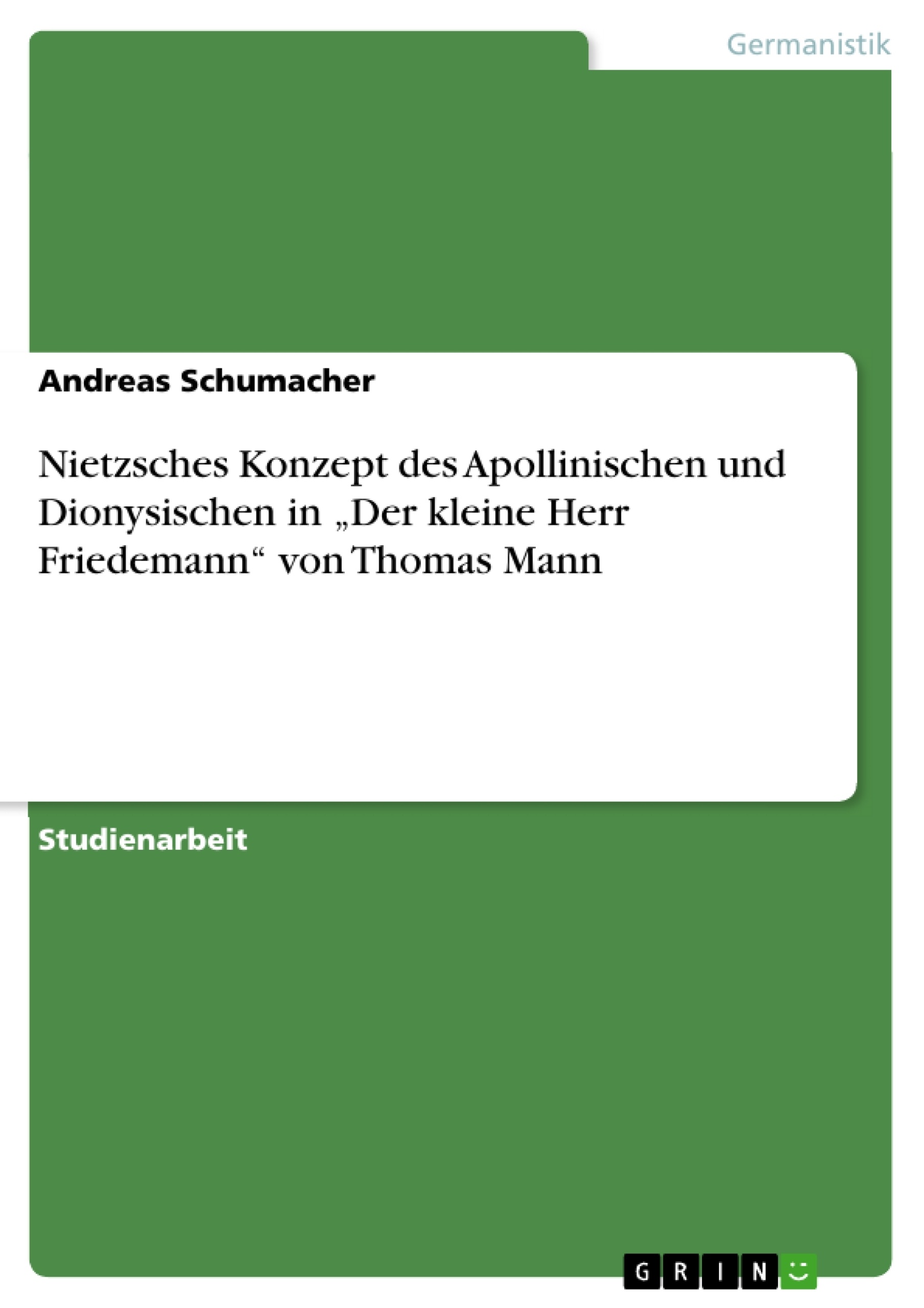1887 erschien Thomas Manns erste Erzählung "Der kleine Herr Friedemann" in der Neuen Deutschen Rundschau und dann später 1898 in seinem ersten Novellenband im Fischer-Verlag. Thomas Mann, damals erst 23 Jahre alt, wurde in der Presse für diese Erzählung hoch gelobt und als ein Homo Novus der Literatur geehrt. Dies ist Grund genug, sich mit dieser Erzählung einmal genauer auseinander zu setzten.
In dieser Arbeit sollen die Einflüsse Nietzsches auf den jungen Thomas Mann mit dem Schwerpunkt auf die apollinischen und dionysischen Kräfte, die auf den Herrn Friedemann einwirken, herausgearbeitet werden. Hierzu sollen zu Beginn ein kurzer Überblick über die Philosophie Nietzsches gegeben und dann einzelne Aspekte der Erzählung unter ebendiesem Raster untersucht, herausgearbeitet und Differenzen und Überschneidungen deutlich gemacht werden.
Das Grundmotiv in dieser Erzählung ist die Zerstörung einer asketisch-gemäßigten Existenz durch den Hereinbruch von wilden Leidenschaften. Friedemann, klein und von Kindheit an verkrüppelt, wählt ein Leben als Außenseiter und Asket, klammert jegliche Leidenschaft aus und wird von ihr letzten Endes heimgesucht und zu Grunde gerichtet.
Dieses Motiv wird auf Friedrich Nietzsche und sein Gegensatzpaar Apollinisch und Dionysisch, welches er in seiner Schrift "Die Geburt der Tragödie" entwirft, zurückgeführt und vor diesem Hintergrund gedeutet. Anhand dieser Parallelen kann man erkennen, dass Thomas Mann Friedrich Nietzsche verhältnismäßig früh rezipiert hat und dessen Ideen bereitwillig in sein Werk übernommen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kunst und Künstler bei Friedrich Nietzsche
- Der kleine Herr Friedemann im Spannungsfeld der Triebe
- Friedemann als ein apollinischer Asket
- Die Rolle Gerdas von Rinnlingen
- Der Einbruch der Leidenschaften
- Zusammenfassung
- Literaturhinweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Friedrich Nietzsches Konzeption des Apollinischen und Dionysischen auf Thomas Manns Erzählung "Der kleine Herr Friedemann". Sie analysiert, wie die in der Erzählung dargestellte Zerstörung einer asketischen Existenz durch den Einbruch von Leidenschaften vor dem Hintergrund Nietzsches Philosophie interpretierbar ist. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Thomas Mann Nietzsches Ideen in seinem Werk verarbeitet und für seine literarische Gestaltung genutzt hat.
- Nietzsches Philosophie des Apollinischen und Dionysischen
- Die Rolle der Triebe in der Gestaltung von Friedemanns Persönlichkeit und Handlung
- Das Spannungsverhältnis zwischen asketischer Lebensführung und den Einbruch leidenschaftlicher Momente
- Die ästhetische Funktion der Kunst und ihre Bedeutung für den Künstler
- Die Verbindung von Krankheit und Künstlertum
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Erzählung "Der kleine Herr Friedemann" in den Kontext von Thomas Manns Werk und skizziert die Grundidee der Arbeit. Sie führt die zentrale These ein, dass Nietzsches Philosophie des Apollinischen und Dionysischen die Interpretation der Erzählung entscheidend beeinflusst.
- Kunst und Künstler bei Friedrich Nietzsche: Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Aspekte von Nietzsches Philosophie der Kunst, insbesondere seine Konzeption des Apollinischen und Dionysischen. Es wird erläutert, wie Nietzsche die Kunst aus ihren "falschen Mittelsfunktionen" befreit und sie als Ausdruck der Naturtriebe des Menschen betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen des Apollinischen und Dionysischen, Kunst, Triebe, Askese, Leidenschaft, Krankheit und Künstlertum. Darüber hinaus untersucht sie die Rezeption von Friedrich Nietzsche durch Thomas Mann und analysiert die Auswirkungen von Nietzsches Philosophie auf die Gestaltung der Erzählung "Der kleine Herr Friedemann".
- Quote paper
- Andreas Schumacher (Author), 2016, Nietzsches Konzept des Apollinischen und Dionysischen in „Der kleine Herr Friedemann“ von Thomas Mann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489201