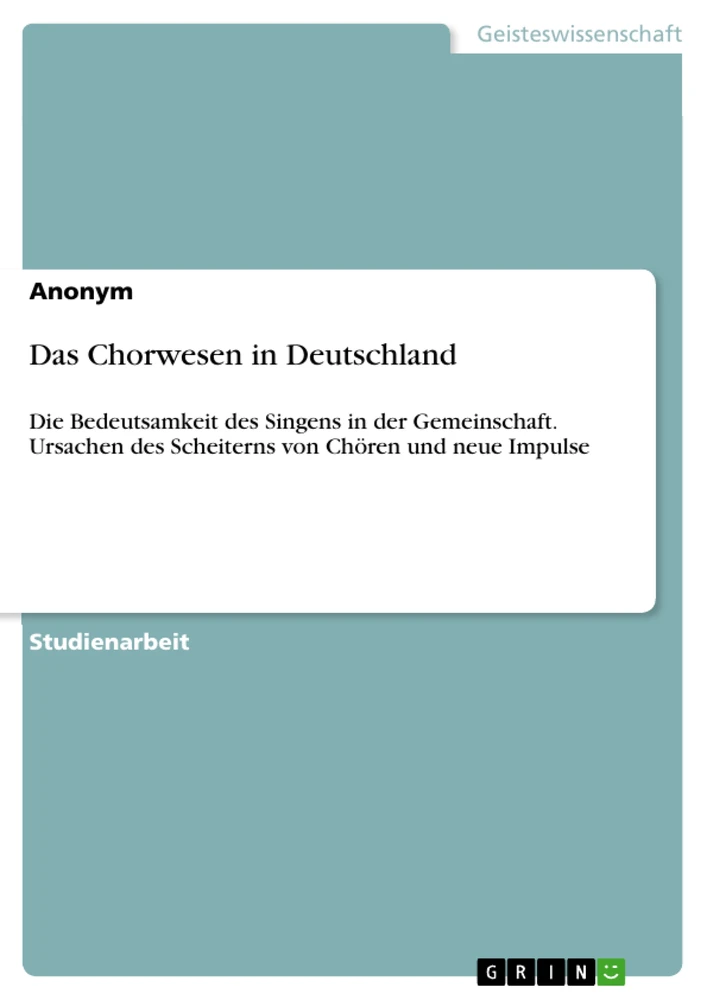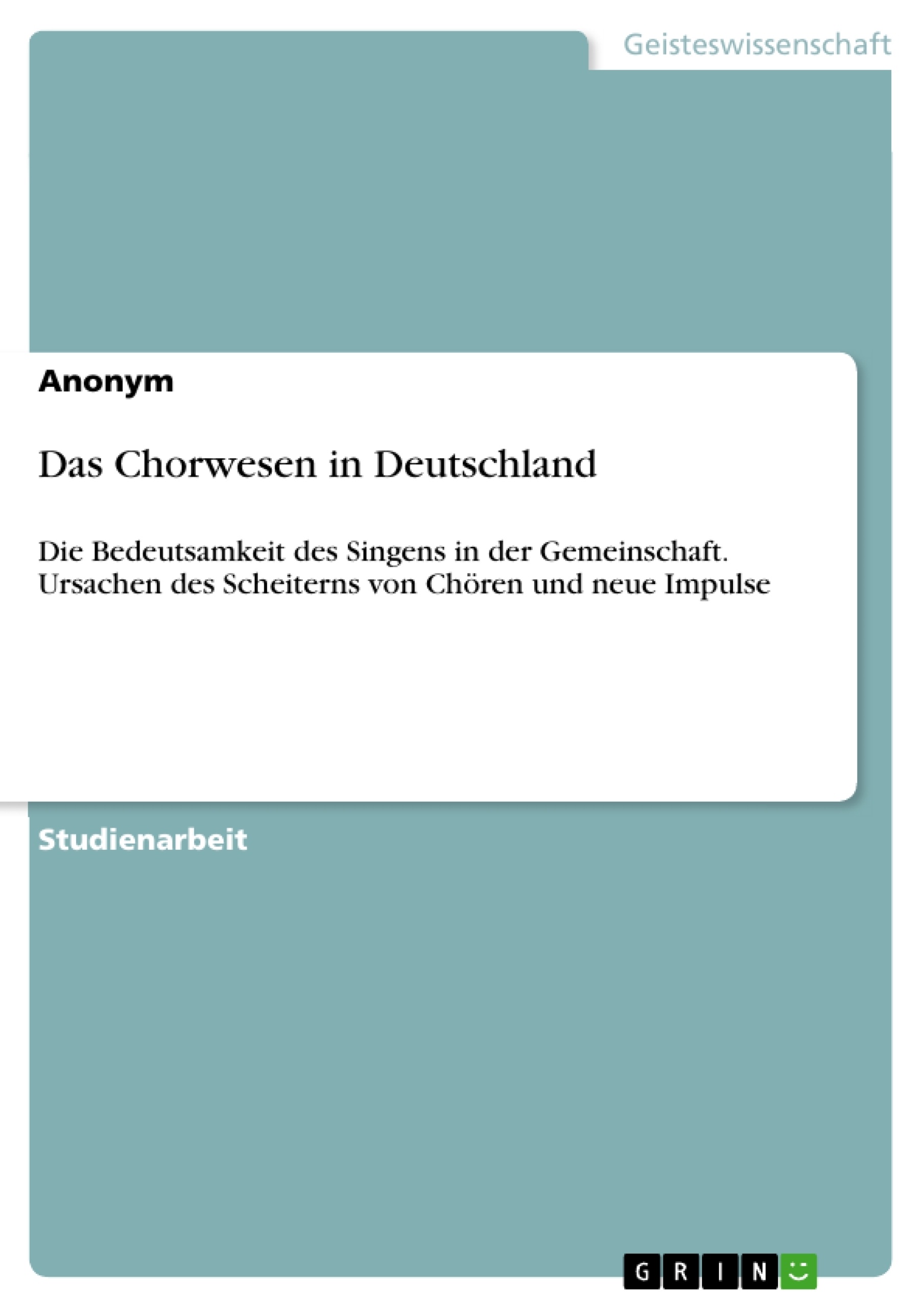Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich zu Beginn mit der Historie des Chorwesens, angefangen im 19. Jahrhundert mit der Zelterschen Liedertafel, die die ersten Schritte ebnet für die Laienchorbewegung, bis hin zum Chorgesang im ersten sowie im zweiten Weltkrieg und den damit verbundenen Krisen und Einbußen, die der Chorgesang hat erleben müssen.
Der historische Exkurs, welcher dazu dient, das Interesse der Bevölkerung am Chorgesang zu verdeutlichen, endet mit dem aktuellen Chorleben heute. Hier wird darauf Bezug genommen, ob und inwieweit sich die gesellschaftliche Situation und der Chorgesang verändert haben. Vorangestellt wird eine Ursachenfindung für die vielen Einbrüche, die das Chorwesen in Deutschland hat erleben müssen. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Männergesangvereine gelegt, die bis heute
mit immer geringer werdenden Mitgliederzahlen zu kämpfen haben. Die Rolle des Liederrepertoires nimmt in diesem Abschnitt eine stark thematisierte Rolle ein.
Abgeschlossen wird diese Arbeit durch ein persönliches Fazit und einen Ausblick darauf, was getan werden muss, um den Chorgesang auch künftig sichern zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Historischer Abriss
- 2.1 Chorgesang im 19. Jahrhundert
- 2.2 Chorgesang im 20. Jahrhundert
- 2.2.1 Erster Weltkrieg
- 2.2.2 Zweiter Weltkrieg
- 2.2.3 Neubeginn nach 1945
- 3.0 Chorgesang im 21. Jahrhundert – erneute Krise und ihre Ursachen
- 4.0 Die Bedeutsamkeit des gemeinschaftlichen Singens
- 5.0 Veränderung des Chorwesens bis 2018
- 6.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Stand des Chorwesens in Deutschland und beleuchtet die historische Entwicklung sowie die aktuellen Herausforderungen, denen das Chorgesangwesen begegnet. Dabei wird die Bedeutung des gemeinschaftlichen Singens in der Gesellschaft sowie die Ursachen für den Rückgang der Mitgliederzahlen in Chören thematisiert.
- Historische Entwicklung des Chorwesens in Deutschland, von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert
- Die Rolle des Chorgesangs als politisches und soziales Instrument
- Die Ursachen für die Krise im Chorwesen, insbesondere in Bezug auf Männergesangvereine
- Die Bedeutung des Liederrepertoires für den Erfolg von Chören
- Mögliche Lösungsansätze zur Sicherung des Chorgesangs in der Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Leser in das Thema einführt und die Relevanz des Chorgesangs in Deutschland hervorhebt. Anschließend wird ein historischer Abriss des Chorwesens gegeben, der von den Anfängen im 19. Jahrhundert mit der Zelterschen Liedertafel bis hin zum Chorgesang im 20. Jahrhundert und den damit verbundenen Krisen reicht.
Im nächsten Schritt wird der Chorgesang im 21. Jahrhundert beleuchtet, wobei insbesondere die Ursachen für die erneute Krise im Chorwesen untersucht werden. Dabei wird auch die Bedeutung des gemeinschaftlichen Singens in der Gesellschaft und die Rolle des Liederrepertoires thematisiert. Abschließend wird das Kapitel über die Veränderung des Chorwesens bis 2018 ein Ausblick auf die Zukunft des Chorgesangs gegeben.
Schlüsselwörter
Chorgesang, Chorwesen, Deutschland, Geschichte, Krise, Ursachen, Bedeutung, Gemeinschaft, Liederrepertoire, Männergesangvereine, Zukunft, Laienchor, Bürgerliches Engagement, Musikpflege, Tradition, Wandel, Gesellschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Das Chorwesen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489103