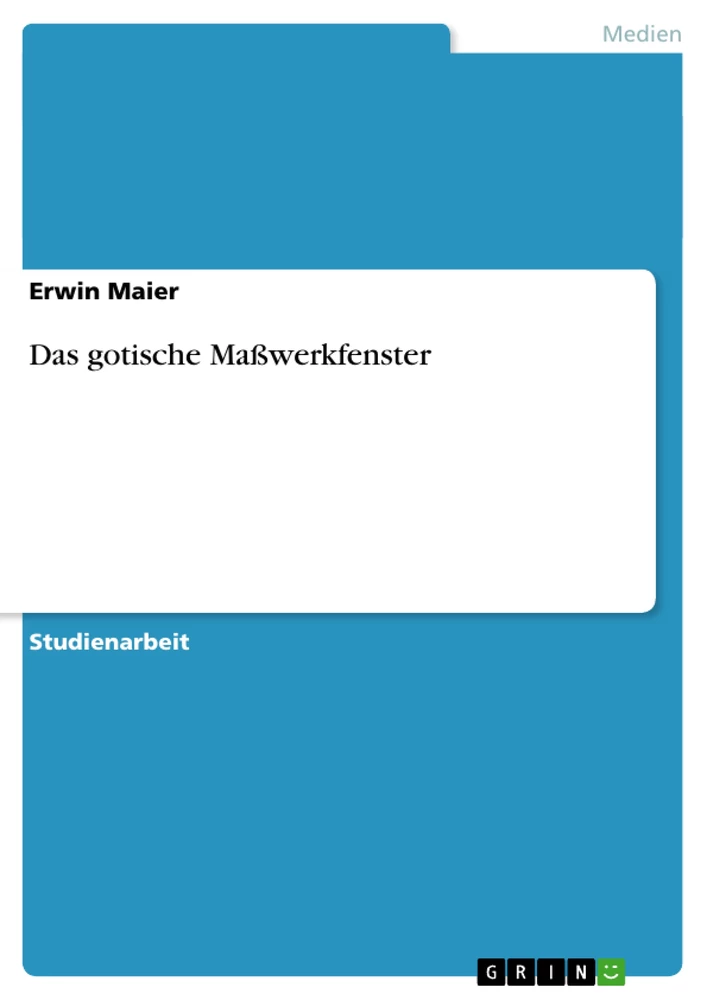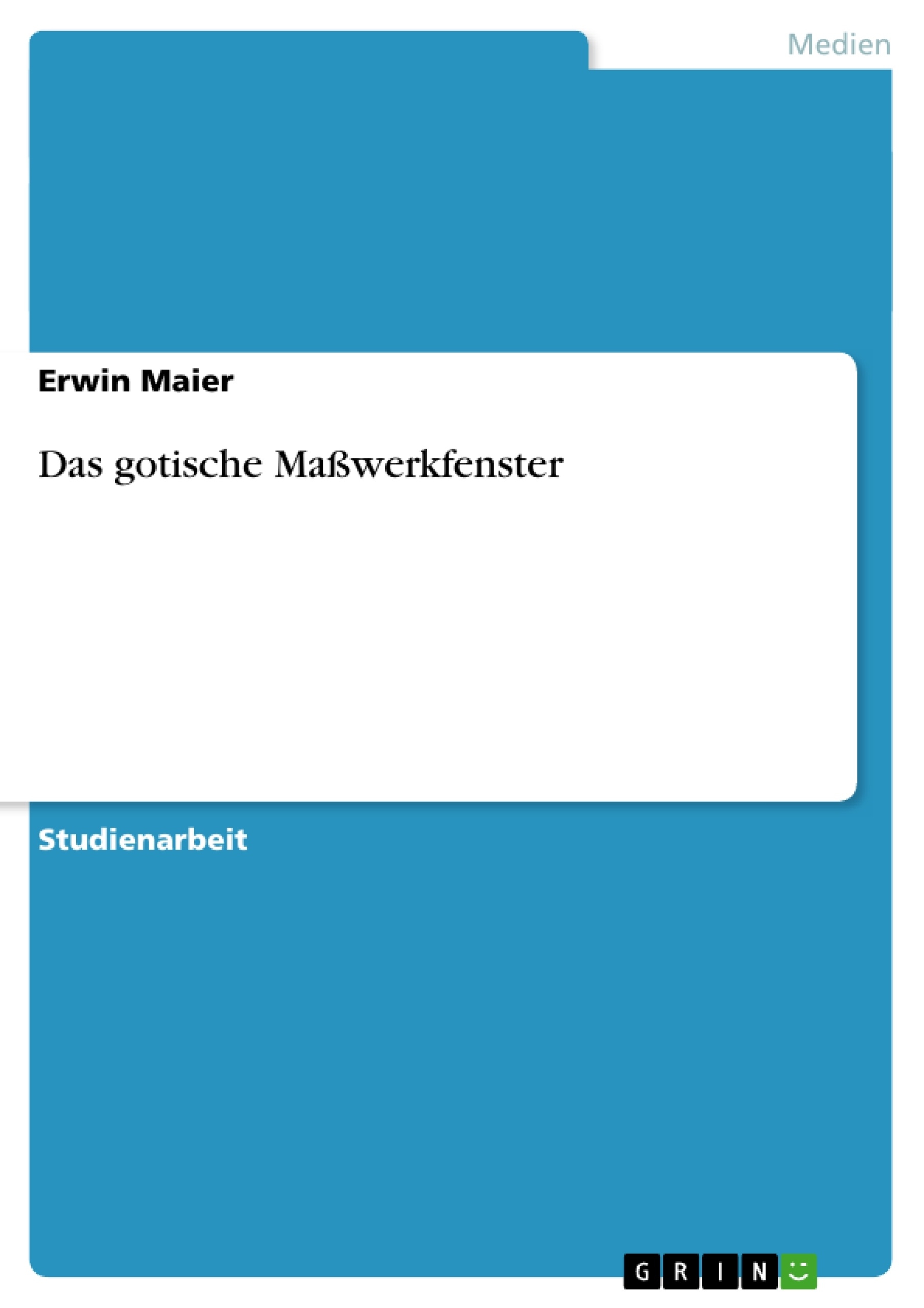Diese Arbeit ist als Ergänzung zum Referat „Der Regensburger Dom“ entstanden und stellt deshalb die Maßwerkfenster des Regensburger Domes in den Mittelpunkt. Wenn Epochen der Entwicklung des Maßwerks nicht an den Fenstern des Domes nachgewiesen werden können, werden, so weit vorhanden, Beispiele aus anderen Regensburger Kirchen herangezogen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung des Maßwerks in Deutschland, bzw. im damalig deutschsprachigen Raum, aufzuzeigen, die besondere Entwicklung in England wird deshalb außer Acht gelassen. Die Maßwerksformen in Frankreich sind zwar nicht Gegenstand dieser Arbeit, aber da sie vor allem in den frühen Phasen die Grundlage für die Entwicklung der Formen in Deutschland bilden, ist es oft unverzichtbar, Beispiele aus Frankreich zu benennen. Im Zuge dieser Arbeit wird vor allem auf das Maßwerk der Fenster eingegangen, Maßwerk an anderen Bauteilen folgt zwar ähnlichen Prämissen, ist aber nicht Thema dieser Arbeit. Maßgebend stütze ich mich bei dieser Arbeit auf Literatur von Günther Binding und Lottlisa Behling, die sich mit dem Maßwerk in Deutschland, Frankreich und England intensiv auseinandergesetzt haben, wobei ich mich für Bindings Terminologie als der stringenteren und moderneren entschieden habe. Des weiteren habe ich für die Baugeschichte des Regensburger Domes vor allem das recht aktuelle Werk von Achim Hubel und Manfred Schuller herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkung
- II. Begriffsdefinition „Maßwerk“
- III. Entwicklung des Maßwerks in Deutschland
- Maßwerk der Hochgotik (1220-1270/80)
- Maßwerk des Rayonnant-Stiles (1260-1360/80)
- Maßwerk des Flamboyant-Stiles (1350-Anfang des 16. Jh.)
- IV. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des gotischen Maßwerkfensters in Deutschland, insbesondere am Beispiel Regensburger Bauten. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Entwicklungsphasen und der stilistischen Merkmale des Maßwerks. England wird dabei ausgeklammert, während französische Einflüsse als Grundlage der deutschen Entwicklung berücksichtigt werden.
- Entwicklung des Maßwerks in Deutschland
- Stilistische Merkmale der verschiedenen Phasen (Hochgotik, Rayonnant, Flamboyant)
- Vergleich mit Beispielen aus Frankreich
- Das Maßwerkfenster des Regensburger Domes als Fallbeispiel
- Begriffsdefinition und geometrische Grundlagen des Maßwerks
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorbemerkung: Diese Einleitung erläutert den Kontext der Arbeit als Ergänzung zu einem Referat über den Regensburger Dom. Der Fokus liegt auf den Maßwerkfenstern des Domes und, falls dortige Beispiele fehlen, auf anderen Regensburger Kirchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung in Deutschland und dem damaligen deutschsprachigen Raum, lässt die Entwicklung in England jedoch außer Acht. Französische Beispiele werden als wesentliche Grundlage für die Entwicklung in Deutschland angeführt. Die Arbeit konzentriert sich auf Fenstermaßwerk, andere Bauteile werden nicht behandelt. Die verwendeten Quellen sind hauptsächlich Werke von Günther Binding und Lottlisa Behling, wobei Bindings Terminologie bevorzugt wird.
II. Begriffsdefinition „Maßwerk“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Maßwerk“ als eine aus rein geometrischen Formen bestehende Bauzier, die mit Zirkel und Richtscheit konstruiert wird. Ursprünglich aus Stein gefertigt, wurde es später auch in anderen Materialien wie Holz, Ton und Metall verwendet. Der Text zitiert Günther Binding, der Maßwerk als ein ausschließlich aus exakten Kreisbögen bestehendes Element beschreibt, das zur Unterteilung von Bogenfeldern gotischer Fenster, zur Gliederung von Mauerflächen oder für Wimperge und Brüstungen eingesetzt wurde. Es ist ein ungegenständliches Bauornament, dessen wesentliches Prinzip die Symmetrie ist.
III. Entwicklung des Maßwerks in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Maßwerks in Deutschland, beginnend um 1235 mit der Elisabethkirche in Marburg. Es wird die Unterscheidung in drei Phasen nach Binding (Hochgotik, Rayonnant und Flamboyant) eingeführt. Der Text hebt hervor, dass die Ausbreitung der Gotik in Deutschland im Vergleich zu Frankreich durch unsichere politische Bedingungen verzögert wurde. Das Kapitel legt die Grundlage für die detaillierte Beschreibung der einzelnen Stilepochen in den folgenden Unterkapiteln.
Schlüsselwörter
Maßwerk, Gotik, Architekturgeschichte, Regensburg, Deutschland, Hochgotik, Rayonnant, Flamboyant, Fenster, Geometrie, Binding, Behling, Bauornamente, Stilentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung des gotischen Maßwerks in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des gotischen Maßwerkfensters in Deutschland, insbesondere anhand von Beispielen aus Regensburg. Der Fokus liegt auf den Entwicklungsphasen und stilistischen Merkmalen des Maßwerks. England wird dabei ausgeschlossen, während französische Einflüsse als Grundlage der deutschen Entwicklung berücksichtigt werden. Die Arbeit konzentriert sich auf Fenstermaßwerk; andere Bauteile werden nicht behandelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Vorbemerkung, Begriffsdefinition „Maßwerk“, Entwicklung des Maßwerks in Deutschland (unterteilt in Hochgotik, Rayonnant und Flamboyant) und Schlussbemerkung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie wird der Begriff „Maßwerk“ definiert?
Der Begriff „Maßwerk“ wird als eine aus rein geometrischen Formen bestehende Bauzier definiert, die mit Zirkel und Richtscheit konstruiert wird. Günther Binding beschreibt es als ein ausschließlich aus exakten Kreisbögen bestehendes Element zur Unterteilung von Bogenfeldern gotischer Fenster, zur Gliederung von Mauerflächen oder für Wimperge und Brüstungen. Es ist ein ungegenständliches Bauornament, dessen wesentliches Prinzip die Symmetrie ist.
Welche Entwicklungsphasen des Maßwerks in Deutschland werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet drei Phasen der Entwicklung des Maßwerks in Deutschland nach Günther Binding: Hochgotik (1220-1270/80), Rayonnant (1260-1360/80) und Flamboyant (1350-Anfang des 16. Jh.). Die Ausbreitung der Gotik in Deutschland war im Vergleich zu Frankreich durch unsichere politische Bedingungen verzögert.
Welche Rolle spielt Frankreich in der Entwicklung des deutschen Maßwerks?
Französische Einflüsse werden als wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Maßwerks in Deutschland angesehen. Die Arbeit vergleicht deutsche Beispiele mit französischen, um die Einflüsse aufzuzeigen. England wird hingegen in der Analyse ausgeklammert.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Werke von Günther Binding und Lottlisa Behling, wobei Bindings Terminologie bevorzugt wird.
Welche Beispiele werden in der Arbeit untersucht?
Der Fokus liegt auf den Maßwerkfenstern des Regensburger Domes. Falls dortige Beispiele fehlen, werden andere Regensburger Kirchen hinzugezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Maßwerk, Gotik, Architekturgeschichte, Regensburg, Deutschland, Hochgotik, Rayonnant, Flamboyant, Fenster, Geometrie, Binding, Behling, Bauornamente, Stilentwicklung.
- Quote paper
- M.A. Erwin Maier (Author), 2002, Das gotische Maßwerkfenster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48902