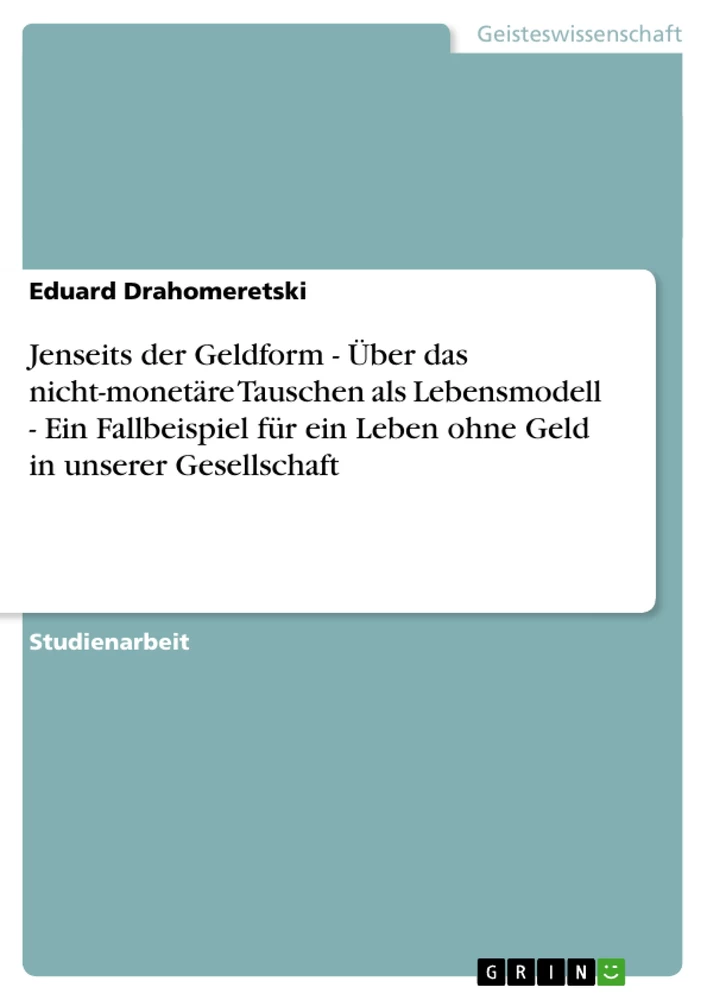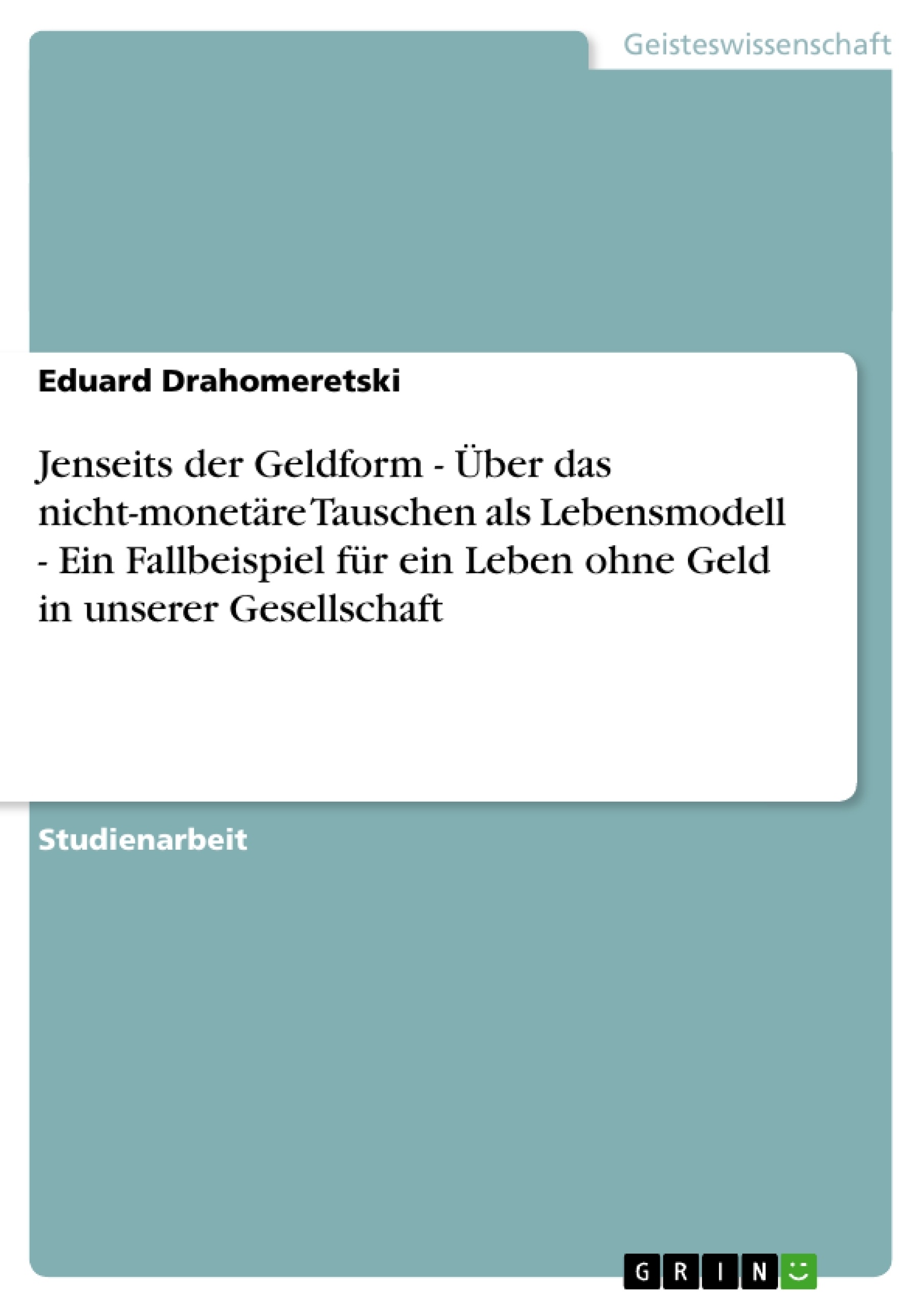“Money makes the world go round“ - in der modernen Gesellschaft findet dieser Satz auf jeder Ebene seine Bestätigung. Egal, ob es sich um den Kauf der Frühstücksbrötchen, dem Urlaub auf Mallorca, den Investitionen eines Unternehmens oder der Rentenversicherung handelt, stets geht es um die Frage, ob genug Geld da ist, und wenn nicht, woher man es nehmen soll. Nichts ist in der „Welt der Ware“ selbstverständlicher als die Existenz des Geldes. Die Erfahrung, dass nur wer über Geld verfügt, auch als Subjekt anerkannt wird und Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum erhält, hat sich tief in das Bewusstsein der Menschen verankert. Geld greift in vielfältige gesellschaftliche Bereiche ein, es durchdringt das gesellschaftliche Leben förmlich. Eine Abwendung von der herkömmlichen Geldordnung, gleicht einer Abwendung von der Gesellschaft, so könnte man meinen. „Und niemand kann sich den monetären Zwängen und Auswirkungen entziehen, es sei denn er flieht als Robinson auf eine Insel“.
Geld hat neben den drei klassischen ökonomischen Funktionen als Tausch- bzw. Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheit vielfältige symbolische Bedeutungen, die weit über die ökonomische neutrale Vorstellung von Geld hinausgeht: Es symbolisiert nicht nur Waren oder Dienstleistungen, sondern dient ebenso als Garant für Sicherheit, Mittel zu individuellen und sozialen Anerkennung, Maßstab für Erfolg, Leistung und sozialen Status sowie als Inbegriff für Macht, Freiheit und Unabhängigkeit. Ein Leben ohne ausreichend Geld ist eng verbunden mit psychischem und sozialem Druck und kann den sozialen Abstieg bedeuten.
Umso erstaunlicher scheint Heidemarie Schwermers freiwillige Entscheidung gänzlich auf Geld zu verzichten. Inspiriert vom Sterntaler-Märchen, in dem ein kleines Mädchen im wahrsten Sinne des Wortes ihr letztes Hemd verschenkt, trennte sie sich von ihrem Besitz, gab ihren Beruf auf und entschied sich für ein Leben ohne Geld.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A: Nicht monetäre Tauschsysteme
- 1 Begriffsklärung
- 2 Exemplarischer Überblick über die Entwicklung von Tauschringen
- 3 Nutzungs- und Gründungsmotive
- 4 Funktionsweise von Tauschringen
- 4.1 Grundgedanke
- 4.2 Reziprozität beim Tausch
- 4.3 Grundlegende Probleme und Lösungsstrategien
- 4.4 Soziale Dimension von Tauschringen
- 5 Zwischenfazit
- Teil B: Schwermers Leben ohne Geld
- 6 Das „Sterntalerexperiment“
- 6.1 Lebensweise
- 6.2 Geldlose Sicherheit
- 7 Soziales Kapital als Lebensstrategie
- 7.1 Begriffsklärung
- 7.2 Generierung und Nutzung von sozialem Kapital
- 8 Fazit
- 6 Das „Sterntalerexperiment“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit eines Lebens ohne Geld in der modernen Gesellschaft anhand des Fallbeispiels von Heidemarie Schwermer und ihrem „Sterntalerexperiment“. Die Zielsetzung besteht darin, nicht-monetäre Tauschsysteme zu analysieren und deren Rolle im Kontext von Schwermers Experiment zu beleuchten. Die Bedeutung sozialen Kapitals als Lebensstrategie wird dabei besonders hervorgehoben.
- Nicht-monetäre Tauschsysteme und ihre historische Entwicklung
- Funktionsweise und Herausforderungen von Tauschringen
- Soziale Dimension von Tauschringen und ihre Bedeutung für Gemeinschaft
- Heidemarie Schwermers „Sterntalerexperiment“ und ihre Lebensweise ohne Geld
- Soziale Kapital als Ressource und seine Rolle im Geldausgleich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Geld in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig ist und tief im Bewusstsein der Menschen verankert ist. Sie führt das „Sterntalerexperiment“ von Heidemarie Schwermer ein, welche auf Geld verzichtete und eine alternative Lebensform entwickelte. Die Arbeit wird in zwei Teile gegliedert: Teil A behandelt nicht-monetäre Tauschsysteme, Teil B Schwermers Experiment und die Rolle von sozialem Kapital.
Teil A: Nicht-monetäre Tauschsysteme: Dieser Teil untersucht die Idee und Praxis nicht-monetärer Tauschsysteme. Er beleuchtet die historische Entwicklung von Tauschringen, beginnend mit frühen Versuchen wie denen von John Bellers und Robert Owen bis hin zu modernen Tauschringen. Die Funktionsweise von Tauschringen, inklusive der Rolle der Reziprozität und der Herausforderungen wie mangelnde Aktivität der Mitglieder, werden detailliert analysiert. Der von Schwermer gegründete Tauschring „Die Gib-und-Nimm-Zentrale“ dient als zentrales Fallbeispiel, um die soziale Dimension von Tauschringen zu illustrieren und deren Bedeutung für Schwermers Experiment zu verdeutlichen.
Teil B: Schwermers Leben ohne Geld: Dieser Teil fokussiert sich auf Schwermers „Sterntalerexperiment“, ihre vierjährige Erfahrung, ohne Geld zu leben. Ihre Lebensweise, einschließlich ihrer Strategien zum Wohnen, Essen, Bekleiden und ihren Umgang mit Freizeitaktivitäten wird dargestellt. Die Bedeutung von sozialem Kapital als Grundlage ihres Experimentes wird betont, sowie die Rolle des sozialen Netzwerkes bei der Minimierung von Risiken im Leben ohne finanzielle Absicherung. Die Arbeit analysiert wie Schwermer ihr soziales Kapital generierte und nutzte, um ihre Grundbedürfnisse zu decken und ein erfülltes Leben ohne Geld zu führen.
Schlüsselwörter
Geld, Tauschringe, Soziales Kapital, Nicht-monetärer Tausch, Heidemarie Schwermer, Sterntalerexperiment, Reziprozität, Lebensform, alternative Ökonomie, Gemeinschaft, Soziale Netzwerke
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Leben ohne Geld - Das Sterntalerexperiment von Heidemarie Schwermer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit eines Lebens ohne Geld in der modernen Gesellschaft. Sie analysiert nicht-monetäre Tauschsysteme und deren Rolle im Kontext des "Sterntalerexperiments" von Heidemarie Schwermer, wobei die Bedeutung von sozialem Kapital als Lebensstrategie im Vordergrund steht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung von Tauschringen, die Funktionsweise und Herausforderungen dieser Systeme, die soziale Dimension von Tauschringen, Schwermers "Sterntalerexperiment" (ihre Lebensweise ohne Geld und ihre Strategien), und die Rolle von sozialem Kapital als Ressource im Geldausgleich.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: Teil A befasst sich mit nicht-monetären Tauschsystemen im Allgemeinen, während Teil B Schwermers "Sterntalerexperiment" und die Rolle des sozialen Kapitals im Detail analysiert. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselbegriffe.
Was ist das "Sterntalerexperiment"?
Das "Sterntalerexperiment" beschreibt die vierjährige Erfahrung von Heidemarie Schwermer, in der sie ohne Geld lebte. Die Arbeit beschreibt ihre Lebensweise, Strategien zum Wohnen, Essen, Bekleiden und Freizeitaktivitäten sowie den Umgang mit den Herausforderungen dieser Lebensform.
Welche Rolle spielt soziales Kapital in der Arbeit?
Soziales Kapital wird als zentrale Ressource für ein Leben ohne Geld dargestellt. Die Arbeit analysiert, wie Schwermer ihr soziales Kapital generierte und nutzte, um ihre Grundbedürfnisse zu decken und ein erfülltes Leben ohne finanzielle Absicherung zu führen. Die Bedeutung sozialer Netzwerke zur Risikominimierung wird hervorgehoben.
Welche Arten von Tauschsystemen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet nicht-monetäre Tauschsysteme, insbesondere Tauschringe. Sie analysiert deren historische Entwicklung, von frühen Versuchen bis hin zu modernen Tauschringen, deren Funktionsweise (einschließlich Reziprozität), und die Herausforderungen, die mit solchen Systemen verbunden sind (z.B. mangelnde Aktivität der Mitglieder).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Geld, Tauschringe, Soziales Kapital, Nicht-monetärer Tausch, Heidemarie Schwermer, Sterntalerexperiment, Reziprozität, Lebensform, alternative Ökonomie, Gemeinschaft, Soziale Netzwerke.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die genaue Schlussfolgerung ist im bereitgestellten Textfragment nicht explizit genannt, jedoch lässt sich ableiten, dass die Arbeit die Machbarkeit und die Bedingungen eines geldfreien Lebens beleuchtet und die Bedeutung von sozialen Netzwerken und sozialem Kapital dabei hervorhebt.)
- Quote paper
- Eduard Drahomeretski (Author), 2005, Jenseits der Geldform - Über das nicht-monetäre Tauschen als Lebensmodell - Ein Fallbeispiel für ein Leben ohne Geld in unserer Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48827