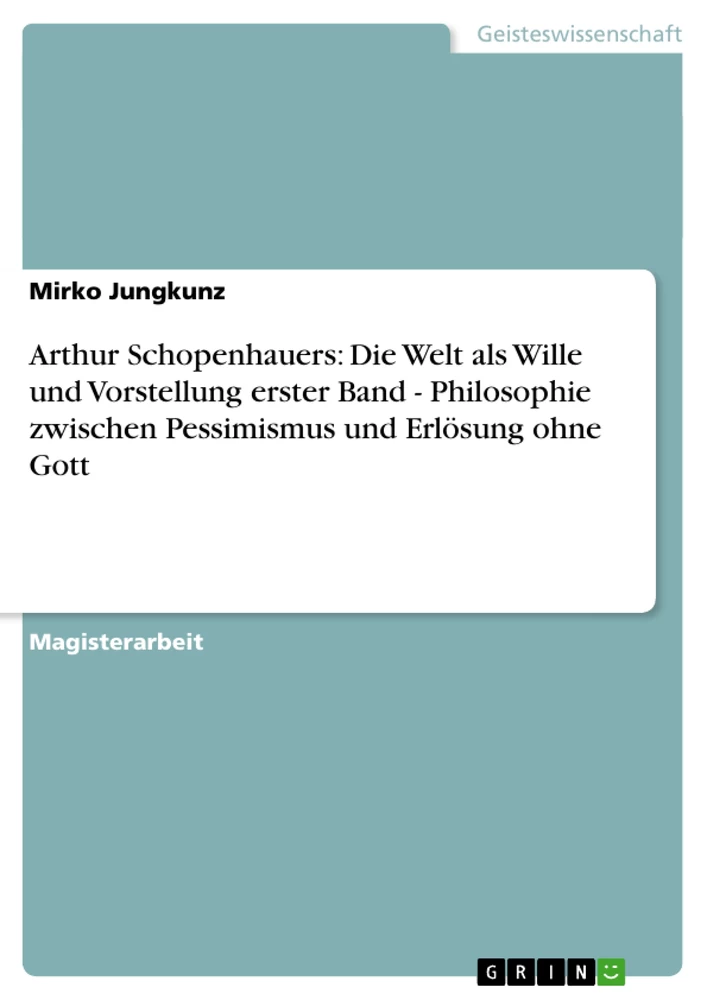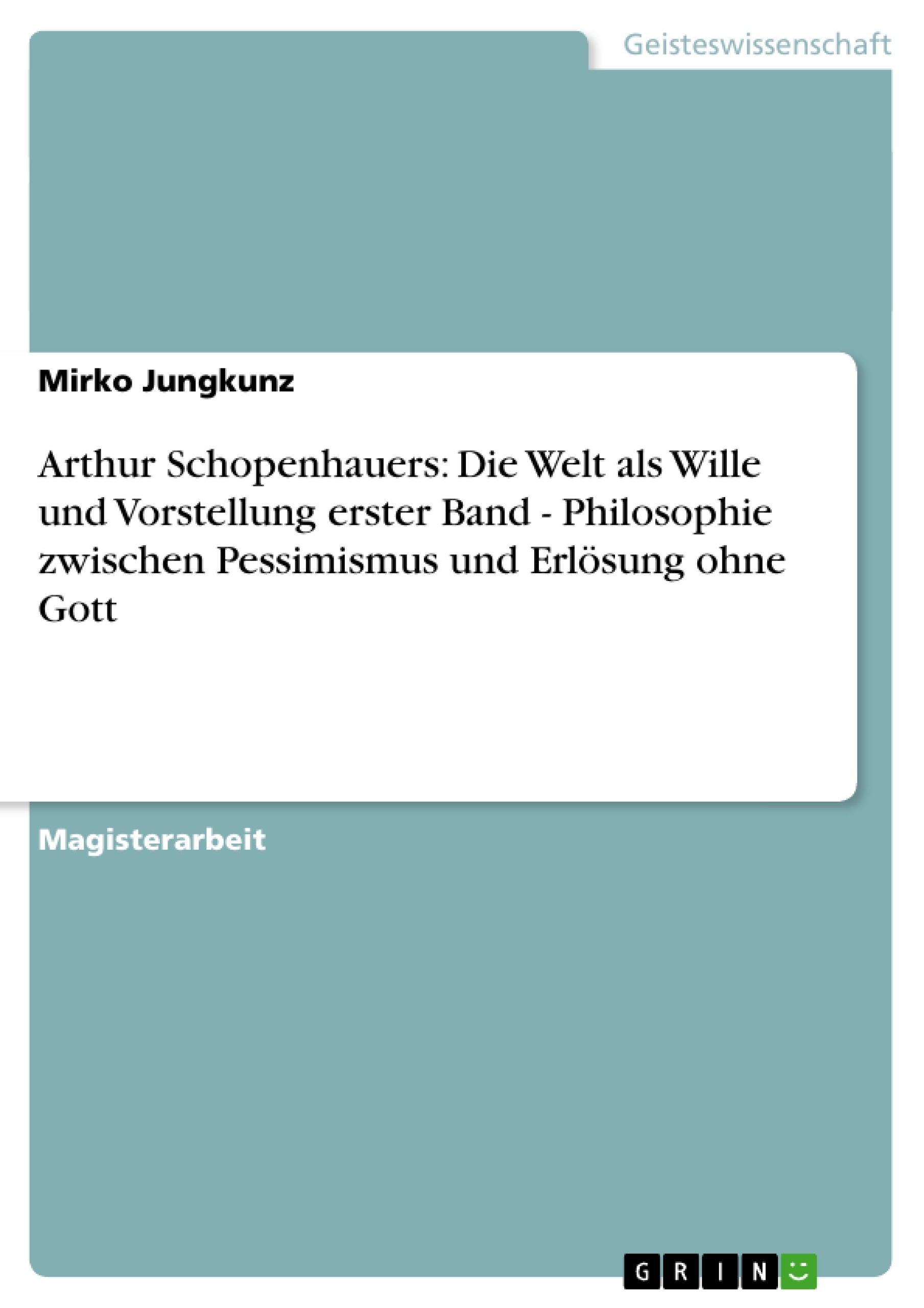Die Idee zu dieser Arbeit ergab sich aus dem Spannungsverhältnis von Kunst und Erlösung in Schopenhauers Denken. Die Aufarbeitung von 'Die Welt als Wille und Vorstellung erster Band', genauso wie die Aufarbeitung der verschiedenen Interpretationsentwürfe stellt somit den Versuch dar, die wesentlichen Entwicklungslinien der Rezeption des Schopenhauerschen Oeuvres wiederzugeben. Erst damit kann die Überlegung, die sich mit der spezifischen Problematik der Konkretisierung von Erlösung beschäftigt, einer fruchtbaren Lösung entgegengeführt werden. In diesem Sinne ist die hier vorliegende Arbeit lediglich ein Annäherungsversuch. Durch die Aufarbeitung der verschiedensten Interpretationsentwürfe, ebenso wie durch die direkte Auseinandersetzung mit Schopenhauer, soll überprüft werden, auf welcher Grundlage es zu einem Verständnis kommen kann, welches in der Kunst bzw. in der Fähigkeit des ästhetischen Betrachtens den wesentlichen, denmetaphysischen KernSchopenhauerschen Philosophierens erkennt. Auf die Konsequenz dieser Annahme, d.h. Kunst als die einzig relevante Realisationsmöglichkeit von Leidbefreiung zu erkennen, wird im abschließenden Teil lediglich verwiesen. Damit muss die vorliegende Arbeit vielmehr als propädeutische Maßnahme verstanden werden, die es ermöglicht philosophische Texte, die sich direkt der Grundlegung von Erlösung im Kunstgeschehen bedienen, kritisch aufzuarbeiten. Mit diesem Charakterisierungsversuch der Grundintention vorliegender Arbeit einher geht die Voraussetzung, dass sowohl die Frage nach Erlösung als auch die Bedeutung des Schopenhauerschen Denkens bezüglich dieses Fragens als relevant erkannt wird. Sollte dem nicht so sein, so wird auch dies zur Aufgabe dieser Untersuchung.
Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Interpretationsvorschläge hinsichtlich ihrer inneren, argumentativen Vorgehensweise darzustellen. Voraussetzung dafür ist die ausführliche Rekonstruktion des Primärtextes, d.h. die detaillierte Auseinandersetzung mit 'Die Welt als Wille und Vorstellung, Erster Band'. Erst dies ermöglicht es, sich auf kritische Art und Weise mit den verschiedensten Interpretationsentwürfen auseinander zu setzen. Dabei wird deutlich werden, dass sich trotz nachgewiesenen Konversionsgeschehens (sowohl in der Rezeptionsgeschichte der ablehnenden als auch der zustimmenden Interpreten) eine Stagnation im Verständnis der Philosophie Schopenhauers eingestellt hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort
- II. Einleitung
- III. Pessimismus - Besseres Bewusstsein - Mitleid und Heilslehre - Grundzüge der Philosophie Schopenhauers
- IV. Darstellung der Philosophie Schopenhauers – 'Die Welt als Wille und Vorstellung erster Band'
- IV.1. Erkenntnistheorie
- IV.1.1. Kant und die koperkanische Wende - das ewig dunkle Ding an sich
- IV.1.2. Die Welt ist meine Vorstellung – Schopenhauers spezifischer Entwurf einer Erkenntnistheorie
- IV.1.2.1. Subjekt-Objekt-Beziehung oder die Abgrenzung von absoluten Idealismus und Realismus
- IV.1.2.2. Intuitive und abstrakte Vorstellung – Erörterung und Beurteilung der Leistungen des Verstandes und der Vernunft
- IV.1.2.2.1. Der Verstand
- IV.1.2.3. Wissenschaft- Geltung und Grenzen der Erkenntnis am Leitfaden des Satzes vom Grunde
- IV.2. Metaphysik
- IV.2.1. Die Suche nach dem Was der Welt - Schopenhauers Grenzgang im Niemandsland
- IV.2.2. Die Entdeckung des Selbstbewusstseins -Schopenhauer gräbt sich einen Tunnel zum Ding an sich
- IV.2.3. Identität von Leib und Wille und der Analogieschluss - Vom eigenen Leib zur Gesamtheit der Erscheinungen
- IV.2.4. Konsequenz - Metaphysik der Natur und die Stufen der Objektivation des Willens
- IV.2.5. Die Tragweite der metaphysischen Bestimmung des Wesens als Wille - oder: die sich ergänzenden Ebenen zur Bestätigung der These, alles Leben ist Leiden
- IV.2.5.1. Die Gesamtheit des Seins betreffend
- IV.2.5.2. Den Menschen betreffend
- IV.2.6. Die Hoffnungslosigkeit der Schopenhauerschen Metaphysik und die Frage wo das Rettende erwächst
- IV.3. Ästhetik
- IV.3.1. Erkenntniskomplettierung
- IV.3.1.1. Das entindividualisierte Subjekt der reinen Erkenntnis
- IV.3.1.2. Das Objekt der Kunst – Die platonischen Ideen als die Stufen der Objektivation des Willens
- IV.3.2. Schopenhauers Bild des Kunstwerkes - Der Genius und die Wiederholung der durch die reine Anschauung aufgefassten ewigen Ideen
- IV.3.3. Schopenhauers Bild des Künstlers - Die Tragik der Schopenhauerschen Kunstkonzeption und die Frage nach dem Ernst der Dinge
- IV.4. Ethik
- IV.4.1. Einschränkung des Geltungsbereiches einer Willensethik- Die Tugend wird nicht gelehrt sowenig wie der Genius
- IV.4.2. Die Freiheit des Willens und die Notwendigkeit der Erscheinungswelt - Intellegibler und empirischer Charakter
- IV.4.3. Die Bejahung des Willens und der daraus resultierende Ethikentwurf
- IV.4.3.1. Egoismus als unmittelbarer Ausdruck des menschlichen Wesens
- IV.4.3.2. Die hierarchische Struktur im Schopenhauerschen Moralverständnis
- IV.4.3.3.1. Gerechtigkeit
- IV.4.3.3.2. Mitleid
- IV.5. Schopenhauers Heilslehre
- IV.5.1. Der Asket und die Verneinung des Willens als eigentlich freiheitlicher Akt
- IV.5.2. Die Veränderung der Erkenntnisart und der Widerspruch zwischen Willensverneinung und leiblicher Existenz
- IV.6. Erleuchtung – Gnadenwirkung und der Übergang ins Nichts
- V. Versuch einer systematischen Darstellung der problematischen Argumentationsschritte in 'Die Welt als Wille und Vorstellung erster Band' anhand der Rezeptionsgeschichte
- V.1. Argumentationsverlauf unkritisch-zustimmenden Interpreten oder - Gehen Schopenhauer und Kant Hand in Hand?
- V.1.1. Unmittelbare Verbundenheit – Kant und Schopenhauer gehen Hand in Hand
- V.1.2. Metaphysik – Der Alleinherrscher Wille ist das Ding an sich
- V.2. Argumentationsverlauf kritisch-zustimmender Interpreten
- V.2.1. Die Eigenheit der Schopenhauerschen Philosophie - Schopenhauers kritisches Verhältnis zur kantischen Philosophie
- V.2.2. Die veränderte Verstehensart des Willens und die Annäherung an die Ausgangsfrage der Schopenhauerschen Philosophie
- V.3. Zusammenfassung der zustimmenden Interpretationsentwürfe
- V.4. Argumentationsverlauf der unkritisch-ablehnenden Interpretationsentwürfe
- V.4.1. Erkenntnistheorie und Metaphysik - Ein Gewirr von Widersprüchen
- V.4.1.1. Der Grundwiderspruch – Das Ding an sich ist Wille
- V.4.2. Spezifische Einwände
- V.4.2.1. Erkenntnistheorie
- V.4.2.2. Willensmetaphysik
- V.4.2.2.1. Metaphysik des Grundes und theoretischer Egoismus – Schopenhauer widerspricht seinen eigenen Prämissen
- V.4.2.2.2. Zellscher Zirkel – Widerspruch zwischen transzendentaler und naturwissenschaftlicher Sichtweise
- V.4.3. Ästhetik und Willensmetaphysik – Der Widerspruch zwischen Ideenlehre und Ding an sich
- V.4.4. Ethik
- V.4.4.1. Anhängsel der Schopenhauerschen Philosophie
- V.4.4.2. Schopenhauers Immoralität
- V.5. Argumentationsverlauf der kritisch-ablehnenden Interpretationsentwürfe
- V.5.1. Die Entdeckung des Willens - Schopenhauers eigentlicher Verdienst
- V.5.2. Der Wille und das Ding an sich
- V.6. Die Einwände gegen die Heilslehre
- V.6.2. Contradictio in adjecto – Der real-existierende Heilige
- V.6.3. Widerspruch zwischen individueller Willensverneinung und dem Fortbestehen der Welt
- V.7. Zusammenfassung der Rezeptionsgeschichte zu Schopenhauer – Die drei Hauptschwierigkeiten von 'Die Welt als Wille und Vorstellung erster Band'
- V.7.1. Die Ausgangsfrage
- V.7.2. Ding an sich – Kant und Schopenhauer
- V.7.3. Die Willensmetaphysik – Hauptteil der Schopenhauerschen Philosophie
- V.8. Der soteriologische Interpretationsentwurf
- V.8.1. Grundlegender Anspruch
- V.8.2. Erkenntnistheorie – oder die erste Krise der Philosophie
- V.8.3. Metaphysik – oder die zweite Krise der Philosophie Schopenhauers
- V.8.4. Ästhetik - oder die dritte Krise der Philosophie Schopenhauers
- V.8.5. Heilslehre - oder die vierte Krise der Philosophie Schopenhauers
- V.8.6. Zusammenfassung des soteriologischen Standpunktes
- V.9 Kunst als die eigentlich-metaphysische Tätigkeit des Menschen
- V.1.9. Die Unhaltbarkeit der absoluten Willensverneinung
- V.9.2. Philosophie und Kunst – Charakterisierung des Blickes in das Wesen der Welt
- V.9..2.1. Vernünftige Metaphysik – oder die plausibel gemachte Vermutung
- Schopenhauers Erkenntnistheorie im Kontext von Kant
- Die metaphysische Konzeption des Willens als Ding an sich
- Die Rolle der Ästhetik in Schopenhauers Philosophie
- Schopenhauers Ethik und die Frage nach der Willensbejahung und -verneigung
- Die Schopenhauersche Heilslehre und ihre Rezeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arthur Schopenhauers "Die Welt als Wille und Vorstellung, erster Band" und analysiert die Grundzüge seiner Philosophie. Sie befasst sich mit der systematischen Aufarbeitung der immanenten Problematiken und untersucht verschiedene Interpretationsansätze.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorwort: Das Vorwort dient als Einleitung und gibt einen kurzen Überblick über die Thematik und den Ansatz der Arbeit. Es skizziert die zentrale Fragestellung und erläutert die methodische Vorgehensweise bei der Analyse von Schopenhauers Werk.
II. Einleitung: Die Einleitung führt umfassend in die Philosophie Schopenhauers ein, und bietet einen Kontext für das Verständnis seines Werkes. Sie legt die zentralen Begriffe und Konzepte dar und benennt die wichtigsten Herausforderungen, die die Interpretation seines Werkes mit sich bringt. Die Einleitung bereitet den Leser auf die folgenden Kapitel vor, indem sie die grundlegenden Argumentationslinien aufzeigt.
III. Pessimismus - Besseres Bewusstsein - Mitleid und Heilslehre - Grundzüge der Philosophie Schopenhauers: Dieses Kapitel stellt die Grundzüge der Schopenhauerschen Philosophie dar, wobei der Pessimismus, das Mitleid und die Heilslehre als zentrale Elemente herausgestellt werden. Es beleuchtet die Verbindung zwischen Leidenserfahrung und dem Streben nach Erlösung, wobei die Grenzen des menschlichen Daseins erörtert werden und die Rolle des Mitleids als moralische Orientierung im Kontext des pessimistischen Weltbildes hervorgehoben wird.
IV. Darstellung der Philosophie Schopenhauers – 'Die Welt als Wille und Vorstellung erster Band': Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der Schopenhauerschen Philosophie anhand seines Hauptwerks. Es gliedert sich in die Teilbereiche Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik, Ethik und Heilslehre und untersucht diese Bereiche im Detail, wobei die systematischen Zusammenhänge und wechselseitigen Bezüge hervorgehoben werden. Es analysiert kritisch Schopenhauers Argumentationslinien und stellt die komplexen Interdependenzen zwischen seinen verschiedenen philosophischen Positionen heraus.
V. Versuch einer systematischen Darstellung der problematischen Argumentationsschritte in 'Die Welt als Wille und Vorstellung erster Band' anhand der Rezeptionsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Schopenhauerschen Philosophie und analysiert die jeweiligen Argumentationslinien kritisch. Es zeigt sowohl zustimmenden als auch ablehnenden Interpretationen auf, erörtert die darin enthaltenen Widersprüche und bietet eine differenzierte Betrachtung der Rezeptionsgeschichte des Werkes an. Es stellt die verschiedenen Interpretationsansätze einander gegenüber und arbeitet heraus, welche zentralen Punkte der Debatte sind und wie diese sich zueinander verhalten.
Schlüsselwörter
Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Erkenntnistheorie, Metaphysik, Wille, Ding an sich, Pessimismus, Mitleid, Ästhetik, Ethik, Heilslehre, Rezeptionsgeschichte, Kant, Interpretationsentwürfe, Willensverneinung.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Welt als Wille und Vorstellung" von Arthur Schopenhauer
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über ein akademisches Werk, das sich mit Arthur Schopenhauers "Die Welt als Wille und Vorstellung, erster Band" auseinandersetzt. Sie beinhaltet ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der systematischen Analyse der Schopenhauerschen Philosophie, der kritischen Auseinandersetzung mit seinen Argumentationslinien und der Betrachtung verschiedener Interpretationsansätze in der Rezeptionsgeschichte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Aspekte der Schopenhauerschen Philosophie, darunter seine Erkenntnistheorie im Kontext Kants, seine metaphysische Konzeption des Willens als Ding an sich, die Rolle der Ästhetik und die Bedeutung von Mitleid in seiner Ethik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Schopenhauers Pessimismus und seiner Heilslehre sowie der kritischen Analyse der immanenten Problematiken seiner Philosophie und der unterschiedlichen Interpretationsansätze in der Rezeptionsgeschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptkapitel: Ein Vorwort und eine Einleitung führen in die Thematik ein. Kapitel III gibt einen Überblick über die Grundzüge der Schopenhauerschen Philosophie. Kapitel IV bietet eine detaillierte Analyse von "Die Welt als Wille und Vorstellung, erster Band", unterteilt in die Bereiche Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik, Ethik und Heilslehre. Kapitel V untersucht die problematischen Argumentationsschritte in Schopenhauers Werk anhand der Rezeptionsgeschichte, analysiert verschiedene Interpretationen und deren Widersprüche.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Analyse verwendet?
Schlüsselkonzepte der Analyse sind: Erkenntnistheorie, Metaphysik, Wille, Ding an sich, Pessimismus, Mitleid, Ästhetik, Ethik, Heilslehre, Rezeptionsgeschichte, Kant, Interpretationsentwürfe und Willensverneinung. Die Arbeit untersucht, wie diese Konzepte ineinandergreifen und wie sie die Schopenhauersche Philosophie prägen.
Wie wird die Rezeptionsgeschichte von Schopenhauers Werk behandelt?
Die Rezeptionsgeschichte wird ausführlich in Kapitel V behandelt. Es werden verschiedene Interpretationsansätze untersucht, sowohl zustimmend als auch ablehnend, und deren jeweilige Argumentationslinien kritisch analysiert. Die Arbeit beleuchtet Widersprüche und zeigt die zentralen Punkte der Debatte auf, um ein differenziertes Bild der unterschiedlichen Interpretationen zu liefern.
Welche Fragen werden in der Arbeit gestellt und beantwortet?
Die Arbeit untersucht kritisch die Argumentationsschritte in Schopenhauers "Die Welt als Wille und Vorstellung" und die verschiedenen Interpretationen in der Rezeptionsgeschichte. Sie stellt Fragen nach der Konsistenz seiner Philosophie, dem Verhältnis zu Kant, der Rolle des Willens als Ding an sich, der Bedeutung der Ästhetik und der Möglichkeit der Willensverneinung als Weg zur Erlösung. Die Antworten werden durch eine systematische Analyse des Werkes und eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Interpretationen erarbeitet.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich auf akademischer Ebene mit der Philosophie Arthur Schopenhauers und insbesondere mit seinem Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung" auseinandersetzen möchten. Sie richtet sich an Studenten, Wissenschaftler und alle Interessierten, die ein tiefes Verständnis von Schopenhauers Philosophie und ihrer Rezeptionsgeschichte erlangen wollen.
- Arbeit zitieren
- M.A. Mirko Jungkunz (Autor:in), 2005, Arthur Schopenhauers: Die Welt als Wille und Vorstellung erster Band - Philosophie zwischen Pessimismus und Erlösung ohne Gott, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48738