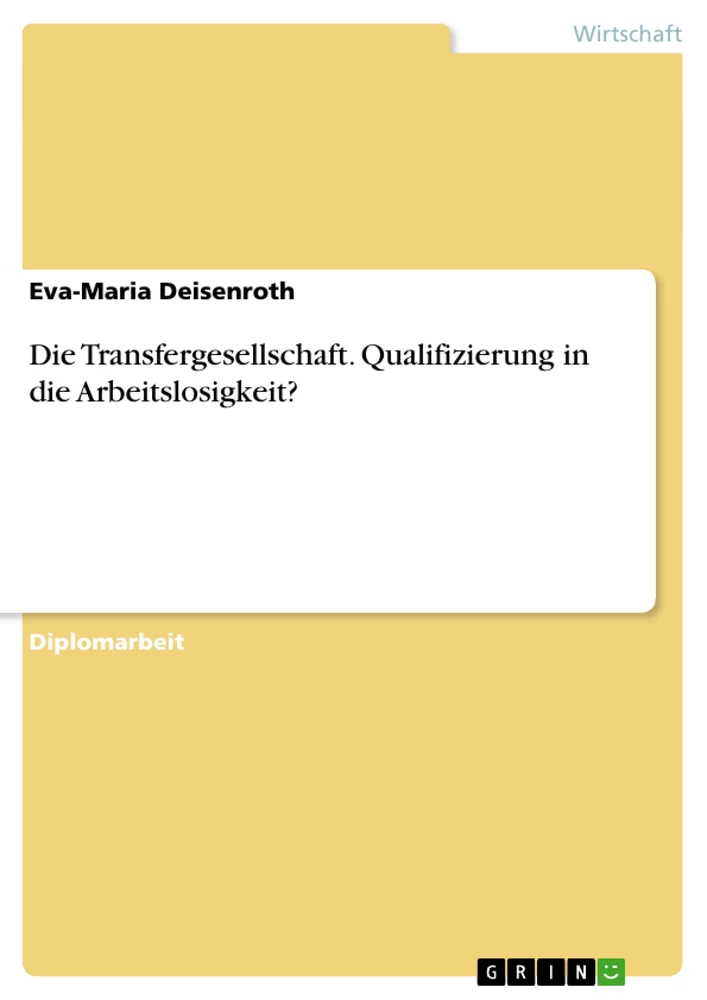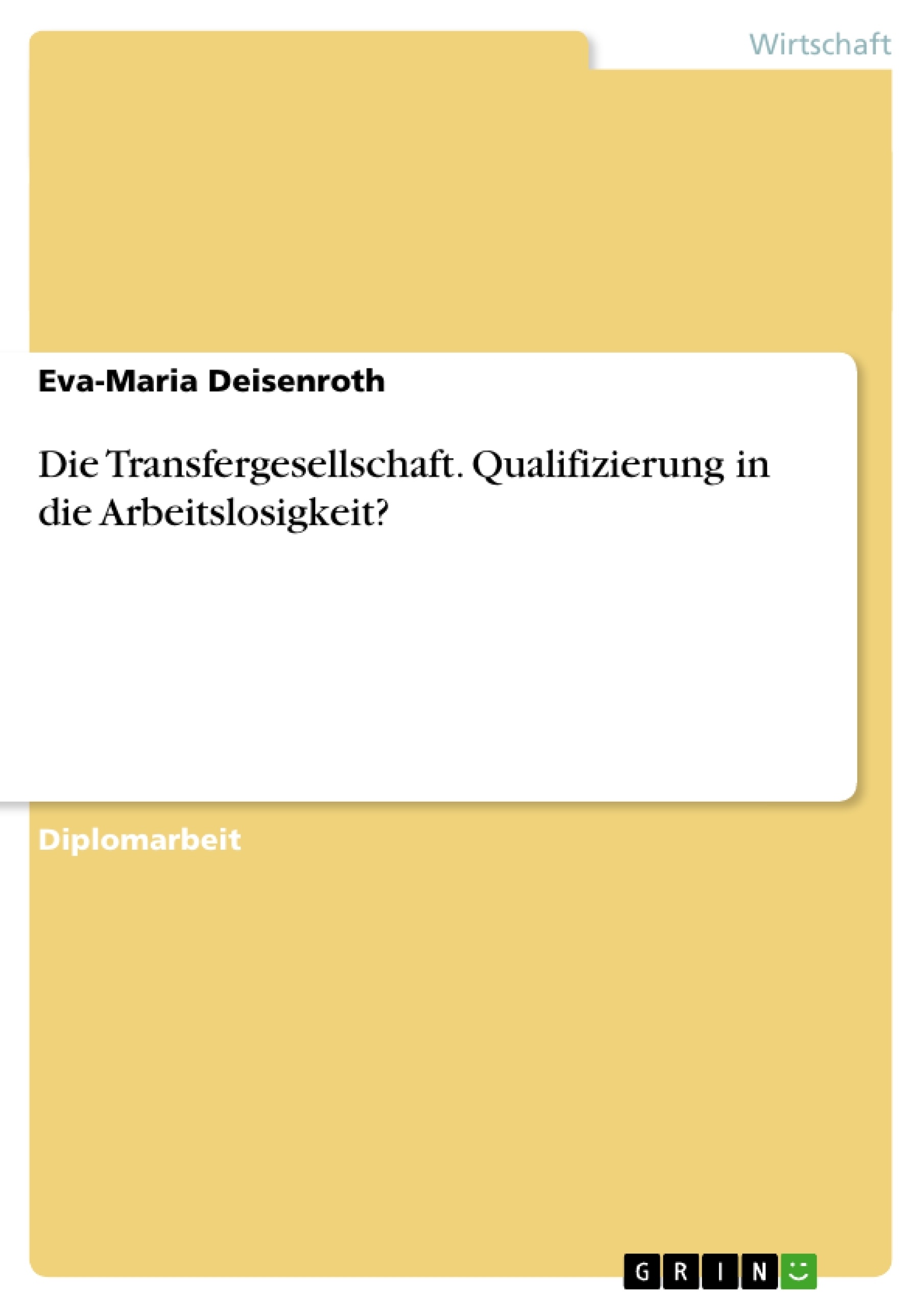Durch die Restrukturierung von Unternehmen kommt es häufig zu erheblichen Personalanpassungsmaßnahmen, die möglichst zeitnah umgesetzt werden müssen. Diese Zielsetzung ist jedoch kurzfristig weder durch den Ausspruch einer Vielzahl betriebsbedingter Kündigungen, noch durch den Abschluss von Aufhebungsverträgen gegen Zahlung einer Abfindung zu erreichen. Bei betriebsbedingten Kündigungen führen die gesetzlichen Vorgaben zur Sozialauswahl nicht selten zu einer Verschlechterung der betrieblichen Alters- und Leistungsstruktur und damit zu einer weiteren Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Im Rahmen der Agenda 2010 wurden Änderungen im Kündigungsschutzgesetz (KSchG) vorgenommen, welche besagen, dass Mitarbeiter, deren Weiterbeschäftigung zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur im berechtigten betrieblichen Interesse liegt, nicht mehr in die soziale Auswahl einbezogen werden müssen (§ 1 Abs. 3, Satz 2 KSchG).
Der Beweis des Vorliegens dieser Ausnahmeregelung ist allerdings äußerst schwierig zu führen. Außerdem bringen mehrmonatige Kündigungsfristen nicht nur langwierige Unruhe in der Belegschaft, sondern, was gerade auf Publikumsvertrauen angewiesene Branchen zutrifft, eine Verunsicherung am Markt. Mit dem Abschluss von Aufhebungsverträgen lässt sich diese Problematik nur teilweise umgehen. Zwar wird ein schnelles Ausscheiden der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ermöglicht, dieser Zeitvorteil wird aber mit erheblichen sozialversicherungsrechtlichen Nachteilen sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite erkauft. Beispiele hiefür sind das Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs gem. § 143a SGB III und die Pflicht zur Erstattung des Arbeitslosengeldes (ALG) bei älteren Mitarbeitern gem. § 147a SGB III. Es wird daher in der Praxis immer häufiger auf die Alternative der Errichtung oder Beauftragung einer Transfergesellschaft zurückgegriffen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die betroffenen Mitarbeiter von den Vorteilen des Einsatzes einer Transfergesellschaft überzeugt werden müssen, da ein Wechsel nur einvernehmlich erfolgen kann. Dies geschieht häufig durch im Sozialplan festgelegte finanzielle Anreize.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit und Gang der Untersuchung
- 2 Das Modell Transfergesellschaft
- 2.1 Ursprung und Entwicklung der Transfergesellschaft
- 2.1.1 Entstehungsgeschichte
- 2.1.2 Begriffserklärung „Transfergesellschaft”
- 2.2 Rechtliche Stellung
- 2.2.1 Arbeitsrechtliche Aspekte
- 2.2.1.1 Einvernehmlichkeit des Wechsels
- 2.2.1.2 Betriebsübergang gemäß § 613a BGB
- 2.2.1.3 Befristung der Arbeitsverträge
- 2.2.1.4 Interne oder externe Durchführung der Maßnahme
- 2.2.2 Sozialversicherungsrechtliche Aspekte
- 2.2.2.1 Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs
- 2.2.2.2 Pflicht zur Erstattung des Arbeitslosengeldes bei älteren Arbeitnehmern
- 2.2.3 Leistungen der Transfergesellschaften
- 2.3 Finanzierung
- 2.3.1 Voraussetzung der Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen gemäß § 216a SGB III
- 2.3.1.1 Betriebsänderung
- 2.3.1.2 Durchführung durch einen Dritten mit Qualitätssicherungssystem
- 2.3.1.3 Eingliederungszweck
- 2.3.1.4 Beteiligung des Arbeitgebers
- 2.3.1.5 Verfahren der Förderung
- 2.3.2 Voraussetzungen für den Erhalt von Transferkurzarbeitergeld gemäß § 216b SGB III
- 2.3.2.1 Dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall mit Entgeltausfall
- 2.3.2.2 Betriebliche Voraussetzungen
- 2.3.2.3 Persönliche Voraussetzungen
- 2.3.2.4 Anzeigepflicht
- 2.3.2.5 Verfahren der Förderung
- 2.3.3 Sonstige Fördermöglichkeiten
- 3 Die Transfergesellschaft am Beispiel der LG.Philips-Displays GmbH - Aachen
- 3.1 Vorstellung des Unternehmens
- 3.2 Personalabbaumaßnahmen bei LG.Philips-Displays in Aachen
- 3.2.1 System der Sozialauswahl und Aufhebungsvertragsinhalte
- 3.3 Inhalte des Sozialplanes vom 17.12.2003
- 3.3.1 Abfindungen
- 3.3.2 Besondere Regelung für ältere Mitarbeiter
- 3.3.3 Angebot eines anderen freien Arbeitsplatzes innerhalb des Konzerns
- 3.3.4 Sonstige Vereinbarungen
- 3.4 Die Aachener Beschäftigungsinitiative
- 3.4.1 Voraussetzungen für den Wechsel und Vertragsinhalte
- 3.4.2 Zusammensetzung der Mitarbeiter in der LG.Philips-Displays Transfergesellschaft
- 3.4.3 Durchgeführte Qualifizierungsmaßnahmen
- 3.4.4 Vermittlungen
- 4 Beurteilung des Instrumentes
- 4.1 Vor- und Nachteile für die Betriebsparteien
- 4.2 Das Instrument Transfergesellschaft in der aktuellen Arbeitsmarktlage
- 5 Kritische Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Instrument der Transfergesellschaft. Ziel ist es, das Modell der Transfergesellschaft umfassend zu beschreiben und seine Funktionsweise anhand eines Praxisbeispiels zu analysieren. Dabei werden sowohl die rechtlichen als auch die finanziellen Aspekte beleuchtet.
- Rechtliche Rahmenbedingungen von Transfergesellschaften
- Finanzierung und Fördermöglichkeiten von Transfergesellschaften
- Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb von Transfergesellschaften
- Bewertung der Effektivität von Transfergesellschaften
- Praxisbeispiel: LG.Philips-Displays GmbH Aachen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Transfergesellschaft ein und beschreibt die Problemstellung des Übergangs von Arbeitnehmern in die Arbeitslosigkeit. Es formuliert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
2 Das Modell Transfergesellschaft: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Darstellung des Modells Transfergesellschaft, beginnend mit seiner Entstehungsgeschichte und Begriffsbestimmung. Es analysiert die arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte, beleuchtet die Leistungen der Transfergesellschaften und deren Finanzierung, inklusive der Fördermöglichkeiten gemäß SGB III. Es wird auf die verschiedenen Voraussetzungen und das Antragsverfahren eingegangen, um ein umfassendes Bild der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu zeichnen.
3 Die Transfergesellschaft am Beispiel der LG.Philips-Displays GmbH - Aachen: Dieses Kapitel präsentiert ein detailliertes Fallbeispiel der LG.Philips-Displays GmbH in Aachen. Es beschreibt den Personalabbau, die Inhalte des Sozialplans, die Aachener Beschäftigungsinitiative und die darin durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen. Die Zusammensetzung der Mitarbeiter in der Transfergesellschaft hinsichtlich Alter, Geschlecht und Nationalität wird analysiert, ebenso wie die Erfolgsquote der Vermittlungsmaßnahmen. Dieses Kapitel liefert konkrete Einblicke in die praktische Anwendung des Transfergesellschaft-Modells.
4 Beurteilung des Instrumentes: In diesem Kapitel werden die Vor- und Nachteile des Instrumentes Transfergesellschaft für die beteiligten Betriebsparteien bewertet. Der Einfluss der aktuellen Arbeitsmarktlage auf die Effektivität von Transfergesellschaften wird untersucht und diskutiert.
Schlüsselwörter
Transfergesellschaft, Arbeitslosigkeit, Qualifizierung, Sozialplan, Personalabbau, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Finanzierung, Förderung, SGB III, Betriebsänderung, Reintegration, Aachener Beschäftigungsinitiative, LG.Philips-Displays.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit "Transfergesellschaft am Beispiel der LG.Philips-Displays GmbH - Aachen"
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Instrument der Transfergesellschaft umfassend. Sie beschreibt das Modell, analysiert seine Funktionsweise anhand eines Praxisbeispiels (LG.Philips-Displays GmbH Aachen), beleuchtet rechtliche und finanzielle Aspekte und bewertet dessen Effektivität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen von Transfergesellschaften, deren Finanzierung und Fördermöglichkeiten (inkl. SGB III), Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der Gesellschaften, die Bewertung ihrer Effektivität und ein detailliertes Fallbeispiel der LG.Philips-Displays GmbH in Aachen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung), Das Modell Transfergesellschaft (Ursprung, rechtliche Stellung, Finanzierung), Fallbeispiel LG.Philips-Displays GmbH Aachen (Personalabbau, Sozialplan, Aachener Beschäftigungsinitiative), Beurteilung des Instruments (Vor- und Nachteile, Arbeitsmarktlage) und eine kritische Zusammenfassung mit Ausblick.
Welche Aspekte der Transfergesellschaft werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte von Transfergesellschaften, die verschiedenen Fördermöglichkeiten gemäß SGB III (einschließlich der Voraussetzungen und des Antragsverfahrens), die Leistungen der Transfergesellschaften und deren Finanzierung. Das Fallbeispiel analysiert den Personalabbau, den Sozialplan, die durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen und die Vermittlungsbemühungen.
Was ist das Fallbeispiel und welche Informationen liefert es?
Das Fallbeispiel ist die LG.Philips-Displays GmbH in Aachen. Es liefert konkrete Einblicke in die praktische Anwendung des Transfergesellschaft-Modells, inklusive Details zum Personalabbau, den Inhalten des Sozialplans (Abfindungen, Regelungen für ältere Mitarbeiter etc.), der Aachener Beschäftigungsinitiative (Qualifizierungsmaßnahmen, Vermittlungen) und der Zusammensetzung der Mitarbeiter in der Transfergesellschaft.
Welche Vor- und Nachteile von Transfergesellschaften werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet die Vor- und Nachteile des Instruments Transfergesellschaft für die beteiligten Betriebsparteien (Arbeitgeber, Arbeitnehmer). Der Einfluss der aktuellen Arbeitsmarktlage auf die Effektivität von Transfergesellschaften wird ebenfalls untersucht und diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Transfergesellschaft, Arbeitslosigkeit, Qualifizierung, Sozialplan, Personalabbau, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Finanzierung, Förderung, SGB III, Betriebsänderung, Reintegration, Aachener Beschäftigungsinitiative, LG.Philips-Displays.
- Quote paper
- Eva-Maria Deisenroth (Author), 2005, Die Transfergesellschaft. Qualifizierung in die Arbeitslosigkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48635