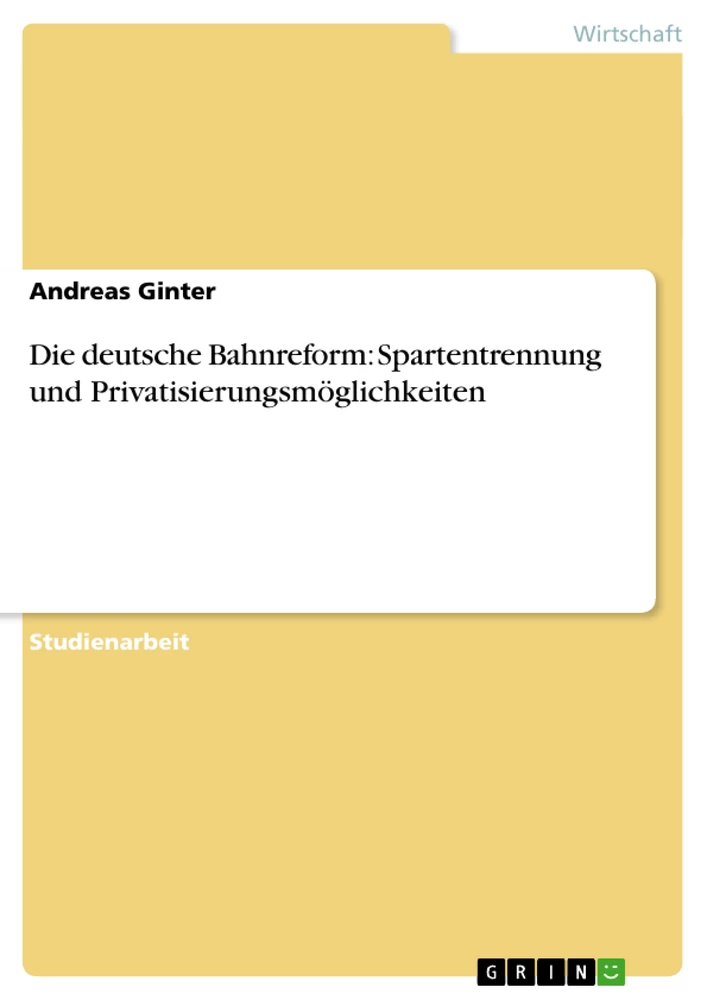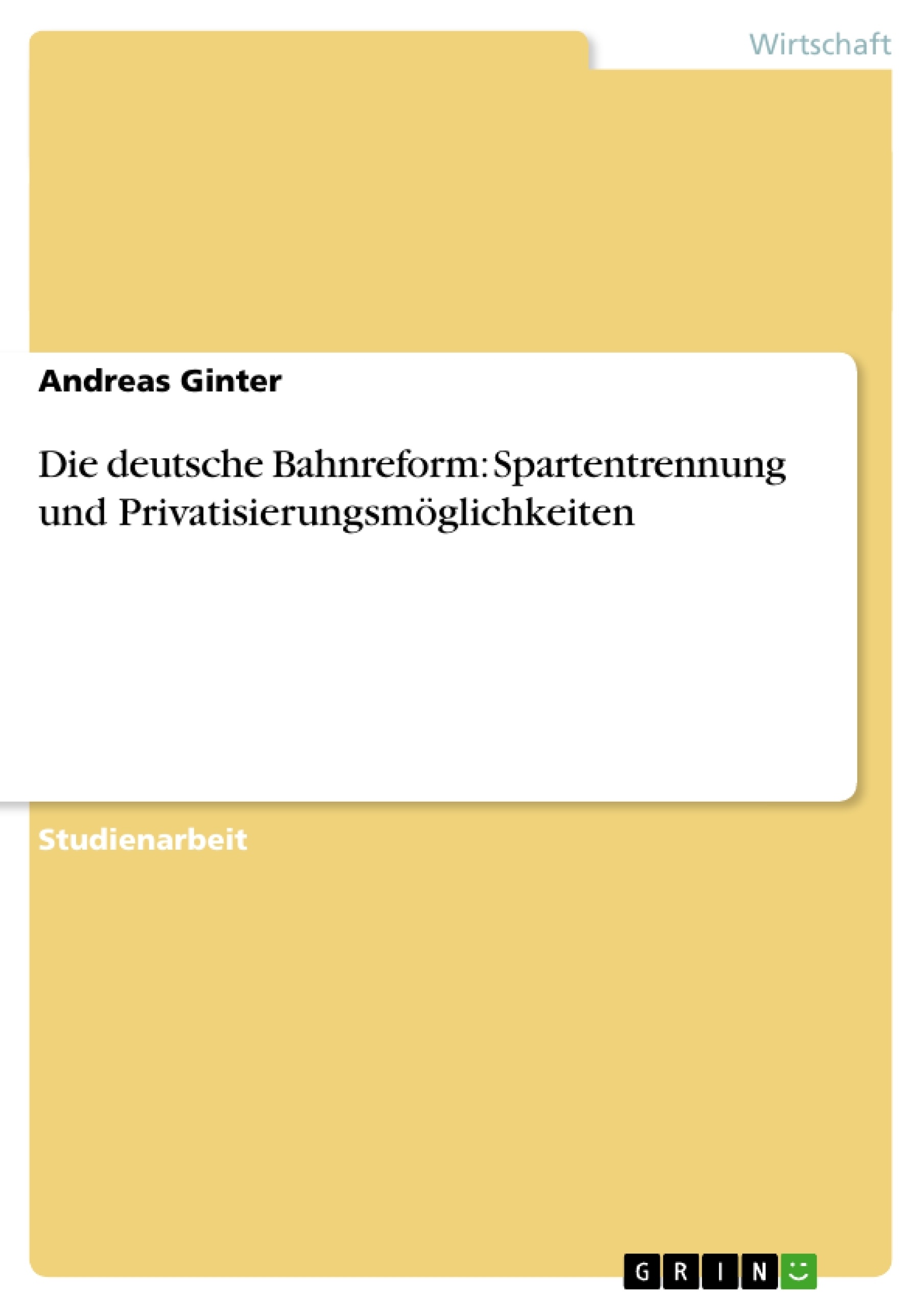1. Einleitung
Der Schienverkehr vor der Bahnreform war geprägt von verschlissener Infrastruktur, veraltetem rollenden Material und wenig Fahrgästen. Es schien als hätte der Schienenverkehr seine Daseinsberechtigung verloren. Eine grundlegende Umgestaltung des deutschen Eisenbahnwesens war notwendig.(1)
Die vorliegende Arbeit behandelt im ersten Teil die Entwicklung des deutschen Eisenbahnsektors von den Anfängen bis zur Bahnreform 1994. Es werden die Maßnahmen und Rahmenbedingungen dargestellt, welche den reformbedürftigen Zustand der Deutschen Bahn (DB) herbeiführten bzw. begünstigten. Die Reform der Bahn bildet den zweiten Schwerpunkt der Ausarbeitung. Im Fokus der Betrachtung stehen die Ziele der Reform, sowie das angewandte Stufenkonzept.
Inwieweit der Staat in den Wettbewerb mit regulativen Mitteln eingreifen soll, wird im nachfolgenden Abschnitt erörtert. Ausgehend von der Theorie des Marktversagens werden die Aspekte natürliches Monopol, externe Effekte, öffentliches Gut und ruinöser Wettbewerb für den Schienenverkehrssektor geprüft.
[...]
______
1 Vgl. Gradjot(2002), S. 140.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entwicklungen des deutschen Bahnsektors vor der Bahnreform 1994
- 3. Die deutsche Bahnreform 1994/1999
- 3.1 Ziele der Bahnreform
- 3.2 Das Stufenkonzept der Bahnreform
- 4. Rahmenbedingungen vor der Bahnreform - Marktversagen?
- 4.1 Natürliches Monopol
- 4.2 Externe Effekte
- 4.3 Eigenschaft der Verkehrsleistungen als öffentliche Güter
- 4.4 Tendenz zum ruinösen Wettbewerb
- 5. Trennung Fahrweg und Betrieb
- 5.1 Rechnerische Trennung
- 5.2 Organisatorische Trennung
- 5.3 Institutionelle Trennung
- 6. Eigentumsstruktur Eisenbahninfrastrukturunternehmen
- 6.1 Staatliche Bereitstellung
- 6.2 Private Bereitstellung
- 7. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die deutsche Bahnreform von 1994/1999, ihre Ursachen und ihre Auswirkungen auf den deutschen Bahnsektor. Der Fokus liegt auf der Analyse der Reformziele, des Stufenkonzepts und der Diskussion um die Trennung von Fahrweg und Betrieb sowie der Privatisierungsmöglichkeiten der Eisenbahninfrastruktur. Die Arbeit beleuchtet auch die vorherrschenden Marktversagensbedingungen, die die Reform notwendig machten.
- Entwicklung des deutschen Bahnsektors vor der Reform
- Ziele und Stufenkonzept der Bahnreform 1994/1999
- Marktversagen im Schienenverkehrssektor
- Trennung von Fahrweg und Betrieb
- Privatisierungsmöglichkeiten der Eisenbahninfrastruktur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Bahnreform ein und skizziert den schlechten Zustand des Schienenverkehrs vor der Reform, der durch veraltete Infrastruktur und geringe Fahrgastzahlen gekennzeichnet war. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Fragestellungen.
2. Die Entwicklungen des deutschen Bahnsektors vor der Bahnreform 1994: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des deutschen Eisenbahnsektors von den Anfängen bis zur Bahnreform 1994. Es beleuchtet den Zusammenschluss der Ländereisenbahnen zur Reichsbahn, die Herausforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg und die strukturellen Probleme der Deutschen Bundesbahn, die durch die politische Einflussnahme und die fehlende unternehmerische Freiheit geprägt waren. Die anhaltende Abhängigkeit von staatlichen Subventionen und das Bestreben nach einer „besten Verkehrsbedienung“ anstatt wirtschaftlicher Effizienz werden als wesentliche Faktoren für den reformbedürftigen Zustand herausgestellt.
3. Die deutsche Bahnreform 1994/1999: Dieses Kapitel behandelt die Bahnreform selbst, deren Ziele und das implementierte Stufenkonzept. Es analysiert die Bestrebungen zur Entflechtung des staatlichen Einflussbereichs und die Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien im Eisenbahnsektor. Die gesetzlichen Grundlagen und deren Umsetzung werden detailliert betrachtet.
4. Rahmenbedingungen vor der Bahnreform - Marktversagen?: Dieses Kapitel analysiert die Marktversagensbedingungen, die die Bahnreform notwendig machten. Es untersucht Aspekte wie das natürliche Monopol der Eisenbahninfrastruktur, externe Effekte des Schienenverkehrs, die Eigenschaft als öffentliches Gut und die Tendenz zum ruinösen Wettbewerb. Diese Analyse dient als Grundlage für die Rechtfertigung staatlicher Eingriffe im Schienenverkehrssektor.
5. Trennung Fahrweg und Betrieb: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Modelle der Trennung von Fahrweg und Betrieb, angestoßen durch die EG-Richtlinie Nr. 91/440/EWG. Es analysiert die rechnerische, organisatorische und institutionelle Trennung und diskutiert die Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle im Kontext der deutschen Bahnreform.
6. Eigentumsstruktur Eisenbahninfrastrukturunternehmen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Eigentumsstruktur von Eisenbahninfrastrukturunternehmen und vergleicht staatliche und private Bereitstellung der Schieneninfrastruktur. Es analysiert die jeweiligen Vor- und Nachteile beider Modelle hinsichtlich Effizienz, Wettbewerb und gemeinwirtschaftlichen Zielen.
Schlüsselwörter
Deutsche Bahnreform, Spartentrennung, Privatisierung, Marktversagen, Natürliches Monopol, Externe Effekte, Öffentliche Güter, Ruinöser Wettbewerb, Eisenbahninfrastruktur, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Eisenbahntransportunternehmen, EG-Richtlinie 91/440/EWG, Staatliche Regulierung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Deutsche Bahnreform 1994/1999
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die deutsche Bahnreform von 1994/1999, ihre Ursachen und Auswirkungen auf den deutschen Bahnsektor. Der Fokus liegt auf der Analyse der Reformziele, des Stufenkonzepts, der Trennung von Fahrweg und Betrieb sowie der Privatisierungsmöglichkeiten der Eisenbahninfrastruktur und den vorherrschenden Marktversagensbedingungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des deutschen Bahnsektors vor der Reform, die Ziele und das Stufenkonzept der Bahnreform 1994/1999, Marktversagen im Schienenverkehrssektor, die Trennung von Fahrweg und Betrieb sowie die Privatisierungsmöglichkeiten der Eisenbahninfrastruktur.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Entwicklung des deutschen Bahnsektors vor der Reform, die Bahnreform 1994/1999, Rahmenbedingungen vor der Reform (Marktversagen), Trennung von Fahrweg und Betrieb, Eigentumsstruktur der Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Marktversagensbedingungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert das natürliche Monopol der Eisenbahninfrastruktur, externe Effekte des Schienenverkehrs, die Eigenschaft als öffentliches Gut und die Tendenz zum ruinösen Wettbewerb als Marktversagensbedingungen, die die Bahnreform notwendig machten.
Welche Modelle der Trennung von Fahrweg und Betrieb werden untersucht?
Es werden die rechnerische, organisatorische und institutionelle Trennung von Fahrweg und Betrieb untersucht und deren Vor- und Nachteile im Kontext der deutschen Bahnreform diskutiert. Dies wird im Kontext der EG-Richtlinie Nr. 91/440/EWG betrachtet.
Welche Eigentumsstrukturen von Eisenbahninfrastrukturunternehmen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht staatliche und private Bereitstellung der Schieneninfrastruktur und analysiert die jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich Effizienz, Wettbewerb und gemeinwirtschaftlichen Zielen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Bahnreform, Spartentrennung, Privatisierung, Marktversagen, Natürliches Monopol, Externe Effekte, Öffentliche Güter, Ruinöser Wettbewerb, Eisenbahninfrastruktur, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Eisenbahntransportunternehmen, EG-Richtlinie 91/440/EWG, Staatliche Regulierung.
Welche Ziele verfolgt die Bahnreform 1994/1999?
Die Ziele der Bahnreform beinhalten die Entflechtung des staatlichen Einflussbereichs und die Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien im Eisenbahnsektor. Die genauen Ziele werden im Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Wie wird die Entwicklung des deutschen Bahnsektors vor 1994 dargestellt?
Das Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung vom Zusammenschluss der Ländereisenbahnen zur Reichsbahn über die Herausforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu den strukturellen Problemen der Deutschen Bundesbahn, geprägt von politischer Einflussnahme und fehlender unternehmerischer Freiheit. Die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen und das Bestreben nach „bester Verkehrsbedienung“ werden als wesentliche Faktoren für den reformbedürftigen Zustand hervorgehoben.
- Quote paper
- Andreas Ginter (Author), 2005, Die deutsche Bahnreform: Spartentrennung und Privatisierungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48632