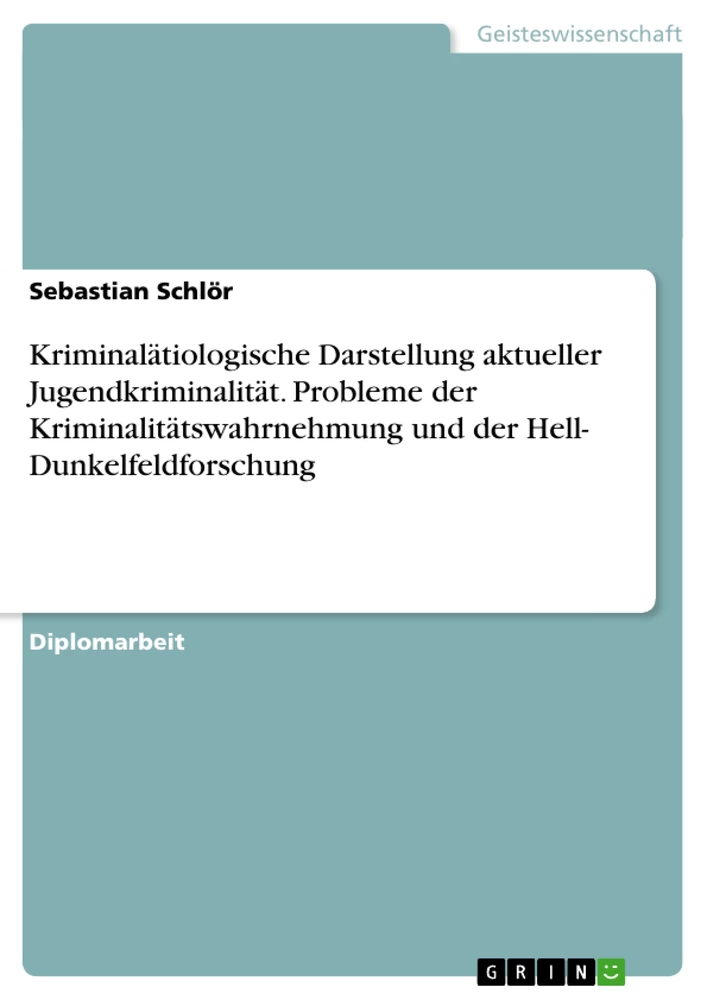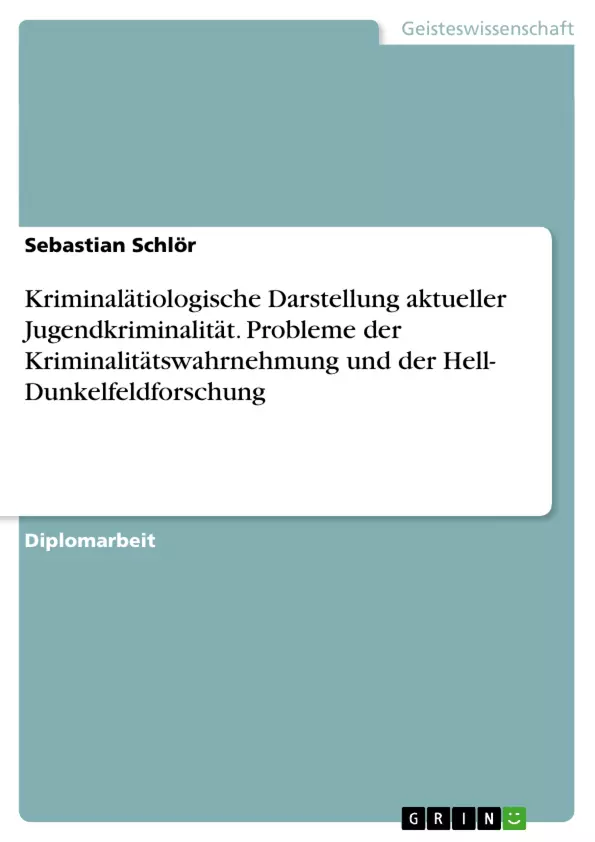Jugendkriminalität wird im öffentlichen Diskurs immer häufiger synonym für Kriminalität im Allgemeinen verwendet. Ständige Schreckensmeldungen über Gewalttaten, zumeist jugendlicher Täter und scheinbar unaufhörlich steigende Kriminalitätsraten in den letzten Jahren, unterstreichen diesen Eindruck. Folgt man diesen Berichten kann leicht der Eindruck entstehen, dass der Anteil derjenigen Jugendlichen, welche Gewalttaten verüben, ständig zunimmt, die Täter parallel immer jünger werden und bei der Tatbegehung eine zunehmende Brutalität an den Tag legen.(vgl. Mansel/Raithel 2003, S. 7)Die anonyme Masse der Jugendlichen verkommt auf diese Weise stillschweigend zu einer Bedrohung für die rechtschaffende Gesellschaft. Die Schuldzuschreibung erfolgt dabei zumeist einseitig durch die Erwachsenen, wobei keine spezifische Gruppe innerhalb des jugendlichen Personenkreises an den Pranger gestellt wird, sondern Pauschalurteile über die scheinbar in zunehmendem Maße immer stärker kriminalisierte Jugend gefällt werden. Eine derartige, zumeist emotional und einseitig geführte, Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Jugendkriminalität ist jedoch nicht neu. In zyklischen Abständen lassen sich wechselnde Gruppen identifizieren, welche in besonderem Maße den gängigen Wert- und Normvorstellungen zuwider handelten. In den 50er Jahren waren die Krawalle der Rocker und Halbstarken ein oft beklagtes Problem, ehe in den 60er Jahren protestierende Studenten, in den 70ern wütende Demonstranten und den 80ern die Hausbesetzer als größte gesellschaftliche Herausforderung erkannt wurden. Gerade in den 90er Jahren rückten dann vermehrt Gewalttaten an Schulen in den Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Aber ist Kriminalität wirklich ein lediglich auf die Jugendphase beschränktes Problem? Allzu oft könnte man diesen Eindruck erhalten, würde man unreflektiert Presse und Medien vertrauen.Zum einen ist Gewaltkriminalität, anders als häufig angenommen, lediglich ein geringer Teil der Jugendkriminalität und weiterhin „...werden die schlimmsten und größten sozialen Schäden nach wie vor von Erwachsenen hervorgerufen“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesellschaftliches Verständnis von Jugend
- 2.1 Wechsel sozialer Bezugsgruppen
- 2.2 Jugendliches Lernen und Sozialisation
- 2.3 Hauptagenturen der Sozialisation
- 3. Definition der Kriminalität durch das Recht
- 3.1 Konsens- und Konflikttheorie
- 3.2 Normgenese
- 3.3 Normimplementation
- 3.4 Registrierungswahrscheinlichkeit und Selektionsprozesse während der Strafverfolgung
- 4. Jugendkriminalität
- 4.1 Phänomenologische Entwicklung der Jugendkriminalität
- 4.2 Aktuelle Jugendkriminalität und Sanktionsentwicklung
- 4.3 Deliktspezifische Unterschiede zwischen Erwachsenen und Jugendlichen
- 4.4 Kriminalätiologie im Jugendalter
- 4.4.1 Soziale Aspekte
- 4.4.1.1 Schichtspezifische Betrachtungen
- 4.4.1.2 Arbeitslosigkeit
- 4.4.1.3 Risikoverhalten/Freizeitgestaltung
- 4.4.1.4 Sekundäre Devianz
- 4.4.2 Kontrollfelder
- 4.4.3 Biologische Faktoren
- 4.4.4 Viktimisierung
- 4.4.4.1 Idealtypus des seelisch gesunden Menschen
- 4.4.4.2 Zusammenhang zwischen Viktimisierung und seelischer Gesundheit
- 4.4.4.3 Der Gewaltkreislauf
- 4.4.4.4 Täter-Opfer Beziehungen
- 4.5 Mehrfachauffälligkeit und Karriereforschung
- 4.5.1 Modelle und Theorien
- 4.5.2 Selective incapacitation
- 4.5.3 Vorhersagbarkeit von Straftatentwicklungen
- 5. Soziale Einflussgrößen kriminellen Verhaltens
- 5.1 Die Familie
- 5.2 Die Gleichaltrigengruppe/Peer Group
- 5.3 Die Schule
- 5.4 Empirisch kriminologische Theorien
- 5.4.1 Der Lerntheoretische Ansatz
- 5.4.2 Die Kontrolltheorie
- 5.4.3 Der ökonomische Ansatz
- 5.4.4 Neutralisierungstechniken
- 5.4.5 Tatgelegenheit als Prädiktor devianten Verhaltens
- 6. Kriminalitätsausformungen
- 6.1 Jugendgewalt
- 6.1.1 Differenz zwischen Jugendgewalt und Jugendkriminalität
- 6.1.2 Genese gewalttätigen Verhaltens
- 6.1.2.1 Männlichkeitsideale
- 6.1.2.2 Familiäre Situation
- 6.1.2.3 Rolle der Schule
- 6.1.2.4 Peer Group
- 6.1.3 Motive für die Gewaltanwendung
- 6.1.4 Mädchengewalt/Geschlechteraspekt
- 6.2 Diebstahlkriminalität
- 6.2.1 Tataufklärung
- 6.2.2 Tatbegehungskriterien
- 6.3 Rechtsextremistisch motivierte Kriminalität
- 6.3.1 Charakteristika rechtsextremen Handelns
- 6.3.2 Motive
- 6.3.3 Identifizierung und Registrierung rechtsextremer Gewalt
- 6.4 Illegaler Drogenumgang
- 6.4.1 Tradierte Erfahrungen und Mythen
- 6.4.2 Beschaffungskriminalität
- 6.4.3 Kriminalität als logische Konsequenz des Drogenkonsums?
- 6.5 Kriminalität junger Migranten
- 6.5.1 Lebensumstände und sozialer Backround
- 6.5.2 Justiziare Kontrollintensität und Straftatbelastung
- 7. Diskrepanzen und Konflikte in der Darstellung tatsächlicher Kriminalität
- 7.1 Das Hellfeld
- 7.1.1 Die Polizeiliche Kriminalstatistik
- 7.1.2 Grenzen der Hellfelddarstellung
- 7.2 Das Dunkelfeld
- 7.3 Diskrepanzen zwischen Hell- und Dunkelfeld
- 7.4 Differenzen zwischen Stadt und Land in der Kriminalitätsbelastung
- 7.4.1 informelle Streitbeilegung
- 7.4.2 Pendlerwesen
- 7.4.3 Theoretische Erklärungsversuche der Stadt - Land Unterschiede
- 7.5 Medial erzeugte Kriminalitätswahrnehmung
- 7.5.1 Trends und Agenda Setting in den Medien
- 7.5.2 Kriminalitätsfurcht
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Sebastian Schlör befasst sich mit dem Phänomen der Jugendkriminalität und analysiert die damit verbundenen Probleme der Kriminalitätswahrnehmung sowie der Hell- und Dunkelfeldforschung. Ziel ist es, einen umfassenden Einblick in die ätiologischen Aspekte der Jugendkriminalität zu geben und die komplexen Wechselwirkungen zwischen individuellen und gesellschaftlichen Faktoren zu beleuchten.
- Entwicklung und Erscheinungsformen von Jugendkriminalität
- Kriminalätiologische Faktoren im Jugendalter
- Soziale Einflussgrößen kriminellen Verhaltens
- Diskrepanzen zwischen Hell- und Dunkelfeldforschung
- Medial erzeugte Kriminalitätswahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Relevanz des Themas erläutert. Im zweiten Kapitel wird das gesellschaftliche Verständnis von Jugend beleuchtet, wobei die Wechselwirkung sozialer Bezugsgruppen, jugendliches Lernen und Sozialisation sowie die Hauptagenturen der Sozialisation im Fokus stehen. Kapitel drei widmet sich der Definition von Kriminalität durch das Recht, wobei Konsens- und Konflikttheorie, Normgenese und -implementation sowie die Registrierungswahrscheinlichkeit im Strafprozess beleuchtet werden.
Kapitel vier befasst sich mit dem Kern des Themas: Jugendkriminalität. Die phänomenologische Entwicklung und die aktuelle Situation der Jugendkriminalität sowie die Deliktspezifika im Vergleich zu Erwachsenen werden dargestellt. Hier werden auch kriminalätiologische Faktoren wie soziale Aspekte (Schichten, Arbeitslosigkeit, Risikoverhalten), Kontrollfelder, biologische Faktoren und Viktimisierung analysiert.
Kapitel fünf behandelt soziale Einflussgrößen kriminellen Verhaltens, wobei die Rolle der Familie, der Peer Group und der Schule betrachtet wird. In diesem Zusammenhang werden auch empirisch kriminologische Theorien wie der Lerntheoretische Ansatz, die Kontrolltheorie, der ökonomische Ansatz und die Neutralisierungstechniken besprochen.
Kapitel sechs widmet sich verschiedenen Ausformungen von Jugendkriminalität, darunter Jugendgewalt, Diebstahlkriminalität, rechtsextremistisch motivierte Kriminalität, illegaler Drogenumgang und Kriminalität junger Migranten. Die Kapitel sieben untersucht die Diskrepanzen zwischen Hell- und Dunkelfeldforschung, wobei die Grenzen der Polizeilichen Kriminalstatistik, die Problematik des Dunkelfeldes und die medial erzeugte Kriminalitätswahrnehmung beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Kriminalätiologie, Hellfeld, Dunkelfeld, Kriminalitätswahrnehmung, Soziale Einflussgrößen, Jugendgewalt, Diebstahlkriminalität, Rechtsextremismus, Drogenkriminalität, Migrantenkriminalität, Viktimisierung, Sozialisation, Strafverfolgung, Empirische Kriminalitätsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Hellfeld und Dunkelfeld in der Kriminologie?
Das Hellfeld umfasst alle offiziell registrierten Straftaten (z. B. in der Polizeistatistik), während das Dunkelfeld die tatsächlich begangene, aber nicht gemeldete Kriminalität bezeichnet.
Welche sozialen Faktoren beeinflussen Jugendkriminalität?
Einflussgrößen sind unter anderem die familiäre Situation, Arbeitslosigkeit, Schichtzugehörigkeit, die Schule und die Peer Group (Gleichaltrigengruppe).
Wie beeinflussen Medien die Wahrnehmung von Jugendkriminalität?
Medien erzeugen oft durch "Agenda Setting" und Schreckensmeldungen den Eindruck einer ständig steigenden Brutalität, was zur Kriminalitätsfurcht in der Gesellschaft beiträgt.
Was versteht man unter dem "Gewaltkreislauf"?
Der Begriff beschreibt den Zusammenhang zwischen eigener Viktimisierung (Opfer-Erfahrung) und späterem eigenen gewalttätigen Handeln als Täter.
Ist Gewaltkriminalität der größte Teil der Jugendkriminalität?
Nein, Gewaltkriminalität macht nur einen geringen Teil aus; die meisten sozialen Schäden werden nach wie vor von Erwachsenen verursacht.
- Quote paper
- Sebastian Schlör (Author), 2005, Kriminalätiologische Darstellung aktueller Jugendkriminalität. Probleme der Kriminalitätswahrnehmung und der Hell- Dunkelfeldforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48468