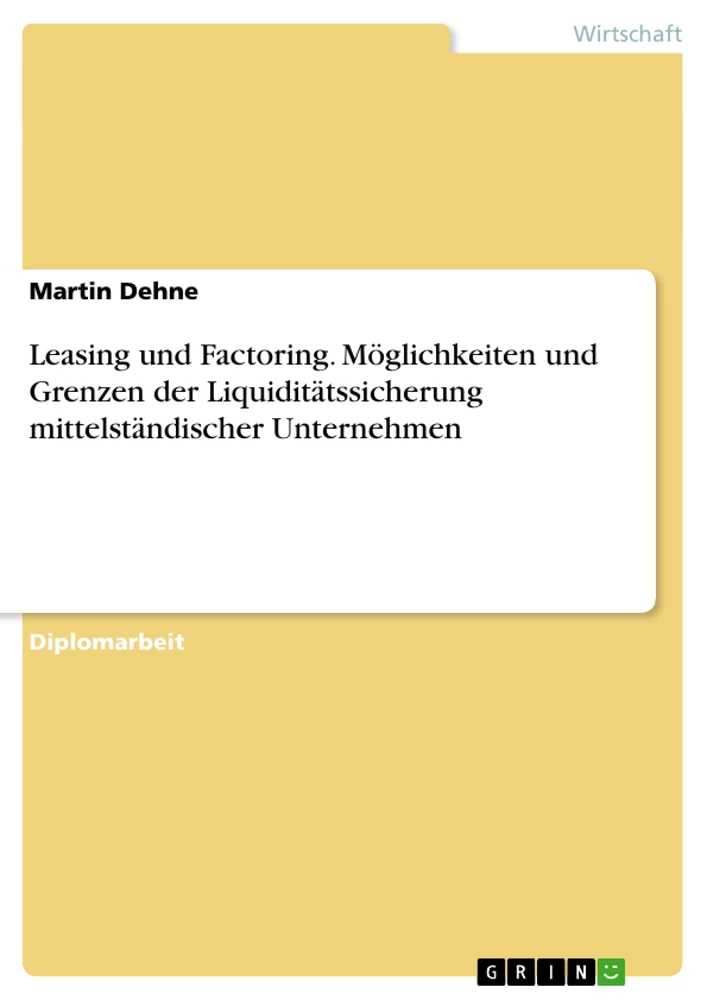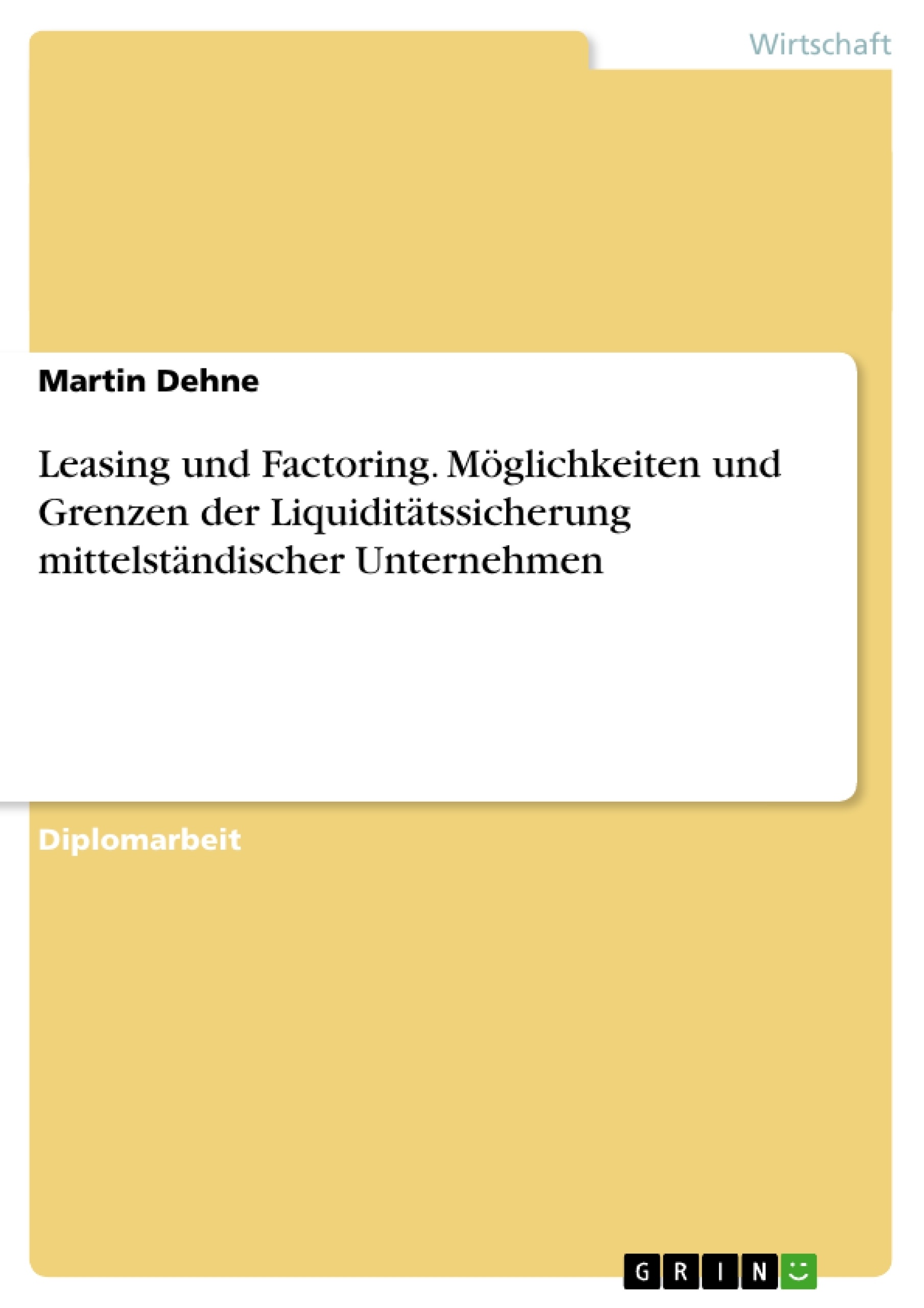Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland hat, vor allem in mittelständischen Unternehmen, in den letzten Jahren stetig zugenommen. Viele dieser Unternehmen fielen allerdings weniger einer schlechten Auftragslage oder mangelnder Nachfrage zum Opfer, sondern scheiterten, weil die Liquidität ihrer Unternehmung durch herkömmliche Finanzierungswege nicht sicherzustellen war.
Forderungsausfälle zwischen einem und zehn Prozent des Umsatzes und eine sich stets verschlechternde Zahlungsmoral gehören zu den Hauptproblemen des Mittelstandes in Deutschland. Dadurch wird die Liquidität dieser Unternehmen stark belastet. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie Existenzgründern, die nur geringe Umsatzrenditen haben, können Forderungsausfälle nur durch hohe Umsatzsteigerungen wieder ausgeglichen werden.
Die schlechte Zahlungsmoral der Debitoren führt oftmals zu der Ausnutzung von Lieferantenkrediten, zum Teil auch über deren Zahlungsziel hinaus, wonach auch dieser sich wiederum über eine schlechte Zahlungsmoral beklagt. Die Zahlungsunfähigkeit, entstanden durch mangelnde Liquidität, wird also wie in einer Kette, von einem Unternehmen zum nächsten Unternehmen weitergereicht.
Auf der anderen Seite muss eine Unternehmung, um immer auf dem neusten Stand der Technik zu sein und dadurch innovative Produkte anbieten zu können, in regelmäßigen Abständen auch Investitionen tätigen, die dieses gewährleisten. Diese Investitionen müssen wiederum finanziert werden und belasten die häufig ohnehin niedrige Liquiditätsdecke der Unternehmen.
Im Folgenden soll nun betrachtet werden, inwiefern sich die Leasingfinanzierung oder ein Forderungsverkauf durch Factoring positiv auf die Liquiditätssicherung der mittelständischen Unternehmen auswirkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitorische Abgrenzungen
- Der Mittelstand
- Quantitative Abgrenzung
- Qualitative Abgrenzung
- Die aktuellen Finanzierungsstrukturen im Mittelstand
- Rating und Basel II
- Liquiditätssicherung
- Liquidität
- Formen der Liquiditätssicherung
- Leasing
- Arten des Leasings
- Operate Leasing
- Finance Leasing
- Verschiede Arten des Leasingvertrages beim
- Vor- und Nachteile des Leasings
- Factoring
- Vorgehensweise beim Factoring
- Verschiedene Arten des Factorings
- Kosten des Factorings
- Vor- und Nachteile des Factorings
- Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen durch Leasing
- Möglichkeiten der Liquiditätssicherung durch Leasing
- Liquiditätsvergleichsrechung zwischen Kauf, Kreditkauf und Leasing
- Vergleichszeitraum
- Ausgaben bei der Leasingfinanzierung
- Ausgaben beim kreditfinanzierten Kauf
- Steuerliche Be- und Entlastungsvergleich bei Leasingfinanzierung und Kreditkauf
- Liquiditätsvergleichsrechung
- Auswertung der Vergleichsrechnung
- Sofortige Steigerung der Liquidität durch Sale-and-lease-back
- Liquiditätssicherung als Lieferant des Leasingobjektes
- Grenzen der Liquiditätssicherung durch Leasing
- Grenzen der Liquiditätssicherung durch Leasing bei Investitionen
- Grenzen des Sale-and-lease-back-Leasings zur Liquiditätssicherung
- Grenzen der Liquiditätssicherung als Lieferant des Leasingobjektes
- Allgemeine Grenzen des Leasings – Ablehnung der Leasinggesellschaft nach Bonitätsprüfung
- Kritische Betrachtung des Leasings als Instrument zur Liquiditätssicherung für mittelständische Unternehmen
- Erreichung der finanzwirtschaftlichen Ziele mittelständischer Betriebe durch Leasing
- Entscheidung gegen Leasing
- Fazit zur Liquiditätssicherung durch Leasing für mittelständische Unternehmen
- Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen durch Factoring
- Möglichkeiten der Liquiditätssicherung durch Factoring
- Kosten/Nutzen-Rechnung
- Bilanzvergleich zur Auswirkung auf die Liquidität eines Factoringkunden vor und nach dem Factoring
- Tilgung von Bankverbindlichkeiten durch Liquiditätssteigerung
- Grenzen der Liquiditätssicherung durch Factoring
- Cash Flow und Free Cash Flow Analyse zur Ermittlung der freien Liquidität
- Allgemeine Grenzen des Factorings
- Kritische Betrachtung des Factorings als Instrument zur Liquiditätssicherung für mittelständische Unternehmen
- Eignung des Factorings bezogen auf die Branche und Größe der Unternehmung
- Entwicklung des Factorings als Finanzierungsinstrument für den Mittelstand
- Fazit zur Liquiditätssicherung durch Factoring für mittelständische Unternehmen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen durch Leasing und Factoring. Ziel ist es, die Eignung beider Finanzierungsinstrumente für den Mittelstand zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Liquidität zu bewerten.
- Definition und Abgrenzung des Mittelstandes
- Analyse der Liquiditätssicherung im Mittelstand
- Bewertung der Möglichkeiten von Leasing zur Liquiditätssicherung
- Bewertung der Möglichkeiten von Factoring zur Liquiditätssicherung
- Vergleich und Gegenüberstellung von Leasing und Factoring
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die zunehmende Zahl von Insolvenzen im deutschen Mittelstand, oft verursacht durch Liquiditätsprobleme. Sie fokussiert auf Leasing und Factoring als alternative Liquiditätssicherungsmaßnahmen und deren Eignung für mittelständische Unternehmen. Die schlechten Zahlungsmoralen und der Bedarf an Investitionen werden als zentrale Herausforderungen benannt.
Definitorische Abgrenzungen: Dieses Kapitel klärt den Begriff "Mittelstand". Es werden quantitative und qualitative Abgrenzungsmerkmale anhand von Kriterien wie Mitarbeiterzahl und Umsatz erläutert. Verschiedene Definitionen und Richtlinien verschiedener Institutionen werden verglichen und dargestellt. Die Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition des Mittelstandes und deren Implikationen für die Studie.
Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen durch Leasing: Dieses Kapitel analysiert Leasing als Instrument zur Liquiditätssicherung. Es werden verschiedene Leasingarten (z.B. Operate und Finance Leasing) verglichen, sowie deren Vor- und Nachteile diskutiert. Ein detaillierter Liquiditätsvergleich zwischen Kauf, Kreditkauf und Leasing wird durchgeführt, der steuerliche Aspekte berücksichtigt. Der Sale-and-lease-back wird ebenfalls als Möglichkeit zur schnellen Liquiditätssteigerung vorgestellt. Schließlich werden die Grenzen des Leasings, insbesondere im Hinblick auf Investitionen und die Bonitätsprüfung der Leasinggesellschaft, beleuchtet.
Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen durch Factoring: Das Kapitel befasst sich mit Factoring als Methode zur Liquiditätssicherung. Es beschreibt verschiedene Factoring-Arten und deren Kosten. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung wird durchgeführt und die Auswirkungen auf die Bilanz analysiert. Zusätzlich werden die Grenzen des Factorings, beispielsweise hinsichtlich des Cashflows und der branchenspezifischen Eignung, detailliert untersucht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen durch Leasing und Factoring
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen durch Leasing und Factoring. Ziel ist die Analyse der Eignung beider Finanzierungsinstrumente für den Mittelstand und die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Liquidität.
Wie wird der Mittelstand in dieser Arbeit definiert?
Das Kapitel "Definitorische Abgrenzungen" klärt den Begriff "Mittelstand". Es werden quantitative und qualitative Abgrenzungsmerkmale anhand von Kriterien wie Mitarbeiterzahl und Umsatz erläutert. Verschiedene Definitionen und Richtlinien verschiedener Institutionen werden verglichen und die Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition und deren Implikationen für die Studie beleuchtet.
Welche Finanzierungsinstrumente werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert Leasing und Factoring als alternative Liquiditätssicherungsmaßnahmen. Für Leasing werden verschiedene Arten (Operate und Finance Leasing, Sale-and-lease-back) verglichen und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Beim Factoring werden verschiedene Arten, Kosten und die Auswirkungen auf die Bilanz untersucht.
Wie wird die Eignung von Leasing zur Liquiditätssicherung bewertet?
Die Eignung von Leasing wird anhand eines detaillierten Liquiditätsvergleichs zwischen Kauf, Kreditkauf und Leasing bewertet. Der Vergleich berücksichtigt steuerliche Aspekte und untersucht die sofortige Liquiditätssteigerung durch Sale-and-lease-back. Die Grenzen des Leasings, insbesondere bei Investitionen und der Bonitätsprüfung, werden ebenfalls beleuchtet.
Wie wird die Eignung von Factoring zur Liquiditätssicherung bewertet?
Die Eignung von Factoring wird durch eine Kosten-Nutzen-Rechnung und eine Bilanzanalyse bewertet. Die Auswirkungen auf den Cashflow werden untersucht, und die Grenzen des Factorings bezüglich des Cashflows und der branchenspezifischen Eignung werden detailliert analysiert.
Welche Aspekte werden im Liquiditätsvergleich zwischen Kauf, Kreditkauf und Leasing berücksichtigt?
Der Liquiditätsvergleich umfasst Ausgaben bei der Leasingfinanzierung und beim kreditfinanzierten Kauf sowie einen steuerlichen Be- und Entlastungsvergleich. Der Vergleichszeitraum wird explizit definiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu definitorischen Abgrenzungen, Kapitel zu den Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung durch Leasing und Factoring, sowie eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte, wie im Inhaltsverzeichnis ersichtlich.
Welche konkreten Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Eignung von Leasing und Factoring für die Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Liquidität zu bewerten. Dies beinhaltet die Definition und Abgrenzung des Mittelstandes, die Analyse der Liquiditätssicherung im Mittelstand und den Vergleich von Leasing und Factoring.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und bewerten die Eignung von Leasing und Factoring als Instrumente zur Liquiditätssicherung für mittelständische Unternehmen unter Berücksichtigung der jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen. Es wird ein Fazit zu beiden Finanzierungsinstrumenten gezogen.
Welche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen werden angesprochen?
Die Arbeit hebt die zunehmende Zahl von Insolvenzen im deutschen Mittelstand hervor, die oft durch Liquiditätsprobleme verursacht werden. Schlechte Zahlungsmoralen und der Bedarf an Investitionen werden als zentrale Herausforderungen benannt.
- Quote paper
- Martin Dehne (Author), 2005, Leasing und Factoring. Möglichkeiten und Grenzen der Liquiditätssicherung mittelständischer Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48387