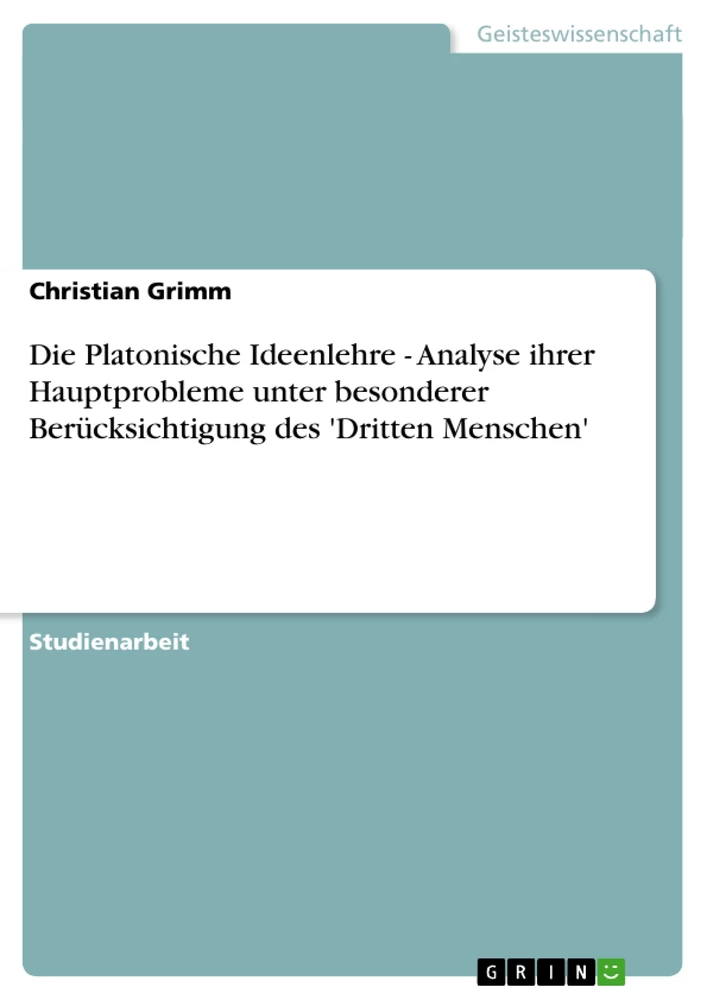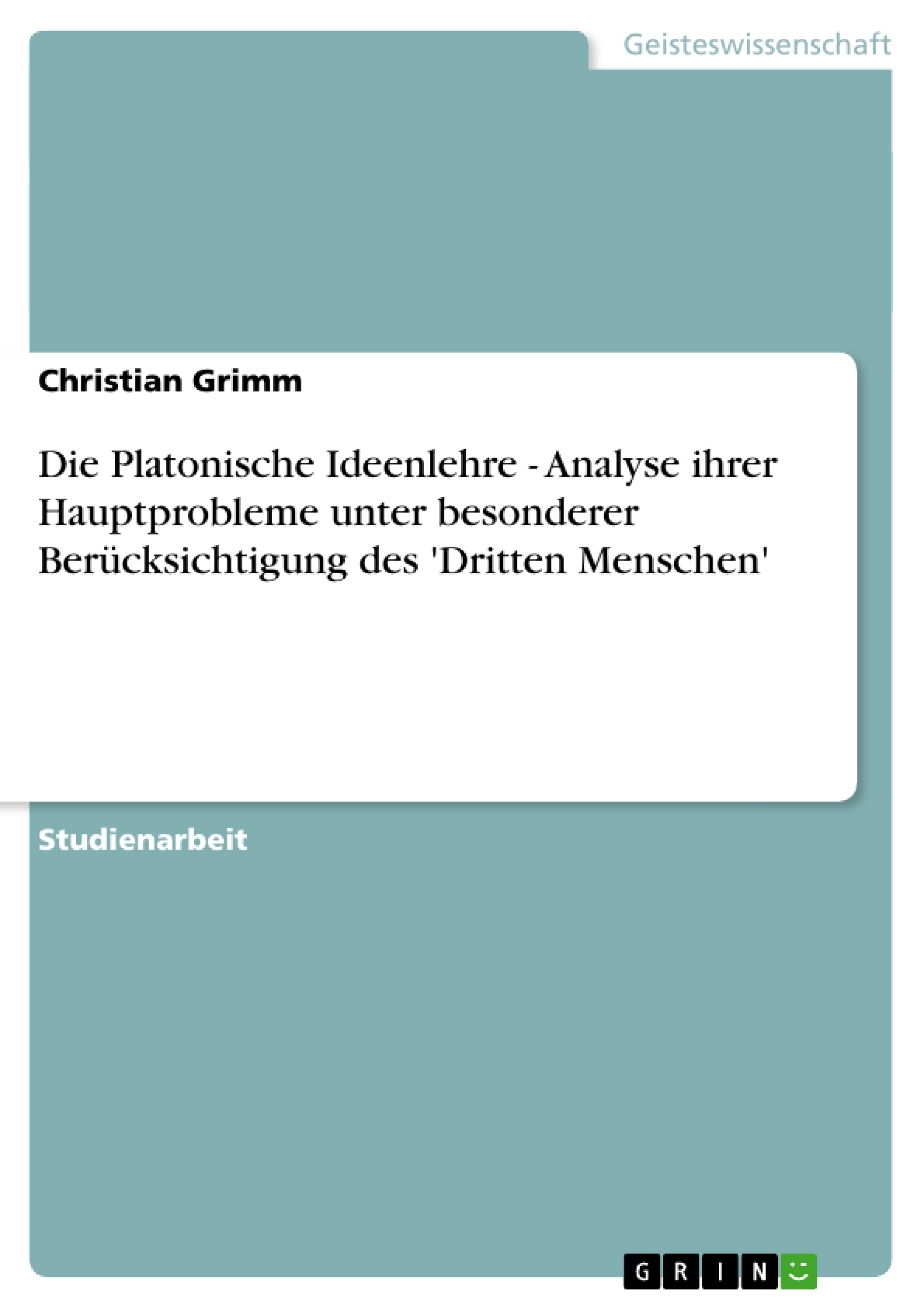"The safest generalization that can be made about the history of western philosophy is that it is all a series of footnotes to Plato." Dieser Satz von Whitehead ist weithin bekannt und in der Tat, von Aristoteles bis Cicero, von Plotin bis Augustinus, von Machiavelli bis Nietzsche, von Popper bis Gadamer, kaum ein westlicher Philosoph, der nicht auf Platon bezug nähme. Im Zentrum von Rezeption und Diskussion stehen v.a. der „ideale Staat“ wie er in der Politea entwickelt wird und das Konzept der Ideen selbst, die „Ideenlehre“ als Kern der platonischen Philosophie.
Nach Aristoteles war es v.a. Heraklits Auffassung, dass alles in der Welt der Erscheinungen im Fluss sei, die Platon und später auch seine Anhänger nachhaltig prägte und zum Konzept der Ideen führte. Aristoteles Darstellung wird zwar kontrovers diskutiert, unbestreitbar scheint jedoch, was auch immer Platon zur Annahme der Ideen letztlich veranlasst haben mag, die Vorstellung einer veränderlichen Welt im Fluss ohne irgendetwas Beständiges, Ewiges, Unveränderliches, ist nicht spurlos an ihm vorrübergegangen. Im Dialog Kratylos etwa lässt er Sokrates sagen: „Ja es ist nicht einmal möglich zu sagen, dass es eine Erkenntnis gebe, wenn alle Dinge sich verwandeln und nichts bleibt…und von diesem Satze aus gibt es weder ein Erkennendes noch ein zu Erkennendes. Ist aber immer das Erkennende und das Erkannte, ist das Schöne, ist das Gute, ist jegliches Seiende, so scheint mir dies, wie wir es jetzt sagen, gar nicht mehr einem Fluss ähnlich oder einer Bewegung. Ob nun dieses sich so verhält oder vielmehr so, wie Herakleitos mit den Seinigen und noch viele andere behaupten, das mag wohl gar nicht leicht sein, zu untersuchen.“
Mit der Annahme von ewigen und unveränderlichen Ideen hinter den Erscheinungen suchte Platon einen Ausgleich zu schaffen, einen Ausgleich zwischen Heraklit und Parmenides. Die platonische Welt der Erscheinungen, in der sich alles in Veränderung befindet, wird von Heraklit bestimmt. Das feste Sein, an das Parmenides geglaubt hatte ("Mir ist das Sein das allen (Seienden) Gemeinsame. Von wo ich auch beginne, immer wieder komme ich darauf zurück."), findet dagegen Eingang in die Ideenlehre.
Eine solche Hypothese wie die „Ideenlehre“ birgt in sich zwangsläufig eine Reihe von Problemen. Die wichtigsten dieser Probleme zu benennen und zu diskutieren, ist Ziel dieser Arbeit. Dabei soll insbesondere das Problem des ‚Dritten Menschen’ näher untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Ideen und Erscheinungen
- 2.1.1. Aristoteles und das „Chorismos-Problem“
- 2.1.2. Parmenides und der „Dritte Mensch“
- 2.1.3. Timaios und die „Chôra“
- 2.2. Die Idee des Guten und die Hierarchie der Ideen
- 2.1. Ideen und Erscheinungen
- 3. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hauptprobleme der platonischen Ideenlehre, insbesondere das Problem des „Dritten Menschen“. Die Zielsetzung besteht darin, diese Probleme zu benennen und zu diskutieren, um ein umfassenderes Verständnis der platonischen Philosophie zu ermöglichen.
- Das Verhältnis zwischen Ideen und Erscheinungen
- Das „Chorismos-Problem“ nach Aristoteles
- Die Rolle von Parmenides und Heraklit in der Entwicklung der Ideenlehre
- Die Bedeutung der Idee des Guten
- Die Problematik des „Dritten Menschen“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der platonischen Ideenlehre ein und betont die weitreichende Bedeutung Platons für die Geschichte der westlichen Philosophie. Sie skizziert die Kontroverse um die Entstehung der Ideenlehre und verweist auf die unterschiedlichen Interpretationen, insbesondere die Rolle von Heraklit und Parmenides. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse der Hauptprobleme der Ideenlehre, wobei das Problem des „Dritten Menschen“ im Zentrum steht.
2. Hauptteil: Der Hauptteil befasst sich eingehend mit dem Verhältnis zwischen Ideen und Erscheinungen. Er analysiert das zentrale Problem der Teilhabe der Erscheinungen an den Ideen und stellt die Kritik des Aristoteles mit dem „Chorismos-Problem“ dar. Dieses Kapitel diskutiert Platons Begriffe von Méthexis, Parousia und Koinônía und hinterfragt ihre mögliche Interpretation als Metaphern. Die unterschiedlichen Perspektiven auf Platons Position und die damit verbundenen Interpretationsschwierigkeiten werden ausführlich erörtert. Der Abschnitt vertieft sich in die philosophischen Auseinandersetzungen und die daraus resultierenden komplexen Fragen der platonischen Ontologie.
Schlüsselwörter
Platonische Ideenlehre, Chorismos-Problem, Dritter Mensch, Ideen und Erscheinungen, Teilhabe, Heraklit, Parmenides, Aristoteles, Idee des Guten, Metaphysik.
Häufig gestellte Fragen zur Platonischen Ideenlehre
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zur Platonischen Ideenlehre?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über die Platonische Ideenlehre. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Hauptprobleme der Ideenlehre, insbesondere dem "Dritten Menschen"-Problem.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Platonischen Ideenlehre, darunter das Verhältnis zwischen Ideen und Erscheinungen, das "Chorismos-Problem" nach Aristoteles, die Rolle von Parmenides und Heraklit, die Bedeutung der Idee des Guten und die Problematik des "Dritten Menschen". Es werden Platons Begriffe Méthexis, Parousia und Koinônía diskutiert und kritisch hinterfragt.
Welche Probleme der Platonischen Ideenlehre werden untersucht?
Die Arbeit untersucht hauptsächlich das "Dritte-Mensch-Problem" und das "Chorismos-Problem" (Trennungsproblem) nach Aristoteles. Sie analysiert die Schwierigkeiten, die sich aus der Beziehung zwischen Ideen und Erscheinungen ergeben, und die unterschiedlichen Interpretationen dieser Beziehung.
Welche Philosophen werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt wichtige Philosophen wie Platon, Aristoteles, Parmenides und Heraklit. Ihre Beiträge und Perspektiven zur Ideenlehre werden analysiert und diskutiert, um ein umfassenderes Verständnis der platonischen Philosophie zu ermöglichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Diskussion. Der Hauptteil unterteilt sich weiter in Abschnitte, die sich mit Ideen und Erscheinungen, dem "Chorismos-Problem", und der Idee des Guten befassen. Die Einleitung gibt einen Überblick und die Diskussion fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Platonische Ideenlehre, Chorismos-Problem, Dritter Mensch, Ideen und Erscheinungen, Teilhabe (Méthexis), Parousia, Koinônía, Heraklit, Parmenides, Aristoteles, Idee des Guten und Metaphysik.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Hauptprobleme der platonischen Ideenlehre zu benennen und zu diskutieren, um ein umfassenderes Verständnis der platonischen Philosophie zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf der Klärung der komplexen Beziehungen zwischen Ideen und Erscheinungen und der Analyse der damit verbundenen philosophischen Probleme.
- Quote paper
- Dr.rer.nat., M.A., PhD Christian Grimm (Author), 2005, Die Platonische Ideenlehre - Analyse ihrer Hauptprobleme unter besonderer Berücksichtigung des 'Dritten Menschen', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48324