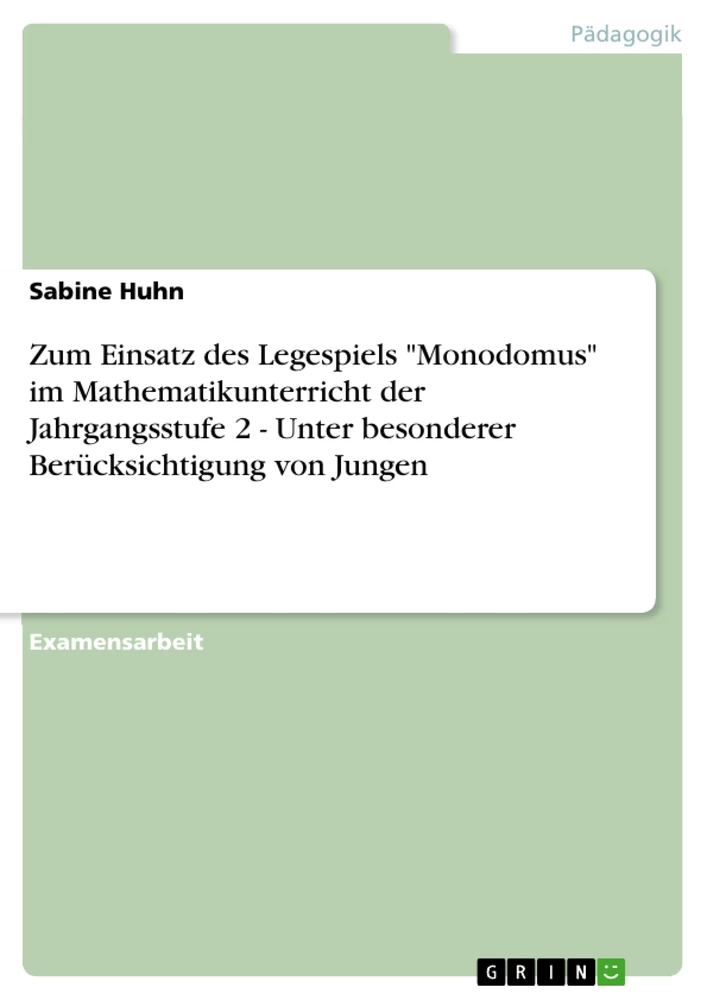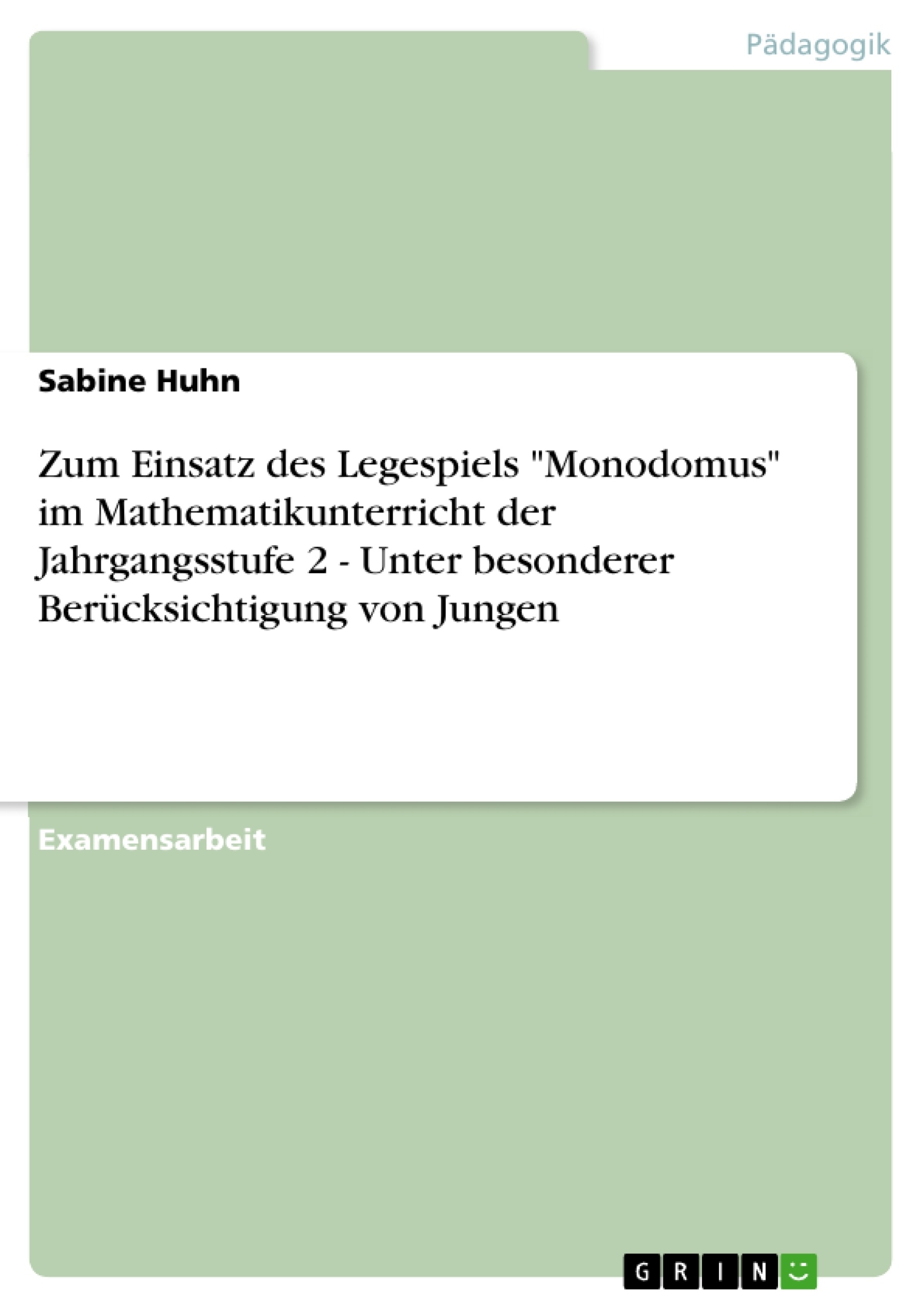Im neuen bayerischen Lehrplan für die Grundschulen, der seit dem Schuljahr 2001/2002 verbindlich eingeführt wurde, erhält der Geometrieunterricht eine ganz neue Gewichtung und ist endlich aus seinem „Aschenputteldasein“ geführt worden.
Im Rahmen meiner Zulassungsarbeit möchte ich mich daher eingehend mit Geometrieunterricht in der Grundschule beschäftigen. Im theoretischen Teil soll zunächst in einem historischen Rückblick, insbesondere den Entwicklungslinien im Mathematikunterricht ab 1945 nachgegangen werden. Neuere Tendenzen, die vor allem unter dem Schlagwort „Veränderte Kindheit“ publik geworden sind und die Stellung des Lernbereichs „Geometrie“ im neuen bayerischen Grundschullehrplan werden dann dargestellt. Im Folgenden sollen lern- und entwicklungspsychologische Hintergründe, sowie Ziele und Aufgaben des Geometrieunterrichts in der Grundschule hinterleuchtet werden. Ein kleiner Exkurs zum Thema Spielen und Legespiele soll auf die Arbeit mit dem Legespiel MONODOMUS hinführen. Nach den theoretischen Überlegungen werden die einzelnen Seiten des Arbeitsheftes MONODOMUS (2. Klasse: S.14-33) in Form eines Lehrerbandes besprochen. Das Legespiel MONODOMUS wurde in drei 2. Klassen jeweils an zwei Schulvormittagen erprobt. In einer geschlechterspezifischen Auswertung, sollen die speziellen Beobachtungen, Fähigkeiten und Defizite in Zusammenhang mit dem Legespiel bei Jungen diskutiert werden. Eine abschließende Evaluation soll die empirische Untersuchung kritisch beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte des Mathematikunterrichts
- 2.1 Historischer Rückblick
- 2.1.1 „Traditionelle Rechendidaktik“
- 2.1.2 „Neue Mathematik“
- 2.1.3 Weiterentwicklung in der Mathematikdidaktik
- 2.2 Jüngere Entwicklungen
- 2.2.1 „Veränderte Kindheit“
- 2.2.2 Der neue bayerische Lehrplan für die Grundschule
- 3. Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Psychologische Grundlagen des Mathematikunterrichts nach Jean Piaget
- 3.1.1 Stufen der Denkentwicklung
- 3.1.2 Bedeutung des Stufenmodells für den Geometrieunterricht
- 3.1.3 Kritik an Piagets Stufenmodell
- 3.2 Das van-Hiele-Model
- 3.3 Bedeutung der Geometrie in der Grundschule
- 3.4 Prinzipien und Ziele zur Gestaltung des Geometrieunterrichts
- 3.5 Räumliches Vorstellungsvermögen
- 3.6 Spiele im Geometrieunterricht
- 3.6.1 Spielen und Lernen
- 3.6.2 Legespiele
- 4. Das Legespiel MONODOMUS
- 4.1 Zum Einsatz des Legespiels MONODOMUS in der Grundschule
- 4.2 Beschreibung der Legeteile
- 4.3 Regeln und Schwierigkeiten beim Arbeiten mit MONODOMUS
- 4.4 Anleitung zur Herstellung von MONODOMUS
- 4.5 Hinweise und Lösungen zu den Aufgaben im Schülerarbeitsheft (S. 14-34)
- 4.6 Hinweise und Lösungen zu den Kopiervorlagen (K1-K8)
- 5. Empirische Untersuchung
- 5.1 Bedingungsanalyse
- 5.2 Anlage und Ziele der empirischen Untersuchung
- 5.3 Hypothesen und Erwartungshaltungen
- 5.4 Durchführung der Untersuchung
- 5.5 Auswertung der Schülerarbeiten
- 5.5.1 Bearbeitung der Arbeitsblätter durch Jungen
- 5.5.2 Allgemeine Beobachtungen
- 5.6 Evaluation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Einsatz des Legespiels MONODOMUS im Mathematikunterricht der Jahrgangsstufe 2, insbesondere unter Berücksichtigung von Jungen. Sie untersucht die Bedeutung von Geometrie in der Grundschule, beleuchtet die Entwicklung des Mathematikunterrichts seit 1945, analysiert lernpsychologische Grundlagen und befasst sich mit den Zielen und Aufgaben des Geometrieunterrichts. Die Arbeit soll Einblicke in den praktischen Einsatz von MONODOMUS im Unterricht geben und die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung präsentieren, die die Arbeit mit dem Legespiel an Jungen in der 2. Klasse analysiert.
- Bedeutung des Geometrieunterrichts in der Grundschule
- Entwicklung des Mathematikunterrichts seit 1945
- Lernpsychologische Grundlagen des Geometrieunterrichts
- Ziele und Aufgaben des Geometrieunterrichts
- Einsatz und Analyse des Legespiels MONODOMUS im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung des Geometrieunterrichts in der Grundschule. Kapitel 2 bietet einen historischen Rückblick auf die Entwicklung des Mathematikunterrichts, beleuchtet die „traditionelle Rechendidaktik“, die „neue Mathematik“ und die Weiterentwicklungen in der Mathematikdidaktik. In diesem Kapitel werden auch jüngere Entwicklungen wie die „veränderte Kindheit“ und der neue bayerische Lehrplan für die Grundschule vorgestellt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Arbeit, insbesondere mit den psychologischen Grundlagen des Mathematikunterrichts nach Jean Piaget, dem van-Hiele-Model, der Bedeutung der Geometrie in der Grundschule, den Prinzipien und Zielen zur Gestaltung des Geometrieunterrichts, dem räumlichen Vorstellungsvermögen und der Rolle von Spielen im Geometrieunterricht.
Kapitel 4 konzentriert sich auf das Legespiel MONODOMUS. Es beschreibt die Legeteile, die Regeln und Schwierigkeiten beim Arbeiten mit dem Spiel, gibt eine Anleitung zur Herstellung des Spiels und präsentiert Hinweise und Lösungen zu den Aufgaben im Schülerarbeitsheft und den Kopiervorlagen.
Kapitel 5 beschreibt die empirische Untersuchung, die die Anwendung von MONODOMUS in drei 2. Klassen analysiert. Es werden die Bedingungen der Untersuchung, die Anlage und Ziele, Hypothesen und Erwartungshaltungen, die Durchführung der Untersuchung, die Auswertung der Schülerarbeiten und die Evaluation der Ergebnisse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Geometrieunterricht, Grundschule, Legespiel, MONODOMUS, Mathematikdidaktik, Jean Piaget, van-Hiele-Model, räumliches Vorstellungsvermögen, Spiel, empirische Untersuchung, Jungen, Entwicklung des Mathematikunterrichts.
- Citar trabajo
- Sabine Huhn (Autor), 2002, Zum Einsatz des Legespiels "Monodomus" im Mathematikunterricht der Jahrgangsstufe 2 - Unter besonderer Berücksichtigung von Jungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48287