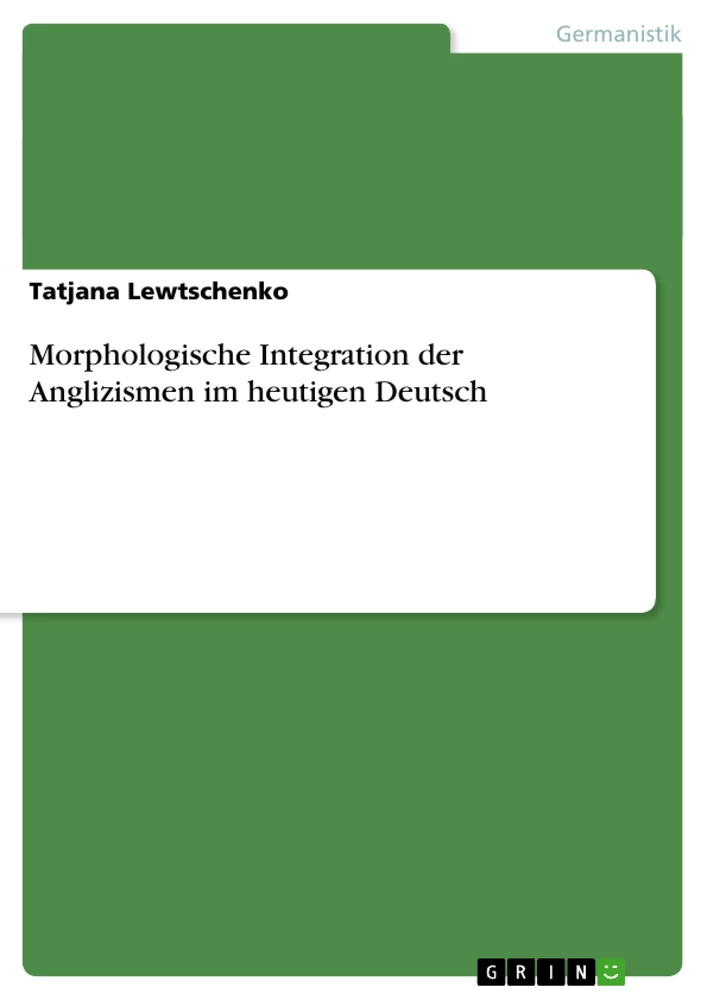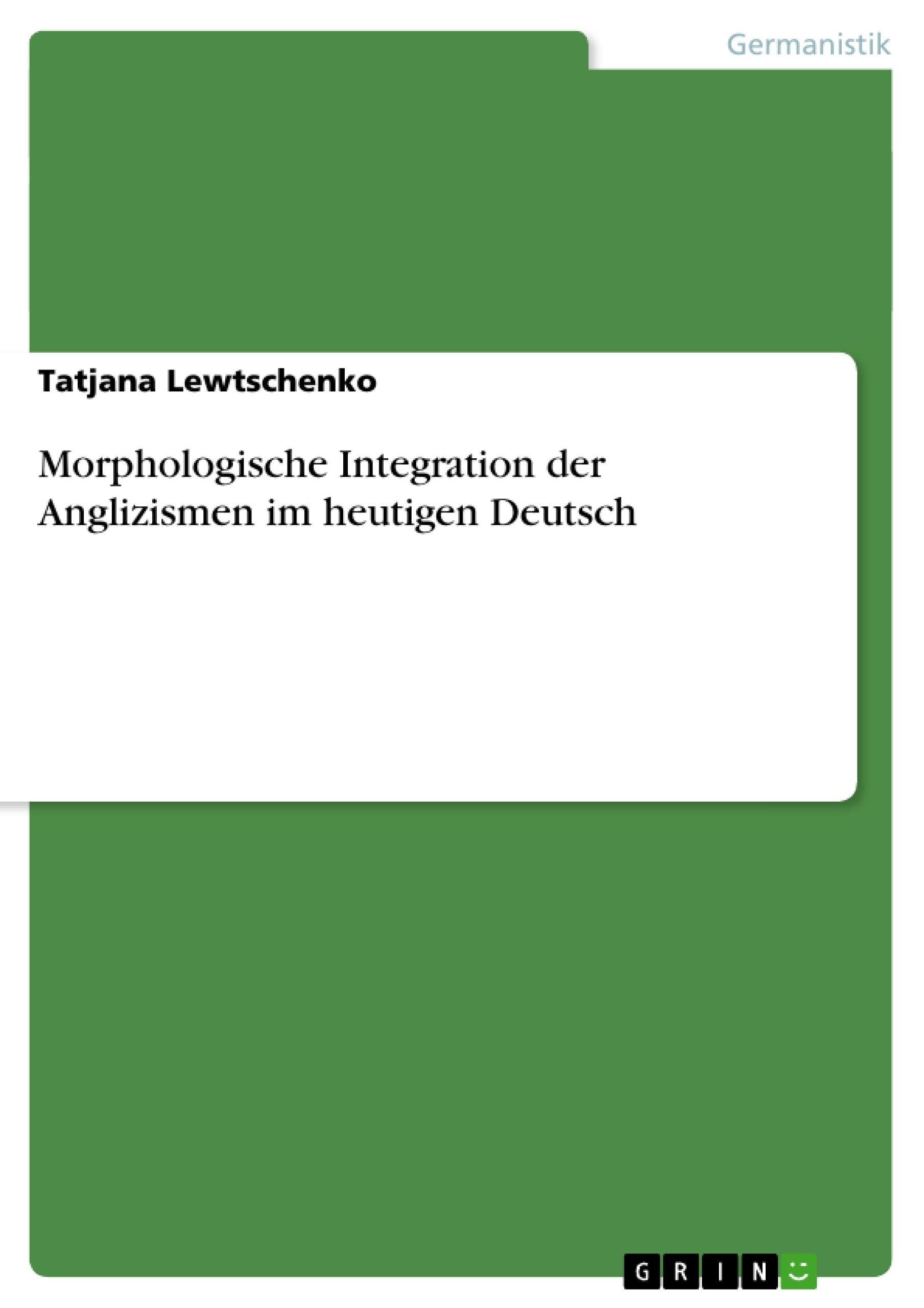Die deutsche Sprache, die als offen für Aufnahmen von Wörtern aus allen Teilen der Welt gilt, unterliegt Einflüssen anderer Sprachen und ist einem ständigen Wandel unterzogen. Auch die Weltsprache Englisch mischt sich ganz selbstverständlich in das Sprachgeschehen ein, woraus zahlreiche englische Entlehnungen entstehen. Da sich die beiden Sprachen - Deutsch und Englisch - in ihren morphologischen Strukturen unterscheiden, können Anglizismen und Amerikanismen nicht ohne Veränderung im Deutschen bleiben. Wie Ausländer, die in ein fremdes Land kommen, sollten sie sich neuen Bedingungen anpassen und sich unter „Einheimischen“ etablieren. In meiner Arbeit untersuche ich die morphologische Integration der Anglizismen, weil sie meiner Meinung nach einen der wichtigsten Aspekte der Anreicherung der deutschen Sprache darstellt: wenn sich Anglizismen (und andere Neologismen) dem deutschen morphologischen System anpassen und sich integrieren, droht dem Deutschen kein Abstieg, denn eingedeutschte Fremdwörter sind keine echten „fremden“ Wörter mehr, die die deutschen verdrängen, sondern ein Lehngut für den Wortschatz, das eine Chance zur Bedeutungsdifferenzierung und Bereicherung bietet. Solange Anglizismen ins Deutsche integriert werden, ist die Nehmersprache, das Deutsche, nur im Vorteil.
Der Gegenstandsbereich der Arbeit über die Integration der Anglizismen im Deutschen kann aus vielen Blickwinkeln betrachtet werden. In dieser Arbeit werde ich folgende Aspekte klären: zuerst betrachte ich Anglizismen allgemein als Begriff, weil „Anglizismus“ nicht eindeutig zu definieren ist. Danach schildere ich Allgemeines zu der Integration der Anglizismen in die deutsche Sprache: es wird untersucht, wie sich englische Substantive, Adjektive, Verben und andere Wortarten im Deutschen verhalten und wie sie in morphologischer Hinsicht ins Deutsche integriert werden. In den darauf folgenden Kapiteln beschäftige ich mich mit der Integration der Anglizismen konkret in die Werbe- und Jugendsprache. Im letzten Kapitel fasse ich die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammen und gehe auf Entwicklungstendenzen und Prognosen ein. Das Ziel der Arbeit ist also, den Stand der morphologischen Integration der Anglizismen im Deutschen zu analysieren und zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anglizismen als Begriff
- Morphologische Integration der Anglizismen (allgemein)
- Substantive
- Adjektive
- Verben
- Morphologische Integration der Anglizismen in der Werbung
- Morphologische Integration der Anglizismen in der deutschen Jugendsprache
- Zusammenfassung/Schlussfolgerung. Entwicklungstendenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die morphologische Integration von Anglizismen in die deutsche Sprache. Das Hauptziel besteht darin, den aktuellen Stand dieser Integration zu analysieren und zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Bereicherung des deutschen Wortschatzes. Die Arbeit betrachtet die Anglizismen nicht als Bedrohung, sondern als potenzielles Lehngut, das zur Bedeutungsdifferenzierung beiträgt.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Anglizismus"
- Allgemeine morphologische Integration von Anglizismen (Substantive, Adjektive, Verben)
- Integration von Anglizismen in der Werbung
- Integration von Anglizismen in der deutschen Jugendsprache
- Entwicklungstendenzen und zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der morphologischen Integration von Anglizismen im Deutschen ein. Sie betont die Offenheit der deutschen Sprache für Fremdwörter und den ständigen Wandel, dem sie unterliegt. Der Fokus liegt auf der Analyse der morphologischen Anpassung von Anglizismen als wichtigen Aspekt der sprachlichen Bereicherung. Die Arbeit untersucht die Integration in verschiedene Sprachbereiche, wobei die methodische Vorgehensweise erläutert wird. Der übergeordnete Anspruch ist es zu zeigen, dass die Integration von Anglizismen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung des deutschen Sprachsystems verstanden werden kann.
Anglizismen als Begriff: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs "Anglizismus". Es wird deutlich gemacht, dass eine eindeutige Definition schwierig ist und verschiedene Auffassungen in der Literatur existieren. Die Arbeit diskutiert verschiedene Arten von Anglizismen, wie z.B. Wort- und Wortstammentlehnungen, Scheinanglizismen, Lehnübersetzungen, Lehnübertragungen, Lehnbedeutungen und Lehnschöpfungen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Terminologie für die spätere Analyse, um eine konsistente und präzise Untersuchung zu gewährleisten. Der Unterschied zwischen direkten Entlehnungen und Anglizismen, die sich bereits an die deutsche Morphologie angepasst haben, wird herausgearbeitet.
Morphologische Integration der Anglizismen (allgemein): Dieses Kapitel untersucht die allgemeine morphologische Integration von Anglizismen in die deutsche Sprache. Es analysiert, wie Substantive, Adjektive und Verben aus dem Englischen in das deutsche morphologische System integriert werden. Es werden konkrete Beispiele analysiert, wie sich die englischen Wörter an die deutschen grammatischen Regeln und morphologischen Strukturen anpassen. Dabei werden sowohl erfolgreiche Integrationsprozesse als auch Herausforderungen und Besonderheiten der Anpassung beleuchtet. Der Abschnitt dient als Grundlage für die spätere Untersuchung der Anglizismen in spezifischen Kontexten.
Morphologische Integration der Anglizismen in der Werbung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die morphologische Integration von Anglizismen in der Werbebranche. Es untersucht, wie Anglizismen in Werbetexten und Slogans verwendet und morphologisch angepasst werden, um eine bestimmte Wirkung beim Publikum zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Anpassungsstrategien in diesem spezifischen Kontext, der sich durch eine oftmals stark anglizistische Sprache auszeichnet. Die Analyse deckt die spezifischen Gründe für den Gebrauch von Anglizismen in der Werbung auf und beleuchtet ihre Wirkung auf die Rezeption. Die Kapitel analysiert, wie Anglizismen die Werbewirkung beeinflussen und welche Strategien der Integration eingesetzt werden.
Morphologische Integration der Anglizismen in der deutschen Jugendsprache: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der morphologischen Integration von Anglizismen in die deutsche Jugendsprache. Es untersucht, wie junge Menschen Anglizismen verwenden und wie diese sich in ihrer Sprache morphologisch einfügen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Trends und Entwicklungen in der Jugendsprache, welche durch den Einfluss des Englischen geprägt ist. Es werden Beispiele aus Jugendzeitschriften und Online-Kommunikation analysiert, um den aktuellen Sprachgebrauch zu beleuchten und seine Besonderheiten im Vergleich zum Standarddeutschen zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Morphologie, Integration, deutsche Sprache, Werbung, Jugendsprache, Wortbildung, Lehngut, Neologismen, Fremdwörter, Entwicklungstendenzen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Morphologische Integration von Anglizismen im Deutschen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die morphologische Integration von Anglizismen in die deutsche Sprache. Sie analysiert, wie englische Wörter in das deutsche morphologische System integriert werden und welche Rolle sie in verschiedenen Sprachbereichen spielen, insbesondere in der Werbung und der Jugendsprache.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse und Bewertung des aktuellen Stands der Integration von Anglizismen. Die Arbeit betrachtet Anglizismen nicht als Bedrohung, sondern als potenzielles Lehngut, das zur sprachlichen Bereicherung beiträgt. Sie beleuchtet die Bedeutungsdifferenzierung durch Anglizismen und untersucht deren Entwicklungstendenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition von Anglizismen, allgemeine morphologische Integration von Anglizismen (Substantive, Adjektive, Verben), Integration in der Werbung, Integration in der deutschen Jugendsprache und Zusammenfassung/Schlussfolgerung mit Entwicklungstendenzen.
Wie definiert die Arbeit "Anglizismus"?
Die Arbeit räumt ein, dass eine eindeutige Definition schwierig ist und verschiedene Auffassungen in der Literatur existieren. Sie diskutiert verschiedene Arten von Anglizismen, wie z.B. Wort- und Wortstammentlehnungen, Scheinanglizismen, Lehnübersetzungen, Lehnübertragungen, Lehnbedeutungen und Lehnschöpfungen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Terminologie für eine konsistente Analyse.
Wie wird die morphologische Integration von Anglizismen untersucht?
Die Arbeit analysiert die Anpassung von Anglizismen an die deutschen grammatischen Regeln und morphologischen Strukturen anhand konkreter Beispiele. Sie beleuchtet sowohl erfolgreiche Integrationsprozesse als auch Herausforderungen und Besonderheiten der Anpassung in verschiedenen Kontexten (allgemein, Werbung, Jugendsprache).
Welche Rolle spielen Anglizismen in der Werbung?
Das Kapitel zur Werbung untersucht, wie Anglizismen in Werbetexten und Slogans verwendet und morphologisch angepasst werden, um eine bestimmte Wirkung beim Publikum zu erzielen. Die Analyse deckt die Gründe für den Gebrauch von Anglizismen in der Werbung auf und beleuchtet ihre Wirkung auf die Rezeption.
Welche Rolle spielen Anglizismen in der deutschen Jugendsprache?
Die Arbeit analysiert den Gebrauch von Anglizismen in der deutschen Jugendsprache, untersucht Trends und Entwicklungen und beleuchtet die Besonderheiten im Vergleich zum Standarddeutschen anhand von Beispielen aus Jugendzeitschriften und Online-Kommunikation.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und präsentiert Entwicklungstendenzen der morphologischen Integration von Anglizismen. Sie betont den positiven Beitrag von Anglizismen zur Bereicherung des deutschen Wortschatzes.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Anglizismen, Morphologie, Integration, deutsche Sprache, Werbung, Jugendsprache, Wortbildung, Lehngut, Neologismen, Fremdwörter, Entwicklungstendenzen.
- Quote paper
- Tatjana Lewtschenko (Author), 2005, Morphologische Integration der Anglizismen im heutigen Deutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48252