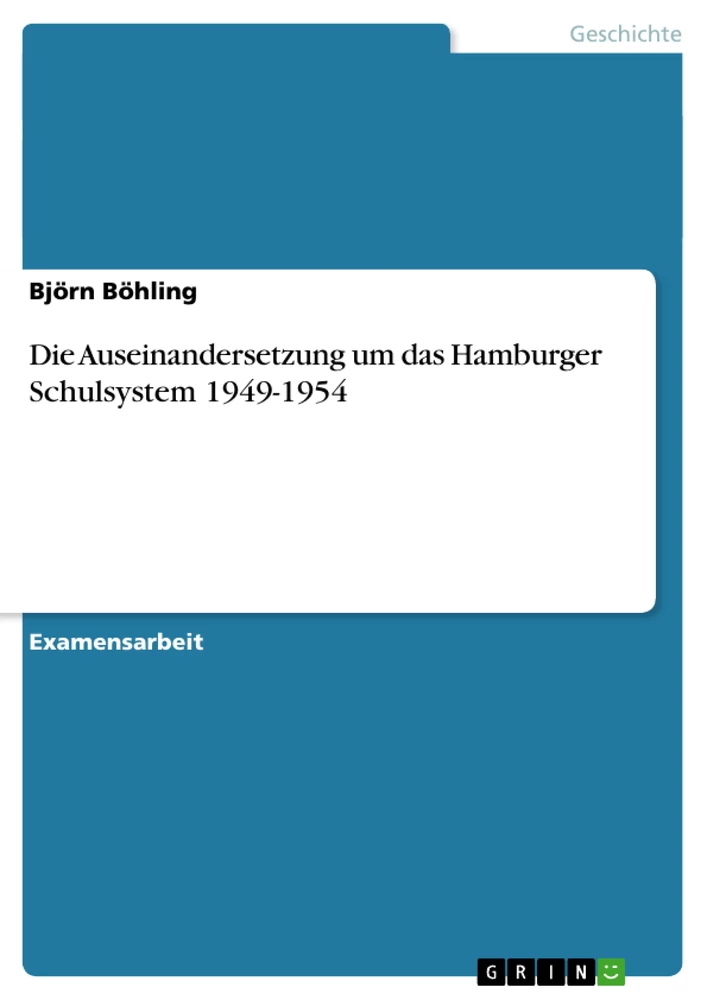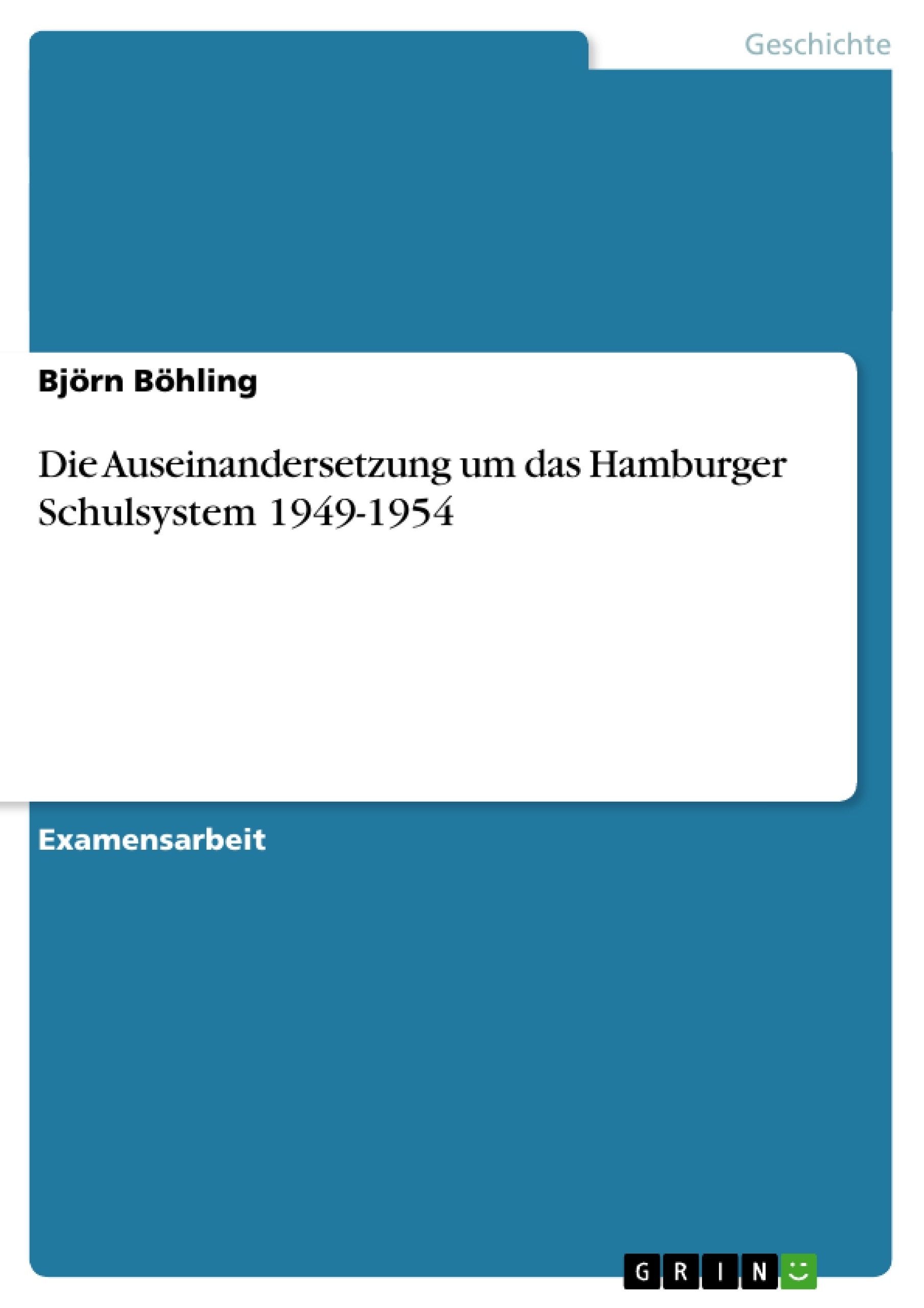In dieser Arbeit wird die Kontroverse um die Schulreform in Hamburg von 1949 (Einführung der Allgemeinen Volksschule als Einheitsschule durch die SPD; Rücknahme 1954 durch den Hamburg-Block) multiperspektiv aus Quellen des Hamburger Staatsarchivs (Zeitungsartikel, Protokolle, Entschließungen usw.) rekonstruiert und den Fragen nachgegangen, warum sie in Gesellschaft und Politik so starke Auseinandersetzungen hervorrief und schließlich schon nach wenigen Jahren scheiterte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Intentionen und Fragestellung
- 1.2. Methodisches Vorgehen
- 2. Der Einheitsschulentwurf der Hamburger Schulbehörde: Die ‚Allgemeine Volksschule’
- 3. Schulraumnot, Lehrermangel, Hunger und Obdachlosigkeit: Die richtige Zeit für eine Schulreform? - Hamburgs Schulwesen nach 1945
- 4. Die Hamburger Schulreform von 1949 im Meinungsstreit
- 4.1. Die Entwicklung und Beratung des Gesetzentwurfes in der Schulbehörde
- 4.1.1. Die Versammlung der Schulaufsichtsbeamten
- 4.1.2. Die Schuldeputation
- 4.2. Die Schulreform in der Kritik öffentlicher Verbände und Institutionen
- 4.2.1. Der Streit in der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens – Der schulpolitische / pädagogische Ausschuss und die Fachschaft höhere Schulen
- 4.2.2. Die Elternschaft
- 4.2.3. Die Universität Hamburg
- 4.2.4. Hamburger Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände
- 4.2.5. Die Kirchen
- 4.2.6. Andere Verbände
- 4.3. Schulpolitische Positionen der Parteien in der Hamburger Bürgerschaft
- 4.3.1. Die Christlich Demokratische Union (CDU)
- 4.3.2. Die Freie Demokratische Partei (FDP)
- 4.3.3. Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
- 4.3.4. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- 5. Der Wahlsieg des ‚Hamburg-Blocks’ 1953 – Restauration im Schulwesen?
- 5.1. Die Phase vor der Wahl und der Wahlkampf im Oktober 1953
- 5.2. Die Wiedereinführung der vierjährigen Grundschule - Das ‚Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über das Schulwesen der Hansestadt Hamburg vom 25. Oktober 1949’
- 5.2.1. Die Richtungsentscheidung nach der Wahl
- 5.2.2. Verhandlungen in der Deputation der Schulbehörde
- 5.2.3. Diskussion und Entscheidung über das Schulergänzungsgesetz in der Bürgerschaft
- 5.2.3.1. Die ablehnende Haltung der SPD und die Rechtfertigung des HB
- 5.2.3.2. Der Verlauf der Lesungen und die Abstimmung
- 5.3. Die Beurteilung des Ergänzungsgesetzes in der Hamburger Presse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kontroverse um die Hamburger Schulreform von 1949 bis 1954. Ziel ist es, die beteiligten Akteure, ihre Argumente und die Entwicklung der öffentlichen Meinung zu analysieren, um die Gründe für das Scheitern der Reform nach nur vier Jahren zu erklären. Dabei wird auch der Einfluss ideologischer Komponenten berücksichtigt.
- Die Entwicklung und der Inhalt des Gesetzentwurfs zur „Allgemeinen Volksschule“
- Die Kritik der Reform durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen (Eltern, Lehrer, Kirchen, Wirtschaft)
- Die politischen Positionen der Parteien (SPD, CDU, FDP, KPD) zur Schulreform
- Der Einfluss der Nachkriegsbedingungen (Schulraumnot, Lehrermangel etc.) auf die Reform
- Die Wiedereinführung der vierjährigen Grundschule nach dem Wahlsieg des „Hamburg-Blocks“ 1953
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Geschichte der Schulreformen in Hamburg ein und stellt den Kontext der 1949 eingeführten Reform dar. Sie beschreibt die langjährige Debatte um die Einheitsschule und die besondere Bedeutung der Hamburger Reform aufgrund ihrer vollständigen Neukonstruktion und anschließenden Rücknahme. Die Arbeit zielt auf eine geschichtsdidaktische Bewertung der Kontroverse und ihrer Relevanz für gegenwärtige und zukünftige schulpolitische Diskussionen.
2. Der Einheitsschulentwurf der Hamburger Schulbehörde: Die ‚Allgemeine Volksschule‘: Dieses Kapitel beschreibt den Entwurf der Hamburger Schulbehörde für eine „Allgemeine Volksschule“ als Einheitsschule mit einer sechsjährigen Grundschule und einer sich verzweigenden Oberschule. Die Begründung der Reform umfasst die Kritik an der alten Klassenschule, dem autoritären Charakter des Unterrichts und der Überbetonung des Faktenwissens. Die Behörde argumentiert für eine sozial-integrative Funktion der Schule, veränderte Unterrichtsmethoden und eine gerechtere Begabtenauslese nach sechs Jahren gemeinsamer Grundschulzeit.
3. Schulraumnot, Lehrermangel, Hunger und Obdachlosigkeit: Die richtige Zeit für eine Schulreform? - Hamburgs Schulwesen nach 1945: Dieses Kapitel beleuchtet die schwierigen Nachkriegsbedingungen in Hamburg, die die Schulreform beeinflussten. Es beschreibt die Zerstörungen im Schulwesen, den Lehrermangel, die hohe Schülerzahl durch Flüchtlinge, die schlechte soziale Lage von Kindern und Lehrern und die Herausforderungen des Schichtunterrichts. Trotz dieser Schwierigkeiten war die Schulbildung nach wie vor hoch angesehen.
4. Die Hamburger Schulreform von 1949 im Meinungsstreit: Dieses Kapitel analysiert die Auseinandersetzung um die Schulreform, indem es die Entwicklung des Gesetzentwurfs in der Schulbehörde, die Diskussion in der Schuldeputation und die Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen (Lehrerverbände, Eltern, Universität, Kirchen, Wirtschaft) sowie der Parteien im Schulausschuss und der Bürgerschaft nachzeichnet. Es werden die jeweiligen Argumente und Positionen detailliert dargestellt.
5. Der Wahlsieg des ‚Hamburg-Blocks’ 1953 – Restauration im Schulwesen?: Dieses Kapitel beschreibt den Wahlkampf von 1953 und den Wahlsieg des „Hamburg-Blocks“, der die Wiedereinführung der vierjährigen Grundschule ankündigte. Es analysiert die politischen Strategien der Parteien und den erneuten Meinungskampf in der Presse und untersucht die Gesetzgebungsprozesse zur Rücknahme der sechsjährigen Grundschule. Der Fokus liegt auf der Argumentation der beteiligten Parteien und der Frage nach einer "Restauration" im Schulwesen.
Schlüsselwörter
Hamburger Schulsystem, Schulreform 1949, Allgemeine Volksschule, Einheitsschule, sechsjährige Grundschule, dreigliedriges Schulsystem, Nachkriegsbedingungen, politische Parteien, öffentliche Meinung, Ideologie, Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens, Universität Hamburg, Kirchen, Wirtschaft, Restauration.
Häufig gestellte Fragen zur Hamburger Schulreform 1949-1954
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Kontroverse um die Hamburger Schulreform von 1949 bis 1954. Sie untersucht die beteiligten Akteure, ihre Argumente und die Entwicklung der öffentlichen Meinung, um die Gründe für das Scheitern der Reform nach nur vier Jahren zu erklären. Der Einfluss ideologischer Komponenten wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Aspekte der Hamburger Schulreform werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung und den Inhalt des Gesetzentwurfs zur „Allgemeinen Volksschule“, die Kritik der Reform durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen (Eltern, Lehrer, Kirchen, Wirtschaft), die politischen Positionen der Parteien (SPD, CDU, FDP, KPD), den Einfluss der Nachkriegsbedingungen (Schulraumnot, Lehrermangel etc.) und die Wiedereinführung der vierjährigen Grundschule nach dem Wahlsieg des „Hamburg-Blocks“ 1953.
Was war die „Allgemeine Volksschule“?
Der Entwurf der Hamburger Schulbehörde sah eine „Allgemeine Volksschule“ als Einheitsschule mit einer sechsjährigen Grundschule und einer sich verzweigenden Oberschule vor. Die Begründung umfasste die Kritik an der alten Klassenschule, dem autoritären Unterricht und der Überbetonung des Faktenwissens. Es wurde eine sozial-integrative Funktion der Schule, veränderte Unterrichtsmethoden und eine gerechtere Begabtenauslese angestrebt.
Welche gesellschaftlichen Gruppen kritisierten die Reform?
Die Reform wurde von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen kritisiert, darunter Eltern, Lehrerverbände, die Universität Hamburg, Kirchen und Wirtschaftsverbände. Die Arbeit beschreibt detailliert die jeweiligen Argumente und Positionen dieser Gruppen.
Welche Rolle spielten die politischen Parteien?
Die Arbeit analysiert die schulpolitischen Positionen der SPD, CDU, FDP und KPD zur Schulreform. Es wird gezeigt, wie die Parteien die Reform im Schulausschuss und der Bürgerschaft behandelten und welche Strategien sie im Wahlkampf 1953 verfolgten.
Wie beeinflussten die Nachkriegsbedingungen die Schulreform?
Die schwierigen Nachkriegsbedingungen in Hamburg, wie Schulraumnot, Lehrermangel, Flüchtlingsströme und die schlechte soziale Lage vieler Kinder und Lehrer, beeinflussten die Schulreform maßgeblich. Die Arbeit beschreibt diese Herausforderungen und ihren Einfluss auf die Umsetzung der Reform.
Was war der „Hamburg-Block“ und welche Rolle spielte er?
Der „Hamburg-Block“ war eine politische Allianz, die 1953 die Wahl gewann. Der Wahlsieg führte zur Wiedereinführung der vierjährigen Grundschule und markierte damit das Scheitern der Reform von 1949.
Warum scheiterte die Reform?
Die Arbeit untersucht die Gründe für das Scheitern der Reform nach nur vier Jahren. Es werden die verschiedenen Faktoren, von den politischen Auseinandersetzungen bis hin zu den schwierigen Nachkriegsbedingungen, analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hamburger Schulsystem, Schulreform 1949, Allgemeine Volksschule, Einheitsschule, sechsjährige Grundschule, dreigliedriges Schulsystem, Nachkriegsbedingungen, politische Parteien, öffentliche Meinung, Ideologie, Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens, Universität Hamburg, Kirchen, Wirtschaft, Restauration.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Beschreibung des Einheitsschulentwurfs, Darstellung der Nachkriegsbedingungen, Analyse der Kontroverse um die Reform und Beschreibung des Wahlsiegs des „Hamburg-Blocks“ und der Wiedereinführung der vierjährigen Grundschule.
- Quote paper
- Björn Böhling (Author), 2004, Die Auseinandersetzung um das Hamburger Schulsystem 1949-1954, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48236