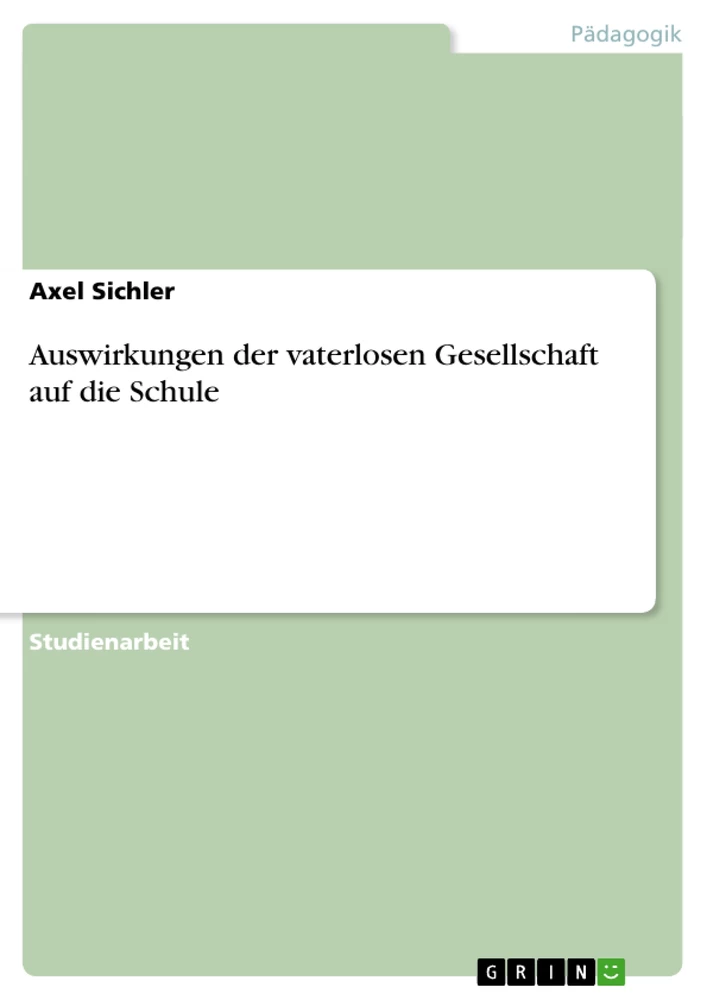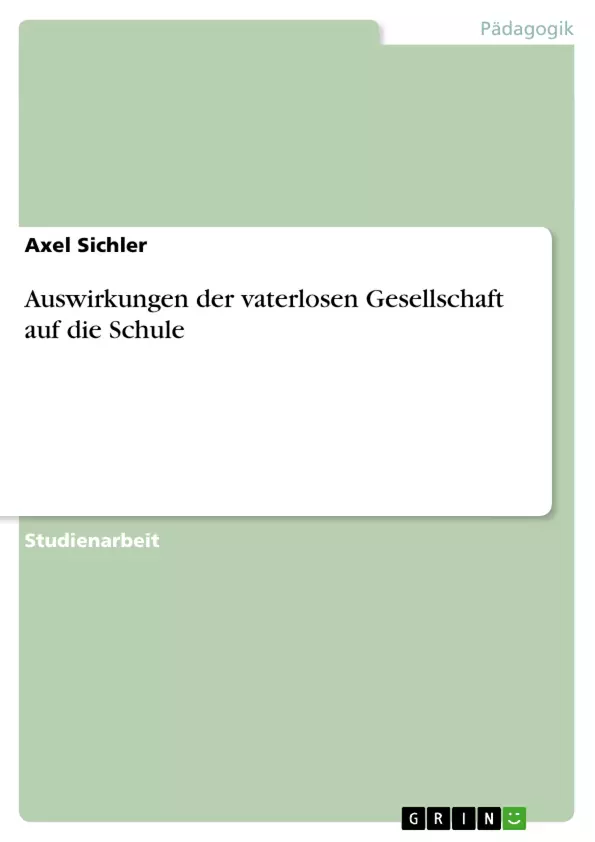Der Begriff der „vaterlosen Gesellschaft“ ist mittlerweile zum geflügelten Wort geworden. Benutzt wird er heute meist im Zusammenhang mit den Lebensumständen von Patchworkfamilien, der Situation allein von der Mutter erzogener Kinder und der Rolle getrennt lebender Väter, die nicht selten zu reinen Alimentezahlern degradiert ihre Sprösslinge nur noch stundenweise oder gar nicht mehr sehen, geschweige denn Einfluss auf deren Erziehung haben. Doch der ursprünglich von Sigmund Freud geprägte Begriff ist weitaus vielschichtiger. Der Arzt, Historiker und Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich beispielsweise umschreibt damit in seinem 1963 erschienenen Buch „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“ die sozialpsychologischen Konsequenzen des Wandels von einer traditionellen paternistischen Gesellschaftsordnung zu einer modernen industriellen Massengesellschaft. Nach einem Jahrzehnte langen feministisch geprägten Diskurs beschäftigen sich in jüngster Zeit auch wissenschaftliche Studien vermehrt mit den Folgen von Vaterlosigkeit und der Bedeutung von Männern für die Sozialisation. So hat sich im Zuge der "gender-studies" in den letzten Jahren neben der Frauenforschung auch die Männer- bzw. Vaterforschung allmählich etabliert.
In der vorliegenden Arbeit wird der in unterschiedlichen Kontexten verwendete vielschichtige Terminus „vaterlose Gesellschaft“ zunächst einmal entschlüsselt, differenziert und exakt definiert. Dazu werden die historischen, sozialphilosophischen und psychologischen Grundlagen zur Funktion des Vaters dargestellt. Welche möglichen Vorteile birgt männlicher Einfluss für die Sozialisation von Kindern? Welche Defizite könnten durch einen Vatermangel auftreten? Die Differenzierung zwischen genetischer und sozialer Vaterschaft wirft die Frage nach der Austauschbarkeit von Vätern auf. Wie weit reicht die Vaterrolle? Kann sie ohne Einschränkung auf männliche Bezugs- und Betreuungspersonen ausgedehnt werden? Können soziale Väter den Verlust des genetischen Vaters kompensieren?
Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse auf die gegenwärtige z. T. durch Überfeminisierung geprägte Situation in der institutionellen Erziehung angewandt. Inwiefern könnten Auswirkungen der vaterlosen Gesellschaft in unseren Schulen auftauchen und sich im Verhalten der heutigen Schüler widerspiegeln, das zunehmend durch Auffälligkeiten und Schulversagen insbesondere bei männlichen Heranwachsenden gekennzeichnet ist?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der historische Hintergrund
- Die Vaterfunktion im Wandel
- Der Vater im 18. und 19. Jahrhundert
- Die Bedeutung des Vaters aus Sicht der klassischen Psychologie
- Sigmund Freud
- Alfred Adler
- Carl Gustav Jung
- Zusammenfassung Mitscherlichs Vorläufer
- Paul Federn
- Max Horkheimer
- Alexander Mitscherlich
- Eine Einordnung seines Werks
- Der gesellschaftliche Strukturwandel
- Kennzeichen der vaterlosen Massengesellschaft
- Mitscherlichs Definition von „Vaterlosigkeit“
- Bedeutung und Konsequenzen
- Die Gegenwartsdiskussion über die vaterlose Gesellschaft
- Der Aufstand gegen die Väter
- Die feministische Bewegung
- Die Emanzipation der Väter
- Familiäre und familienpolitische Veränderungen
- Die unterschiedlichen Standpunkte im Geschlechterkampf
- Die Argumente der Frauen
- Die Argumente der Männer
- Väterlichkeit wird neu entdeckt
- Die moderne Definition von „Vaterlosigkeit“
- Der aktuelle Stand der Forschung über die Bedeutung des Vaters
- Der männliche Beitrag zur Sozialisation des Kindes
- Auswirkungen von Vaterlosigkeit
- Väter und Töchter
- Problemgruppe Jungen
- Soziale Vaterschaft
- Der Vater als Lehrer
- Der Lehrer als Vater
- Grenzen und Möglichkeiten der Ersatzvaterfunktion von Lehrern
- Auswirkungen der „vaterlosen Gesellschaft\" auf die Schule
- Allgemeine Auswirkungen
- (Mögliche) Auswirkungen auf das Schülerverhalten
- Das geschlechtliche Missverhältnis bei der institutionellen Erziehung
- Die Feminisierung des Lehrerberufs
- Die Abwesenheit der Männer
- Positive Wirkungen männlicher Präsenz in der Schule
- Jungen als Problemgruppe in der Schule
- Jungenarbeit in der Schule
- Ein praktisches Beispiel
- Jungenarbeit in der Schule
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der „vaterlosen Gesellschaft“ auf die Institution Schule. Der Fokus liegt dabei auf den Folgen der veränderten Vaterrolle und den daraus resultierenden Entwicklungen in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen.
- Der Wandel der Vaterrolle im historischen Kontext
- Die Folgen der „vaterlosen Gesellschaft“ auf die Sozialisation von Kindern
- Die Bedeutung von männlicher Präsenz in der Schule
- Die Herausforderungen der Jungenpädagogik
- Mögliche Auswirkungen auf das Schülerverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „vaterlose Gesellschaft“ ein und erläutert die Relevanz der Arbeit im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das erste Kapitel betrachtet den historischen Wandel der Vaterrolle und beleuchtet die Bedeutung des Vaters in verschiedenen Epochen. Das zweite Kapitel widmet sich der Interpretation der Vaterrolle aus Sicht der klassischen Psychologie und den wissenschaftlichen Ansätzen zur Untersuchung des Vater-Kind-Verhältnisses. Im dritten Kapitel wird das Werk Alexander Mitscherlichs, das den Begriff der „vaterlosen Gesellschaft“ prägte, analysiert. Es werden die Kernaussagen seines Buches „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“ beleuchtet und seine Kritik an den gesellschaftlichen Veränderungen der damaligen Zeit diskutiert. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Auswirkungen der „vaterlosen Gesellschaft“ auf die heutige Gesellschaft und analysiert die vielfältigen Auswirkungen auf die Familienstrukturen, die Geschlechterrollen und die Sozialisation von Kindern. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem aktuellen Stand der Forschung über die Bedeutung des Vaters, insbesondere den Folgen einer vaterlosen Kindheit und den Einfluss des Vaters auf die Sozialisation von Kindern. Hier werden die Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Studien betrachtet und die Rolle des Vaters in der Entwicklung von Kindern beleuchtet. Das sechste Kapitel widmet sich der Thematik der „sozialen Vaterschaft“ und untersucht die Bedeutung von männlicher Präsenz im Bildungsbereich. Dabei werden die Herausforderungen und Chancen der Ersatzvaterfunktion von Lehrern in der Schule beleuchtet. Das siebte Kapitel analysiert die Auswirkungen der „vaterlosen Gesellschaft“ auf die Institution Schule. Es werden die Auswirkungen auf das Schülerverhalten, die Feminisierung des Lehrerberufs und die Bedeutung männlicher Präsenz in der Schule diskutiert. Das achte Kapitel widmet sich der Problematik von Jungen in der Schule und beleuchtet die Ursachen für mögliche Benachteiligungen von Jungen im Bildungsbereich. Es werden verschiedene Ansätze der Jungenpädagogik vorgestellt, die darauf zielen, die Bildungschancen von Jungen zu verbessern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen „vaterlose Gesellschaft“, „Vaterrolle“, „Sozialisation“, „Schule“, „Jungenpädagogik“, „Gender Studies“, „Feminisierung“, „Männliche Präsenz“, „Schülerverhalten“ und „wissenschaftliche Forschung“. Die Analyse von Alexander Mitscherlichs Werk und die Betrachtung der aktuellen Forschungsergebnisse in Bezug auf die Auswirkungen einer vaterlosen Gesellschaft auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stehen dabei im Vordergrund.
- Quote paper
- Axel Sichler (Author), 2005, Auswirkungen der vaterlosen Gesellschaft auf die Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47965