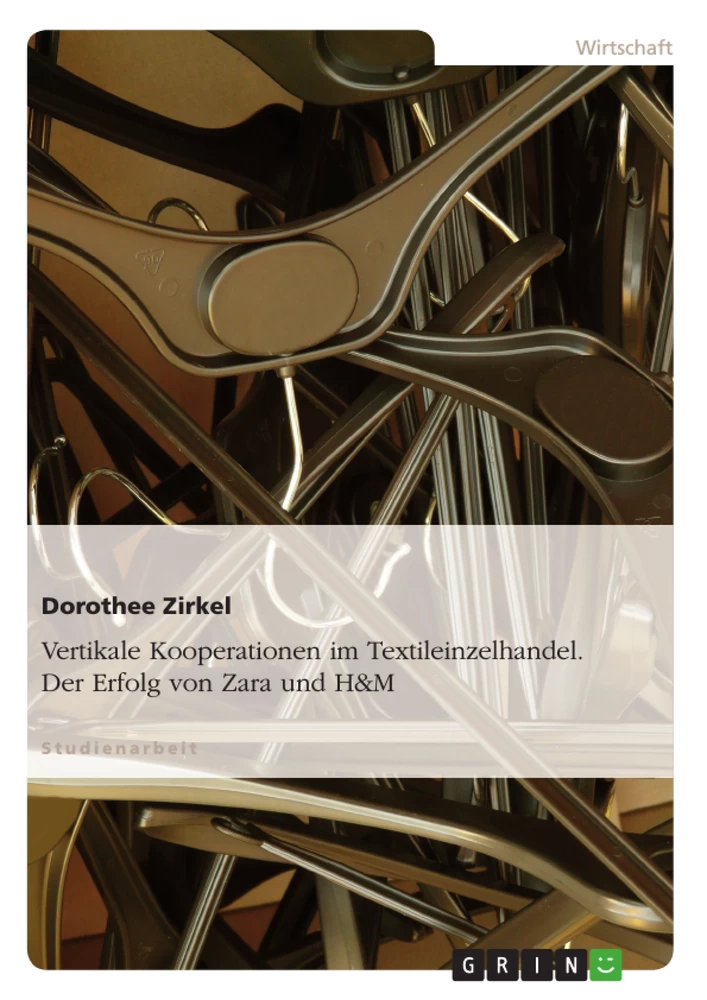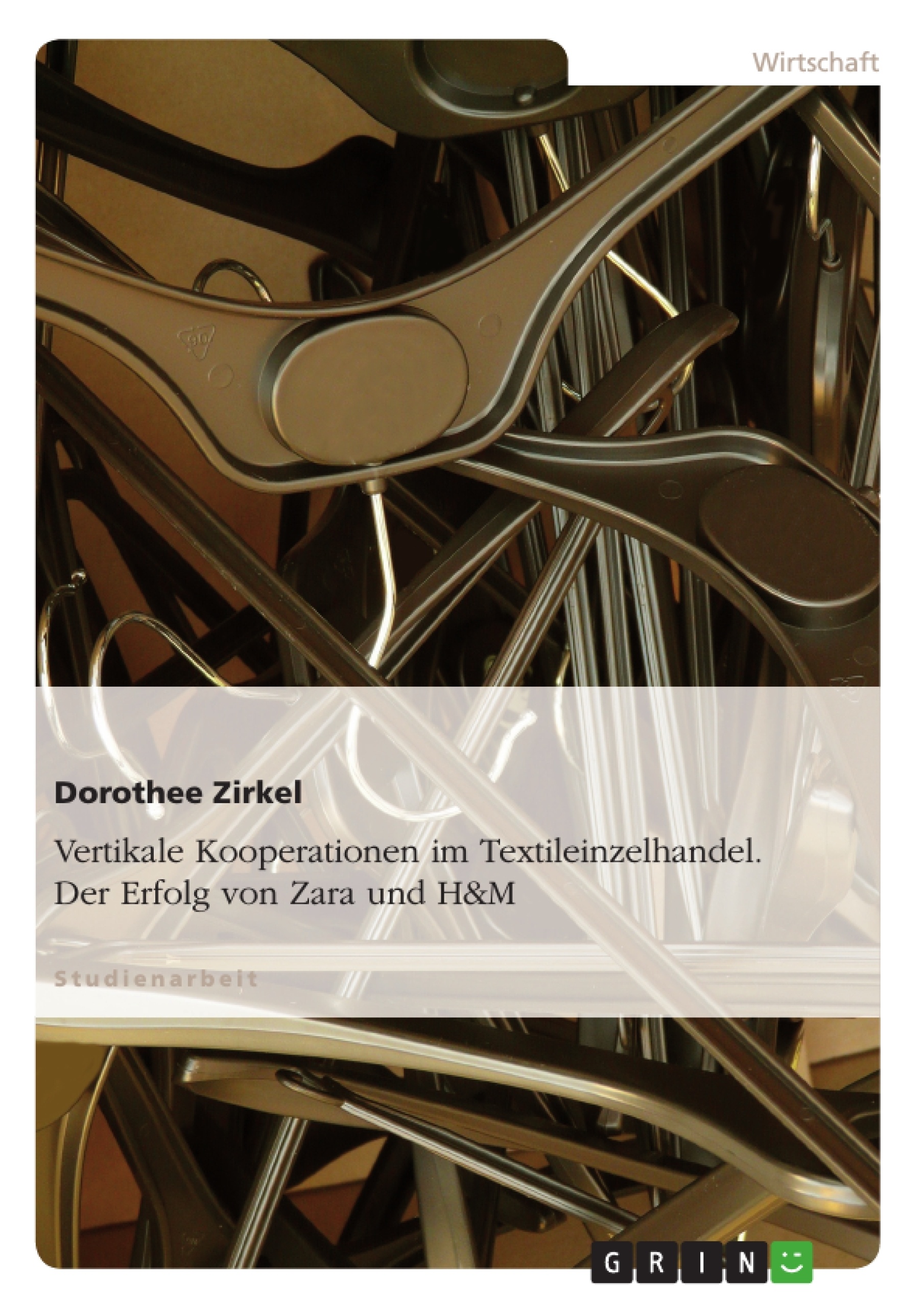In den letzten Jahren hat sich im deutschen Textileinzelhandel einiges verändert. Gesättigte Märkte, die allgemein abnehmende Wertschätzung klasssicher Anbieter gekoppelt mit wenigen brancheneigenen Impulsen und die steigende Preis-Sensibilisierung der Konsumenten haben zu deutlichen Verlusten bei den traditionellen Betriebsformen geführt. (vgl. Riekhof, Hans-Christian (Hrsg.), Retail Business in Deutschland, 1. Auflage, Wiesbaden 2004, S. 431)
Hinzu kommt die Verunsicherung durch den Euro. Seit seiner Einführung ist den Verbrauchern der Preis zunehmend wichtiger geworden und sie sind mehr bereit, die Einkaufsstätten und Produkte zu wechseln. Die Konsumenten kaufen stärker in preiswerten, discountierenden Vertriebsschienen ein, welche erhebliche Marktanteile gewinnen konnten und greifen im Fachhandel erst bei Sonderangeboten zu. Gleichzeitig gibt es einige Unternehmen, die aus dieser Flaute als Sieger hervorgehen und sogar Umsatzzuwächse verzeichnen. Zu diesen so genannten "vertikalen Anbietern" zählen u.a. H&M, Zara, Mexx, Mango und Esprit. Den Grund für den Erfolg dieser Unternehmen sehen Branchenexperten in der kompletten Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette. "Zara und H&M haben derzeit weltweit die erfolgreichsten Konzepte im Textilhandel", urteilt Michael Kliger, Handelsexperte bei McKinsey. Beide sind vertikal integriert, das heißt: Sie kontrollieren alles - vom Design über die Fertigung bis zur Warenpräsentation liegt alles in einer Hand. Doch damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Die Schweden und die Spanier verfolgen ansonsten sehr unterschiedliche Strategien, welche später noch genauer betrachtet werden. (vgl. http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,278748,00.html, [Zugriff: 28.06.2004])
Den Erfolg dieser Konzepte belegen außerdem zahlreiche Artikel und Beiträge wie "Die Spanier kommen", "Die Deutschen lieben Hennes & Mauritz" oder "Spanische Unternehmen nutzen ihre Chance in Deutschland". Interessant sind in der aktuell schwierigen Lage im Textileinzelhandel allerdings auch die Beiträge, die versuchen, die Erfolgsfaktoren dieser Konzepte auf die eigenen traditionellen Geschäftsmodelle zu übertragen. In fast allen Beiträgen bleibt allerdings offen, wie und unter welchen Voraussetzungen dieses relativ komplexe Geschäftsmodell der "Vertikalen" auf bestehende Unternehmensstrukturen überhaupt übertragen werden kann. Es ist durchaus kein Problem, die Abläufe, Prozesse und die dahinter stehende Technik auf andere Betriebe zu übertragen. Allerdings wird bei der Umsetzung vor allem die kulturelle Komponente zumeist zu wenig in die jeweiligen Überlegungen mit einbezogen. (vgl. Riekhof, Hans-Christian (Hrsg.), Retail Business in Deutschland, 1. Auflage, Wiesbaden 2004, S. 431)
Vor diesem Hintergrund wird in dieser Hausarbeit versucht zu beschreiben, was genau den Erfolg der vertikal ausgerichteten Unternehmen H&M und Zara ausmacht. Ob ein günstiger Preis allein zum Erfolg ausreicht und wie genau sie die Instrumente der Positionierung im Textileinzelhandel einsetzen, um die angestrebte Positionierung zu erreichen und um Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Vorher soll in diesem Zusammenhang die Wertschöpfungsanalyse von Porter im Rahmen der wertschöpfungszentrierten Stärken- und Schwächenanalyse näher betrachtet werden, um zu verstehen, wie die vertikalen Anbieter ihre Wertschöpfungskette organisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Die öffentliche Diskussion um vertikale Konzepte
- Steckbriefe Zara und H&M
- Die wertschöpfungszentrierte Stärken- und Schwächenanalyse
- Allgemeine Ressourcenanalyse
- Wertkettensanalyse nach Porter
- Übergreifende Fähigkeiten und Kernkompetenzen
- Erfolgsbeispiele Zara und H&M
- Begriff und Konzept der Vertikalisierung im Textileinzelhandel
- Zaras und H&M's Instrumente der Positionierung im Vergleich
- Das Konzept der Spanier (Zara)
- Positionierung und Gestaltung der Sortimentspolitik
- Schnelligkeit und Flexibilität in der Sortimentserstellung
- Kultur und Organisation
- Das Konzept der Schweden (H&M)
- Mode und Qualität zum besten Preis
- Die Eroberung der Provinz und Karl Lagerfeld
- Die Zukunft der Fashion Branche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Erfolg vertikaler Unternehmen im Textileinzelhandel und untersucht am Beispiel von Zara und H&M zwei unterschiedliche Strategien zur Wertschöpfungskettenintegration. Die Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen beider Unternehmen, beleuchtet die Erfolgsfaktoren ihrer Strategien und diskutiert die Bedeutung von Schnelligkeit, Flexibilität und Kundennähe in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt.
- Vertikale Integration im Textileinzelhandel
- Stärken- und Schwächenanalyse von Zara und H&M
- Vergleichende Analyse der Strategien von Zara und H&M
- Bedeutung von Schnelligkeit und Flexibilität in der Textilindustrie
- Zukunftsperspektiven der Fashion Branche
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die aktuelle Situation im deutschen Textileinzelhandel und stellt den Kontext für die Analyse vertikaler Konzepte dar. Es werden die Herausforderungen und Chancen für die Branche im Kontext der globalisierten Wirtschaft und der steigenden Preis-Sensibilität der Konsumenten erörtert.
Im zweiten Kapitel werden die Unternehmen Zara und H&M näher vorgestellt. Es werden die wichtigsten Kennzahlen, die Unternehmensstruktur und die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen beider Unternehmen dargestellt. Die Unternehmen werden in ihren jeweiligen Kontexten und ihrer Bedeutung für den Textileinzelhandel positioniert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der wertschöpfungszentrierten Stärken- und Schwächenanalyse der Unternehmen. Es werden die wichtigsten Ressourcen, Fähigkeiten und Kernkompetenzen von Zara und H&M analysiert und bewertet. Die Analyse erfolgt unter Anwendung der Wertkettensanalyse nach Porter.
Das vierte Kapitel widmet sich den Erfolgsfaktoren der vertikalen Konzepte von Zara und H&M. Es werden die wichtigsten Instrumente der Positionierung, die Gestaltung der Sortimentspolitik, die Schnelligkeit und Flexibilität in der Sortimentserstellung sowie die Kultur und Organisation beider Unternehmen analysiert und im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Vertikale Integration, Textileinzelhandel, Zara, H&M, Wertschöpfungskette, Stärken- und Schwächenanalyse, Ressourcenanalyse, Wertkettensanalyse, Positionierung, Sortimentspolitik, Schnelligkeit, Flexibilität, Kundennähe, Fashion Branche, Erfolgsfaktoren.
- Citation du texte
- Dorothee Zirkel (Auteur), 2004, Vertikale Kooperationen im Textileinzelhandel. Der Erfolg von Zara und H&M, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47844