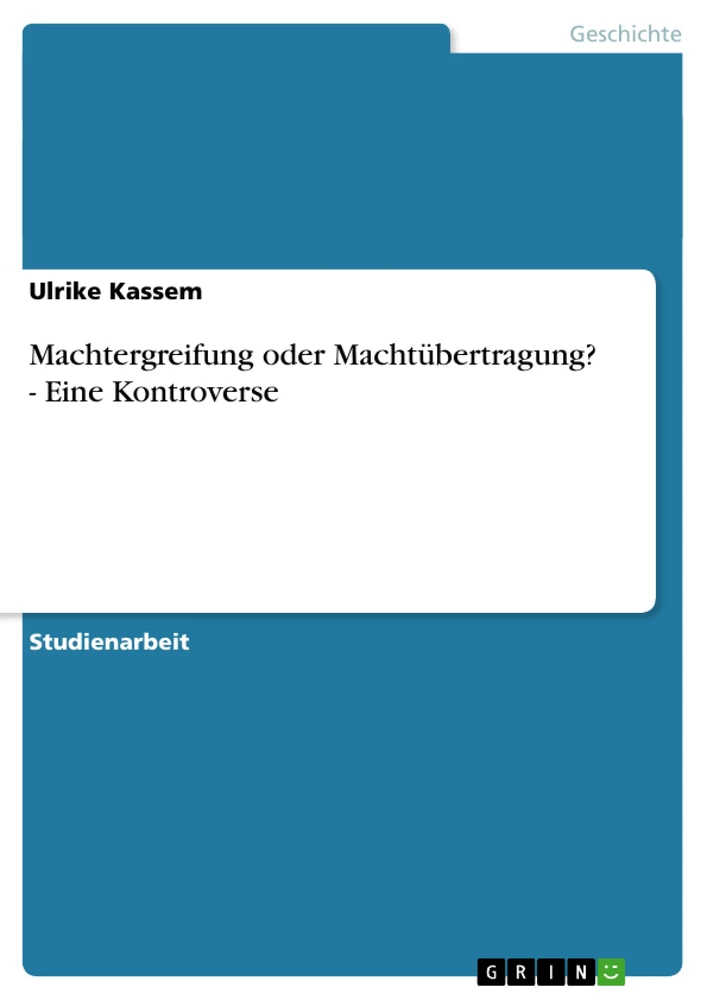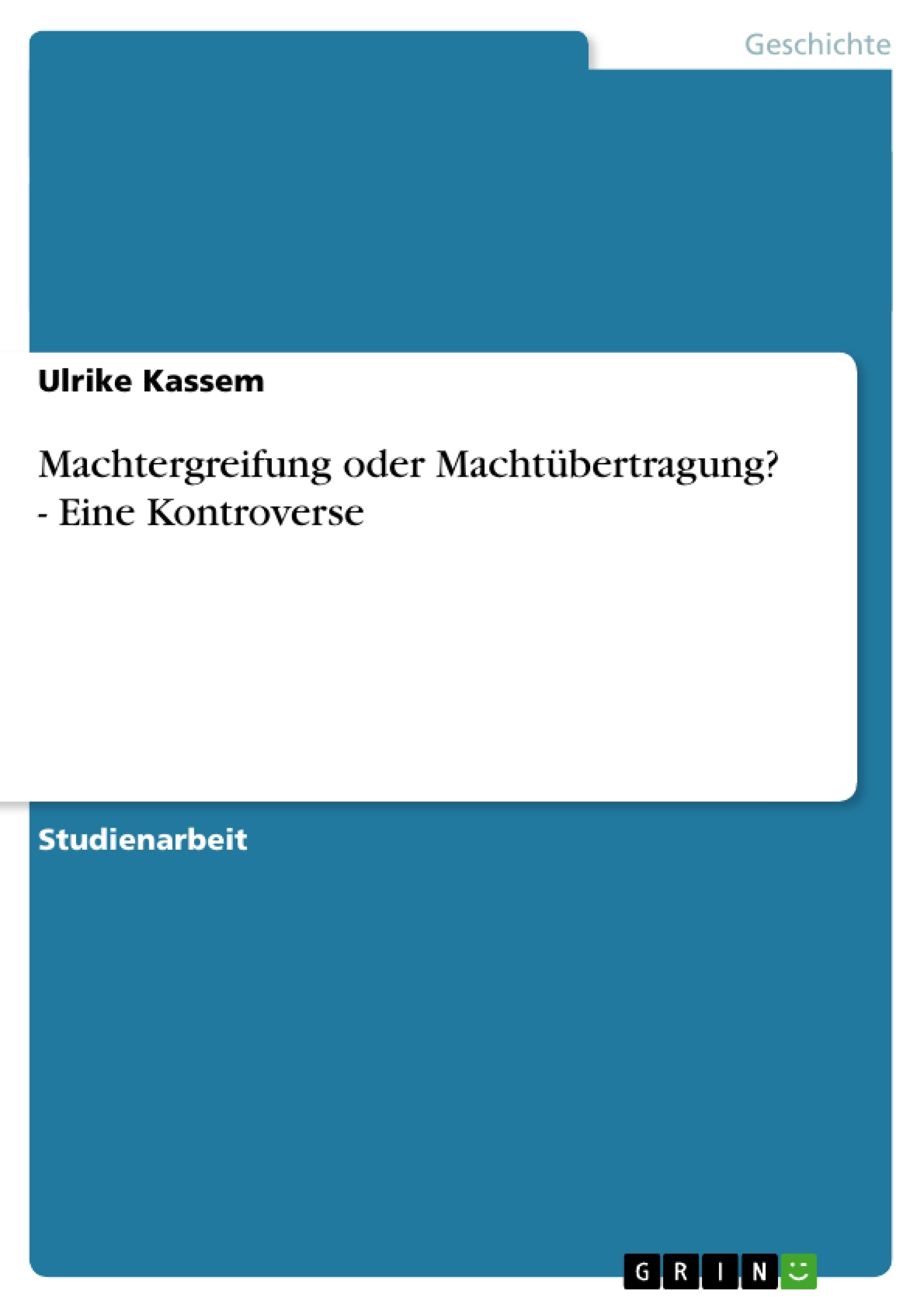Der 30. Januar 1933 gilt als Wendepunkt der deutschen Geschichte hin zur deutschen Katastrophe. Er war der Tag der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Um herauszufiltern, ob es sich bei dieser Ernennung um die Übertragung der Macht an Hitler handelt oder um die Ergreifung der Macht durch Hitler ist es nicht nur notwendig, die Begriffe „Machtübertragung“ und „Machtergreifung“ zu definieren und sie voneinander abzugrenzen. Es müssen sowohl die Argumente der Verfechter einer „Machtübertragung“, als auch die der Verfechter einer „Machtergreifung“ analysiert werden. Um die verschiedenen Argumente einzuordnen, ist es zudem unerlässlich, die wichtigsten Punkte des Weges Deutschlands in den Jahren bis zum 30. Januar 1933 sowie der Entwicklung der nationalsozialistischen Macht von diesem Tag an zu beleuchten. In einer abschließenden Stellungnahme sollen die Frage nach „Machtübertragung“ oder „Machtergreifung“ beantwortet und untermauert werden sowie - fast 70 Jahre später - ein Bezug der Ereignisse zur Gegenwart hergestellt werden. Dennoch möchte ich gleich zu Beginn meiner Ausführungen folgende These aufstellen: Der 30. Januar 1933 war, ungeachtet seiner Vorgeschichte und seiner Folgen, der Tag der „Machtübertragung“ an Adolf Hitler. Was diesem Tag folgte, muss hingegen als ein Prozess der „Machtergreifung“ bezeichnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Einleitung
- 2. „Machtergreifung“ und „Machtübertragung“?
- 3. Die Kontroverse
- 4. Die Entwicklung Deutschlands und des Nationalsozialismus bis zur „Machtübertragung“ am 30. Januar 1933
- 5. Die „Machtergreifung“ ab dem 30. Januar 1933
- 6. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ereignisse um den 30. Januar 1933 und die Frage, ob es sich bei der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler um eine Machtübertragung oder Machtergreifung handelte. Ziel ist es, die verschiedenen Argumentationslinien zu analysieren und die historische Entwicklung bis zu diesem Wendepunkt zu beleuchten. Die Arbeit wird auf die unterschiedlichen Interpretationen der Ereignisse eingehen und diese kritisch bewerten.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Machtergreifung“ und „Machtübertragung“
- Analyse der gegensätzlichen Interpretationen in der Geschichtsschreibung (BRD vs. DDR)
- Die Rolle der Weimarer Republik und ihrer Schwächen im Vorfeld des 30. Januar 1933
- Der Aufstieg der NSDAP und Hitlers Rolle im Prozess der Machtübernahme
- Bewertung der Ereignisse im Kontext der deutschen Geschichte und deren Relevanz für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach „Machtergreifung“ oder „Machtübertragung“ im Zusammenhang mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Definition und Abgrenzung der beiden Begriffe, die Analyse gegensätzlicher Argumentationslinien und die Beleuchtung der historischen Entwicklung beinhaltet. Die These, dass der 30. Januar 1933 den Tag der Machtübertragung an Hitler darstellt, während die nachfolgenden Ereignisse als Machtergreifungsprozess zu betrachten sind, wird formuliert.
2. „Machtergreifung“ und „Machtübertragung“?: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Machtergreifung“ und „Machtübertragung“. „Machtergreifung“ wird als illegitimes, gewaltsames oder gesetzeswidriges Erlangen der Macht beschrieben, im Gegensatz zur legalen „Machtübertragung“ im Rahmen verfassungsgemäßer Prozesse. Die Unterscheidung beider Begriffe bildet die Grundlage für die weitere Analyse.
3. Die Kontroverse: Das Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen in der BRD und DDR vor der Wiedervereinigung. In der DDR dominierte die These der Machtübertragung, während in der BRD lange Zeit die These der totalitären Machtergreifung Hitlers vorherrschte. Es werden verschiedene historische Interpretationen diskutiert, darunter die Ansichten von Karl Dietrich Bracher, der von einer „Machteroberung“ und einem „Machtvakuum“ spricht, und Guido Knopp, der den Machtwechsel als „Machterschleichung“ beschreibt. Die unterschiedlichen Perspektiven unterstreichen die Komplexität der Ereignisse und die anhaltende Debatte um deren Interpretation.
4. Die Entwicklung Deutschlands und des Nationalsozialismus bis zur „Machtübertragung“ am 30. Januar 1933: (Es fehlt der Text für dieses Kapitel im bereitgestellten Dokument, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
5. Die „Machtergreifung“ ab dem 30. Januar 1933: (Es fehlt der Text für dieses Kapitel im bereitgestellten Dokument, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Machtergreifung, Machtübertragung, Adolf Hitler, 30. Januar 1933, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Geschichtswissenschaft, BRD, DDR, Totalitarismus, Bonapartismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Machtergreifung" oder "Machtübertragung" Hitlers am 30. Januar 1933
Was ist der zentrale Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ereignisse um den 30. Januar 1933 und die Frage, ob Hitlers Ernennung zum Reichskanzler eine "Machtergreifung" oder eine "Machtübertragung" darstellte. Sie analysiert verschiedene Argumentationslinien und beleuchtet die historische Entwicklung bis zu diesem Wendepunkt.
Welche Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und grenzt die Begriffe "Machtergreifung" (illegitimes, gewaltsames oder gesetzeswidriges Erlangen der Macht) und "Machtübertragung" (legales Erlangen der Macht im Rahmen verfassungsgemäßer Prozesse) scharf voneinander ab. Diese Unterscheidung ist die Grundlage der weiteren Analyse.
Welche unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen in der BRD und DDR vor der Wiedervereinigung. In der DDR dominierte die These der "Machtübertragung", während in der BRD lange Zeit die These der totalitären "Machtergreifung" vorherrschte. Verschiedene historische Interpretationen, einschließlich der Ansichten von Bracher ("Machteroberung", "Machtvakuum") und Knopp ("Machterschleichung"), werden diskutiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von "Machtergreifung" und "Machtübertragung", der Analyse gegensätzlicher Interpretationen in der Geschichtsschreibung (BRD vs. DDR), der Rolle der Weimarer Republik und ihrer Schwächen, dem Aufstieg der NSDAP und Hitlers Rolle, sowie der Bewertung der Ereignisse im Kontext der deutschen Geschichte und deren Relevanz für die Gegenwart.
Welche Kapitel enthält die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung (mit der zentralen Forschungsfrage), zur Definition von "Machtergreifung" und "Machtübertragung", zur Kontroverse um die Interpretation der Ereignisse, zur Entwicklung Deutschlands und des Nationalsozialismus bis zum 30. Januar 1933, zur "Machtergreifung" ab dem 30. Januar 1933 und Schlussbetrachtungen. Leider sind die Kapitel 4 und 5 im bereitgestellten Dokument unvollständig.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Machtergreifung, Machtübertragung, Adolf Hitler, 30. Januar 1933, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Geschichtswissenschaft, BRD, DDR, Totalitarismus, Bonapartismus.
Welche These wird in der Einleitung formuliert?
Die These der Arbeit lautet, dass der 30. Januar 1933 den Tag der Machtübertragung an Hitler darstellt, während die nachfolgenden Ereignisse als Machtergreifungsprozess zu betrachten sind.
- Quote paper
- Ulrike Kassem (Author), 2002, Machtergreifung oder Machtübertragung? - Eine Kontroverse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47684