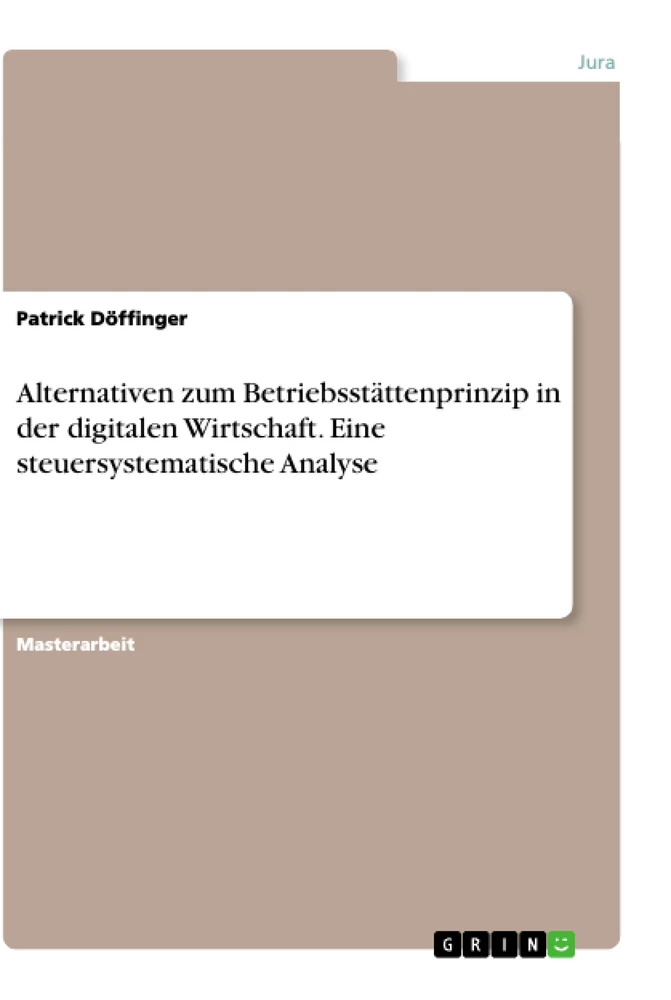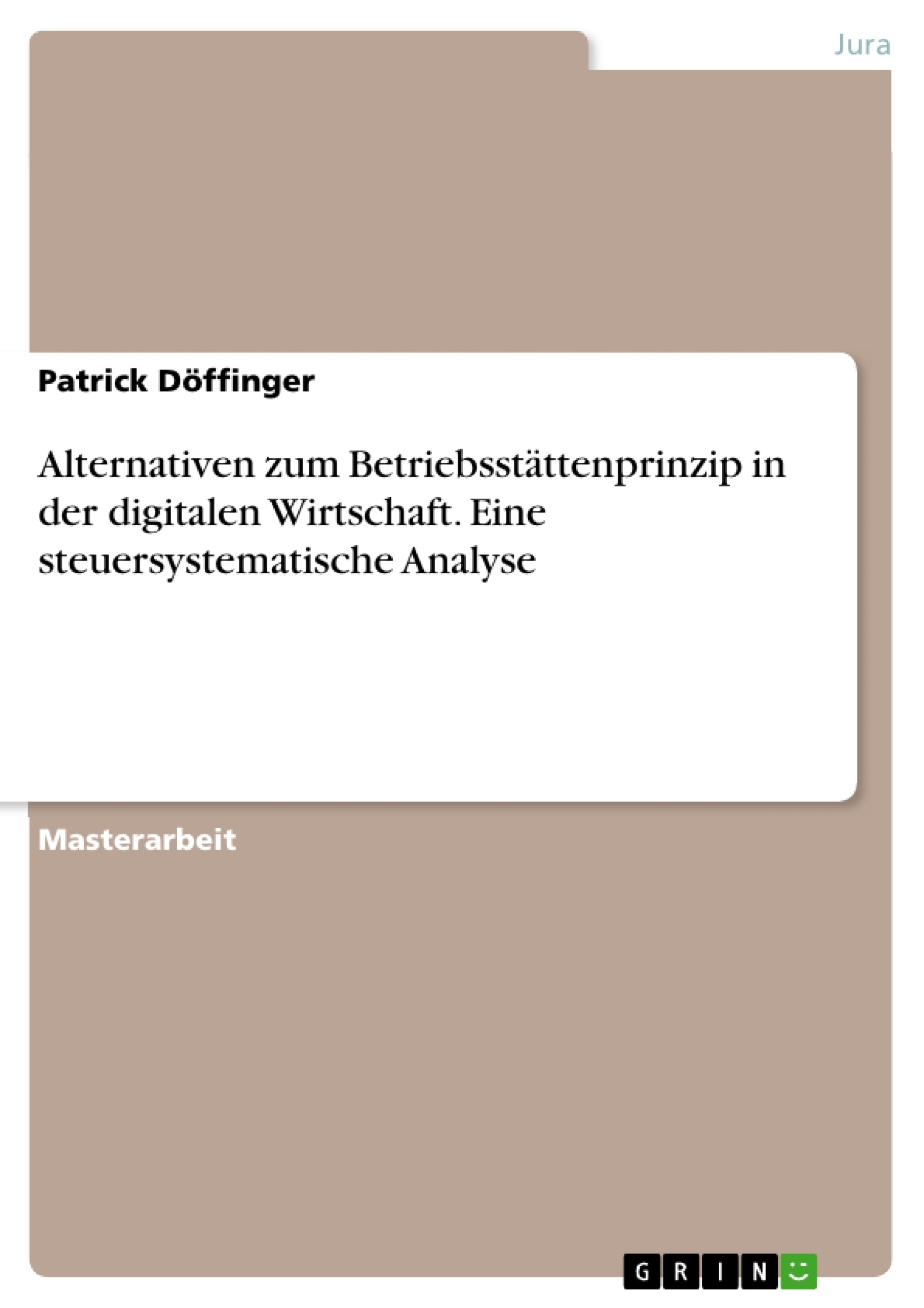Die folgende Abschlussarbeit geht der Frage nach, ob und in inwieweit die gültigen Besteuerungsprinzipien für Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung noch in der Lage sind, ihren Aufgaben nachzukommen, und ob mögliche Alternativen vorstellbar und umsetzbar sind.
Die Digitalisierung der gesamten analogen Wirtschaft ist in vollem Gange. Sie betrifft jeden Einzelnen und sorgt in allen Lebensbereichen für tiefgreifende Veränderungen. Die digitalen Veränderungen sorgen für mehr Lebensqualität, öffnen die Tür für revolutionäre Geschäftsmodelle und sorgen für ein noch effizienteres Wirtschaften. Im Moment sind bereits 20 Milliarden Geräte und Maschinen über das Internet vernetzt. Im Jahr 2030 werden es rund eine halbe Billion sein. Die digitale Wirtschaft wird daher immer mehr zu einem bedeutenden Wirtschaftssektor. Die Digitalisierung der wirtschaftlichen Prozesse erfasst somit beinahe jedes Unternehmen, in dem alte Geschäftsmodelle abgelöst und bestehende Strukturen aufgebrochen werden. Schließlich ist es für jedes Unternehmen mittlerweile von großer Bedeutung interessierte Internet-User auf die eigene Website zu locken und als Kunden zu gewinnen. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung werden nicht nur die bestehenden Strukturen der Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt, sondern auch die bisherigen Besteuerungsprinzipien, vor allem das traditionelle Betriebsstättenprinzip steht vor einer großen Belastungsprobe.
Heutzutage ist es den Unternehmen möglich durch die steigende Mobilität von Ressourcen, Nutzern und Geschäftsfunktionen, die Geschäftsaktivitäten in weltweit beliebige Orte zu verlagern und Geschäfte über das Internet abzuschließen. Folglich scheint das Betriebsstättenprinzip, das eine physische Präsenz, nämlich eine feste Geschäftseinrichtung im Quellenstaat voraussetzt, für die Besteuerung der digitalen Wirtschaft, überholt zu sein. Immaterielle Wirtschaftsgüter lassen sich, da diese keine körperlich greifbaren Gegenstände sind, ohne große Anstrengung hin und her verschieben. Aus fiskalischer Sicht stellt sich somit die Frage, ob bzw. inwieweit die traditionellen Anknüpfungsmerkmale wie z.B. eine feste Geschäftseinrichtung für die Feststellung der materiellen Steuerpflicht ihre Gültigkeit behalten können oder durch neue Kriterien ergänzt oder ersetzt werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Die digitale Wirtschaft
- 2.1 Begriff der digitalen Wirtschaft
- 2.2 Geschäftsmodelle der digitalen Wirtschaft
- 2.2.1 Beispiel Zalando
- 2.3 Merkmale der digitalen Wirtschaft
- 2.3.1 ,,Double Irish with a Dutch Sandwich”
- 2.3.2 Lehren und Konsequenzen aus dem Steuersparmodell der US-Konzerne
- 2.3.3 Auswirkungen der US-Steuerreform
- 3. Die Besteuerung der digitalen Wirtschaft
- 3.1 Definition und Ursachen des BEPS-Projektes
- 3.2 Der Aktionsplan der OECD gegen BEPS
- 3.2.1 Country-by-Country Reporting
- 3.3 Immaterielle Wirtschaftsgüter
- 3.3.1 Verrechnungspreisproblematik bei immateriellen Wirtschaftsgütern
- 3.3.2 Lizenzschranke
- 4. Kritische Analyse des geltenden Besteuerungssystems
- 4.1 Bedeutung und Problematik des Betriebsstättenprinzips bei der Besteuerung der digitalen Wirtschaft
- 4.2 Betriebsstätte nach nationalem Recht
- 4.2.1 Haupttatbestand feste Geschäftseinrichtung
- 4.2.2 Definition im Abkommensrecht Art. 5 OECD-MA
- 4.3 Die Serverbetriebsstätte
- 4.3.1 Cloud Computing
- 4.4 Die Vertreterbetriebsstätte
- 4.4.1 Der ständige Vertreter
- 4.4.2 Der Server und die Website
- 5. Alternativen zum traditionellen Betriebsstättenprinzip
- 5.1 Aktuelle Reformbestrebungen auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft
- 5.1.1 Ausweitung der Besteuerung im Quellenstaat
- 5.1.2 Zwischenlösung einzelner Länder
- 5.1.3 Zwischenlösung der EU-Kommission lautet Digitalsteuer
- 5.1.4 Einführung der signifikanten virtuellen Präsenz
- 5.1.5 Quellensteuer
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterthesis befasst sich mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft und analysiert die bestehenden Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Betriebsstättenprinzip. Der Fokus liegt auf der Suche nach geeigneten Alternativen zum traditionellen Betriebsstättenprinzip, um eine gerechtere und effektivere Besteuerung von digitalen Unternehmen zu ermöglichen.
- Die Entwicklung der digitalen Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf das Besteuerungssystem.
- Die Problematik des Betriebsstättenprinzips in der digitalen Wirtschaft.
- Die Reformbestrebungen der OECD und der EU im Bereich der digitalen Wirtschaft.
- Verschiedene Alternativen zum Betriebsstättenprinzip, darunter Quellensteuer, Digitalsteuer und die Einführung der signifikanten virtuellen Präsenz.
- Die steuerliche Behandlung von immateriellen Wirtschaftsgütern und die Bedeutung von Verrechnungspreisen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung der Besteuerung der digitalen Wirtschaft vor und zeigt auf, warum das traditionelle Betriebsstättenprinzip in diesem Kontext nicht mehr zeitgemäß ist. Im zweiten Kapitel wird die digitale Wirtschaft definiert und anhand von Geschäftsmodellen und Merkmalen erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der Besteuerung der digitalen Wirtschaft, insbesondere den Ursachen und Zielen des BEPS-Projekts. Es werden auch die immateriellen Wirtschaftsgüter und die damit verbundene Verrechnungspreisproblematik behandelt. Kapitel 4 analysiert kritisch das bestehende Besteuerungssystem und die Anwendung des Betriebsstättenprinzips auf die digitale Wirtschaft. Abschließend werden in Kapitel 5 alternative Besteuerungsmodelle vorgestellt, die speziell auf die digitalen Geschäftsmodelle zugeschnitten sind.
Schlüsselwörter
Digitale Wirtschaft, Betriebsstättenprinzip, BEPS, OECD, EU, Digitalsteuer, Quellensteuer, immaterielle Wirtschaftsgüter, Verrechnungspreise, signifikante virtuelle Präsenz, Steuerreform.
Häufig gestellte Fragen
Warum steht das traditionelle Betriebsstättenprinzip in der Kritik?
Das Prinzip setzt eine physische Präsenz voraus. Da digitale Unternehmen ihre Geschäfte weltweit ohne feste Geschäftsstellen abwickeln können, entgehen den Staaten, in denen die Wertschöpfung stattfindet, Steuereinnahmen.
Was ist das Ziel des BEPS-Projekts der OECD?
BEPS steht für „Base Erosion and Profit Shifting“. Ziel ist es, internationale Steuerregeln so anzupassen, dass Gewinne dort besteuert werden, wo die wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet, um Gewinnverlagerungen zu verhindern.
Welche Alternativen zum Betriebsstättenprinzip werden diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem die Einführung einer Digitalsteuer, eine Quellensteuer auf digitale Transaktionen sowie das Konzept der „signifikanten virtuellen Präsenz“.
Was versteht man unter einer „signifikanten virtuellen Präsenz“?
Dieses Konzept sieht vor, eine Steuerpflicht an digitalen Merkmalen wie Nutzerzahlen oder dem Volumen digitaler Verträge festzumachen, anstatt an einer physischen Einrichtung.
Welche Rolle spielen immaterielle Wirtschaftsgüter bei der Steuervermeidung?
Da Patente und Lizenzen körperlich nicht greifbar sind, können sie leicht in Niedrigsteuerländer verschoben werden, um dort Gewinne steuerschonend zu verbuchen.
- Quote paper
- Patrick Döffinger (Author), 2019, Alternativen zum Betriebsstättenprinzip in der digitalen Wirtschaft. Eine steuersystematische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/476807