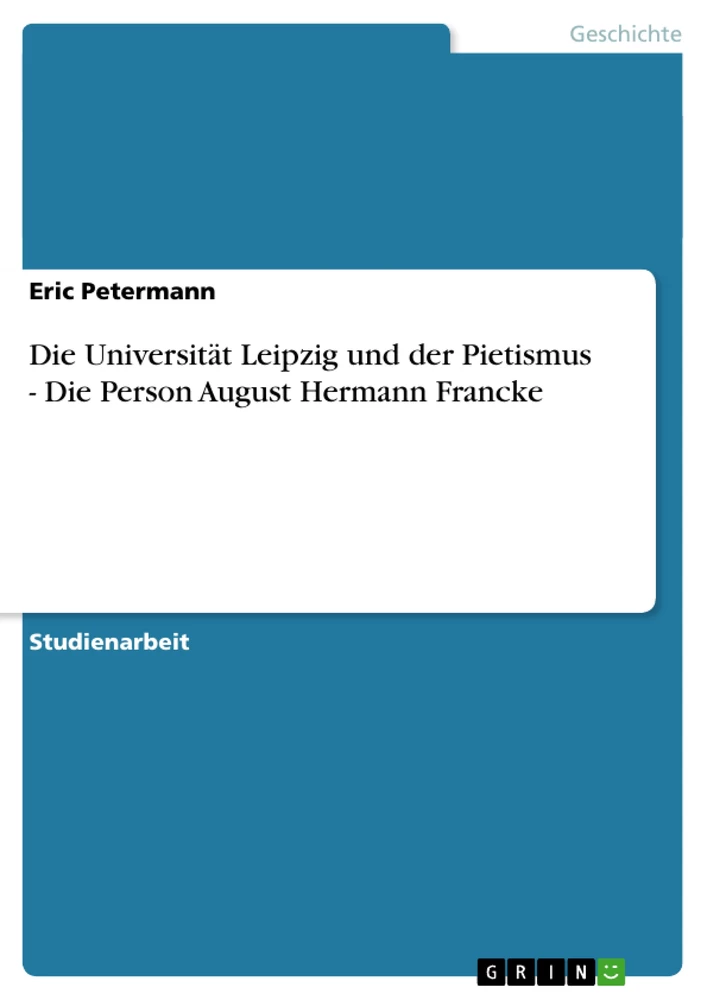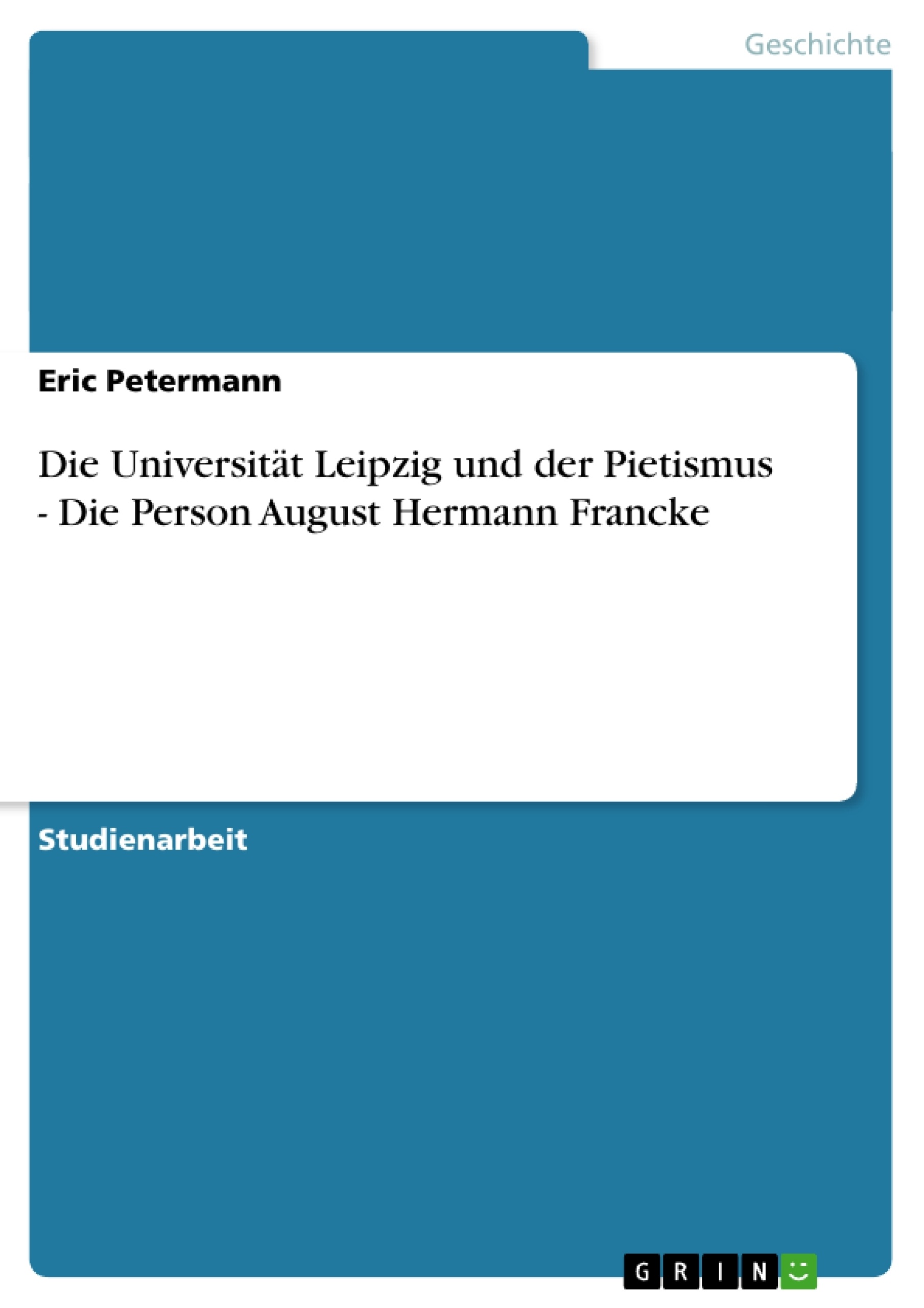Nachdem die Reformation im 16. Jh. für eine Glaubensspaltung innerhalb des Christentums sorgte, wurde bereits einige Jahrzehnte später oftmals ein „praktischer Atheismus“ beklagt. Johann Arndt rief zur „praxis pietatis“, einer gelebten Frömmigkeit, auf. Aus dem Wunsch nach einem praktischen Christentum mit regem Gebetsleben um dadurch zu wahrer Frömmigkeit zu gelangen entstand der Pietismus.
Der Kirchenhistoriker Martin Brecht sieht im Pietismus die „bedeutendste Frömmigkeitsbewegung des Protestantismus nach der Reformation“ Dabei stellte der mitteldeutsche Raum um Leipzig und Halle, somit auch die Universität Leipzig, ein Zentrum dar. Die wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser religiösen Strömung waren Philipp Jakob Spener und August Hermann Francke. Spener selbst war zwar nicht in Leipzig oder Halle aktiv, dennoch beeinflusste er diese beiden Städte durch seine Tätigkeit als Mitglied des Oberkonsistoriums in Dresden und in Berlin. Franckes Wirken soll Gegenstand dieser Untersuchung sein, wobei das Hauptaugenmerk auf seiner Zeit an der Leipziger Universität liegen wird (1684 – 1687 und 1689). Hier gründete Francke mit dem „Collegium Philobiblicum“ eine theologische Versammlung, die rasch an Mitgliedern und Bedeutung gewann und somit für die gesamte pietistische Bewegung von Bedeutung war.
Einen weiteren Schwerpunkt soll Franckes „Bekehrung“ mit den Vorstufen „Dämmerung“ und „Durchbruch“, typische Stadien auf dem Weg zum wahren Glauben im Pietismus, darstellen.
Es soll geklärt werden, wodurch der Pietismus charakterisiert ist und auf welche Art und Weise Francke Anhänger gewann. Inwieweit unterschied sich das „Collegium Philobiblicum“ von anderen Collegien und weshalb erfreute es sich bei den Teilnehmern rasch wachsender Beliebtheit? Was machte Francke für die Universität und die Kirche so gefährlich, dass er 1689 Vorlesungsverbot erhielt und 1690 ein Verbot über jede Art von pietistischen Versammlungen erging? Was ist das Vermächtnis von August Hermann Francke?
Als Hauptquelle dienten die Lebensläufe August Hermann Franckes. Diese bestehen aus dem Lebenslauff, von Francke im Alter von 27 Jahren selbst geschrieben, der die Jahre 1663 bis 1687 umfasst, und der Kurtze[n] Nachricht, die anlässlich seines Todes verfasst wurde. Vor allem der Erstgenannte liefert einen sehr genauen Einblick in Franckes persönliche religiöse Entwicklung und bietet detaillierte Informationen zu den Leipziger Geschehnissen.
Inhaltsverzeichnis
- Pietismus, August Hermann Francke und die Universität Leipzig - Eine kurze Einführung...
- Pietismus - die neue Frömmigkeitsbewegung...
- August Hermann Francke
- Franckes Zeit vor der Universität Leipzig - Kindheit, Jugendalter und studentische Anfänge...
- Franckes Wirken an der Universität Leipzig
- Die Jahre 1684 - 1687...
- „Bekehrung“ und „Wiedergeburt“..
- Studium in Hamburg und Aufenthalt bei Spener...........
- Francke als Dozent in Leipzig - das Jahr 1689...
- Pietistische Unruhen und Vorlesungsverbot.....
- Franckes weiterer Werdegang.....
- Zusammenfassende Betrachtung..
- Abbildungen........
- Quellenverzeichnis…
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung befasst sich mit August Hermann Francke und seiner Zeit an der Universität Leipzig. Der Fokus liegt dabei auf dem Einfluss des Pietismus auf die Universität und die Rolle Franckes innerhalb dieser Bewegung.
- Der Pietismus als neue Frömmigkeitsbewegung im Kontext der Reformation
- August Hermann Francke und seine „Bekehrung“ mit den Stadien „Dämmerung“ und „Durchbruch“
- Das „Collegium Philobiblicum“ als Plattform pietistischer Versammlungen und seine Bedeutung für die Bewegung
- Die Konflikte zwischen Francke und den Leipziger Universitätsbehörden und die Gründe für das Vorlesungsverbot 1689
- Das Vermächtnis von August Hermann Francke für die Universität und die Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in den Pietismus als neue Frömmigkeitsbewegung, die im 17. Jahrhundert als Reaktion auf den „praktischen Atheismus“ entstand. Es wird auch auf die zentrale Rolle des Pietismus in der mitteldeutschen Region, insbesondere in Leipzig und Halle, hingewiesen.
Kapitel 2 beschreibt die Ursprünge des Pietismus, der sich vom lateinischen Wort „pietas“ ableitet und die geistliche Erneuerung der Kirche zum Ziel hatte. Der Pietismus stand im Gegensatz zur lutherischen Orthodoxie und betonte ein praktisches Christentum, das sich in Frömmigkeit und Nächstenliebe äußern sollte.
Kapitel 3 befasst sich mit der Persönlichkeit August Hermann Franckes, insbesondere mit seiner Zeit an der Universität Leipzig. Hier werden Franckes „Bekehrung“ und die damit verbundenen Stadien „Dämmerung“ und „Durchbruch“ sowie die Gründung des „Collegium Philobiblicum“ behandelt.
Das Kapitel 4 untersucht die Konflikte zwischen Francke und den Leipziger Universitätsbehörden, die zu einem Vorlesungsverbot für Francke im Jahr 1689 führten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Begriffen Pietismus, August Hermann Francke, Universität Leipzig, „Bekehrung“, „Collegium Philobiblicum“, Frömmigkeit, Reformation, Lutherische Orthodoxie, „Dämmerung“, „Durchbruch“ und Vorlesungsverbot.
- Citar trabajo
- Eric Petermann (Autor), 2005, Die Universität Leipzig und der Pietismus - Die Person August Hermann Francke, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47663