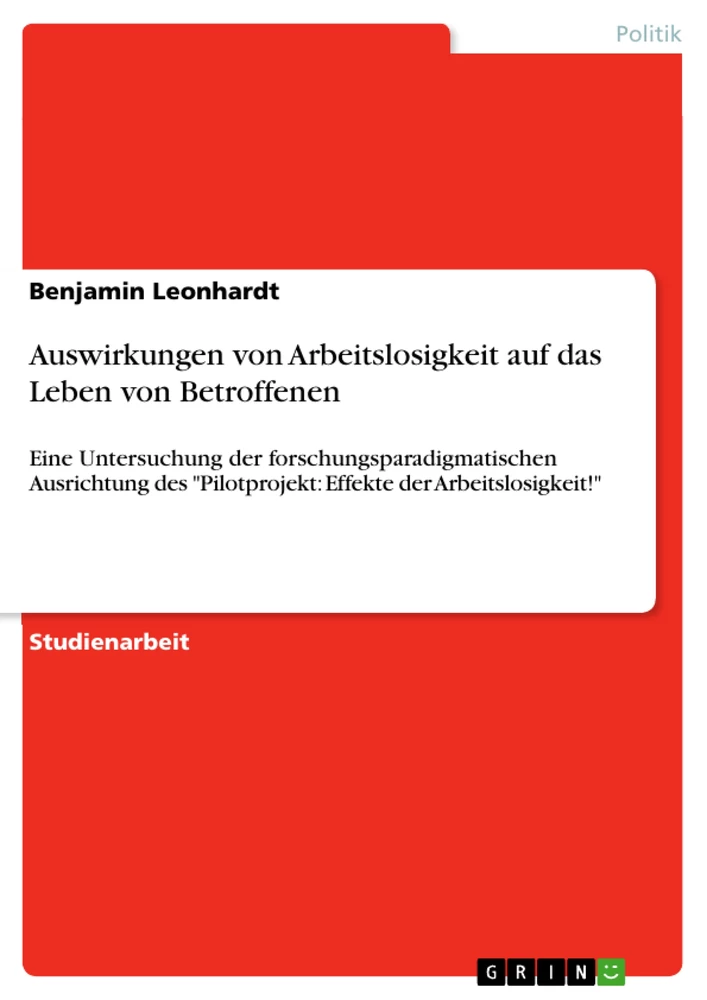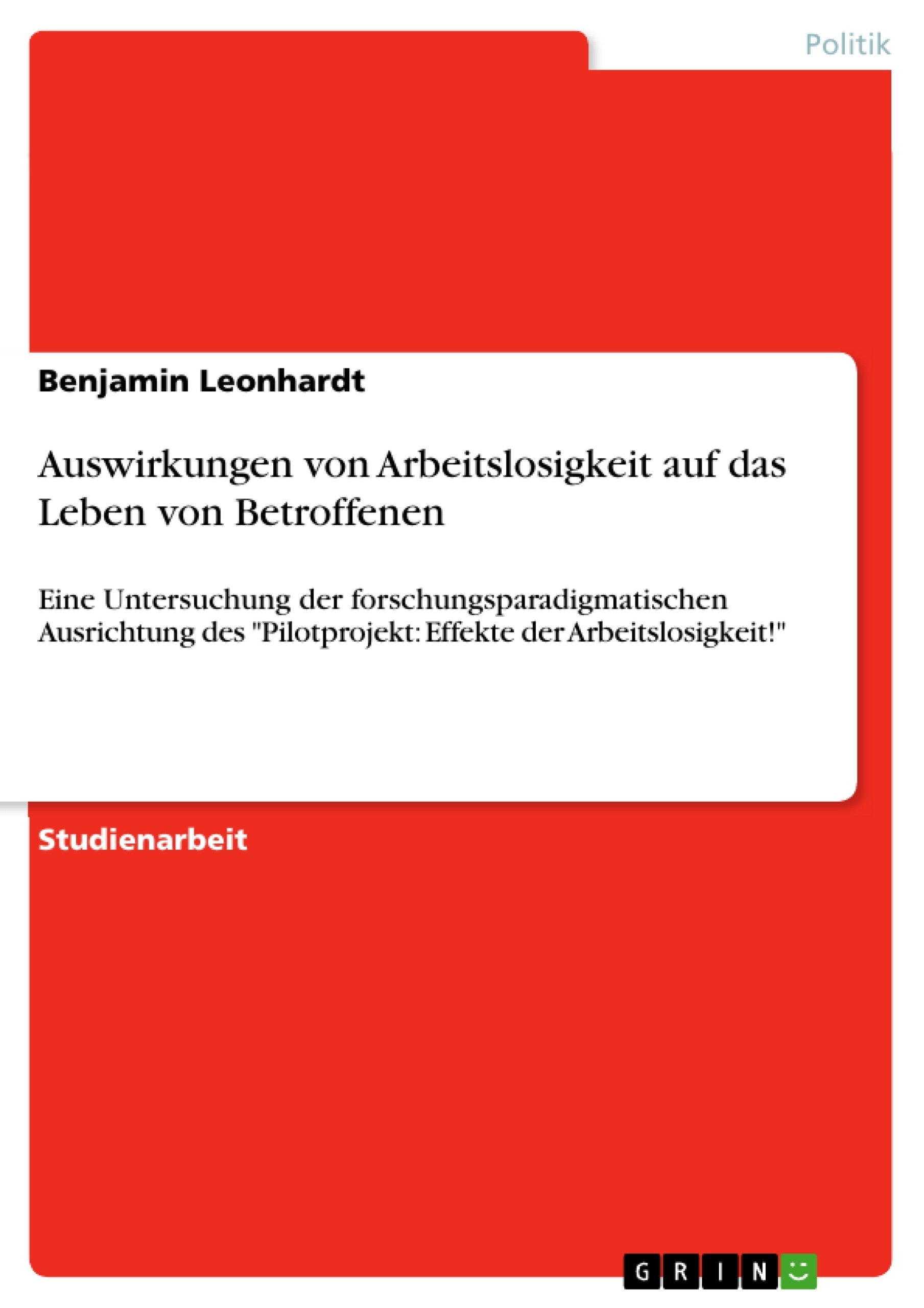„Nichts beeinträchtigt Menschen so sehr wie Arbeitslosigkeit – selbst wenn sie wieder einen Job gefunden haben.“ (Seils 2008). So zitiert „Zeit online“ den Sozialforscher Gert Wagner in einem Interview aus dem Jahre 2008. Laut dem Sozialwissenschaftler gibt es keine anderen sozioökonomischen Faktoren, welche die Lebenszufriedenheit von Menschen so negativ und langfristig beeinflussen wie der Verlust des Arbeitsplatzes. Diese Aussagen spiegeln die Bedeutung von Arbeitslosigkeit im Leben von Menschen und auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung sehr prägnant wider. Auch wenn die Arbeitslosenzahlen in Deutschland in den letzten Jahren immer weiter sinken (von 4,86 Mio. 2005 auf 2,34 Mio. 2018) spielt das Phänomen der Arbeitslosigkeit auch heutzutage immer noch eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Diskurs; der Politik und auch in der Wissenschaft.
In der Sozialwissenschaft beschäftigt sich die Arbeitslosigkeitsforschung mit dem Phänomen der Arbeitslosigkeit und deren Auswirkungen auf betroffene Personen. Dieses Forschungsfeld hat bereits eine lange Tradition und blickt auf vielfältige Untersuchungen zurück. „Die Arbeitslosen von Marienthal - Ein soziographischer Versuch über die Wirkung langandauernder Arbeitslosigkeit“ von Marie Johada, Paul Lazersfeld und Hans Zeisel, welche bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Folgen des Arbeitsplatzverlustes wissenschaftlich und systematisch untersuchten, kann sicherlich als einer der Grundsteine dieses Forschungsfeldes bezeichnet werden.
Ziel meiner Arbeit ist es in diesem Zusammenhang, zwei Dinge zu untersuchen. Zum einen soll es darum gehen, die Auswirkungen und Folgen von Arbeitslosigkeit, welche in der 2009 erschienenen Studie: „Pilotprojekt: Effekte der Arbeitslosigkeit“ der Universität Wien, zu Tage gebracht werden konnten, darzustellen. Zum anderen möchte ich die Grundüberzeugungen der beteiligten Forscher und Forscherinnen um Projektleiterin Sylvia Kritzinger, näher untersuchen und versuchen herauszufinden, welches Paradigma (qualitativ oder quantitativ) in dieser Studie vertreten wird. Zudem soll analysiert werden, inwieweit sich dieses Projekt dem zugrunde gelegten Paradigma konsistent verhält, oder ob Abweichungen von den Grundannahmen der gewählten Forschungsrichtung bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das quantitative Paradigma im Vergleich mit dem qualitativen Paradigma
- Exkurs: Doppelspaltexperimente – Entstehung und Hintergründe beider Forschungsparadigmen
- Grundlagen quantitativer Forschung
- Grundlagen qualitativer Forschung
- Der qualitative Charakter des „Pilotprojekt: Effekte der Arbeitslosigkeit“
- Zusammenfassung der vorliegenden Studie
- Überblick der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen der Forschungsarbeit
- Die paradigmatische Ausrichtung und Konsistenz der Studie
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Betroffene, basierend auf der Studie „Pilotprojekt: Effekte der Arbeitslosigkeit“ der Universität Wien (2009). Die Zielsetzung ist zweigeteilt: Erstens soll die Studie hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Schlussfolgerungen bezüglich der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit analysiert werden. Zweitens soll die paradigmatische Ausrichtung der Studie, insbesondere im Hinblick auf die Grundannahmen der quantitativen und qualitativen Forschung, untersucht werden. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, inwieweit das Projekt dem gewählten Paradigma konsequent folgt oder ob Abweichungen von den Grundannahmen bestehen.
- Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Betroffene
- Quantitative vs. qualitative Forschungsansätze
- Paradigmatische Ausrichtung des „Pilotprojekts: Effekte der Arbeitslosigkeit“
- Konsistenz des Projekts in Bezug auf die gewählte Forschungsrichtung
- Analyse der Studie und Vergleich mit den Grundannahmen der beiden Paradigmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Relevanz der Arbeitslosigkeitsforschung und stellt den Kontext der Studie "Pilotprojekt: Effekte der Arbeitslosigkeit" dar. Es werden die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Lebenszufriedenheit von Menschen sowie die aktuellen gesellschaftlichen Debatten um die Thematik beleuchtet.
- Das quantitative Paradigma im Vergleich mit dem qualitativen Paradigma: Dieser Abschnitt dient der Einführung der beiden Forschungsrichtungen, der quantitativen und qualitativen Sozialforschung. Er beleuchtet deren Grundannahmen, Methoden und Weltsichten. Zudem wird ein Exkurs über die „Doppelspaltexperimente“ durchgeführt, um die Entstehung und Hintergründe beider Paradigmen zu erläutern.
- Der qualitative Charakter des „Pilotprojekt: Effekte der Arbeitslosigkeit“: In diesem Kapitel wird die Studie „Pilotprojekt: Effekte der Arbeitslosigkeit“ hinsichtlich ihres Inhalts, der wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen vorgestellt. Es wird untersucht, ob die Studie qualitative oder quantitative Forschungsansätze verfolgt und ob die Ergebnisse den Grundannahmen des gewählten Paradigmas entsprechen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Arbeitslosigkeit, qualitative und quantitative Forschung, Forschungsmethoden, Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Betroffene, Lebensqualität, soziale und wirtschaftliche Folgen, paradigmatische Ausrichtung, Konsistenz von Forschungsprojekten. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Studie „Pilotprojekt: Effekte der Arbeitslosigkeit“ und deren Einordnung in das jeweilige Forschungsparadigma.
- Quote paper
- Benjamin Leonhardt (Author), 2019, Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf das Leben von Betroffenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/475260