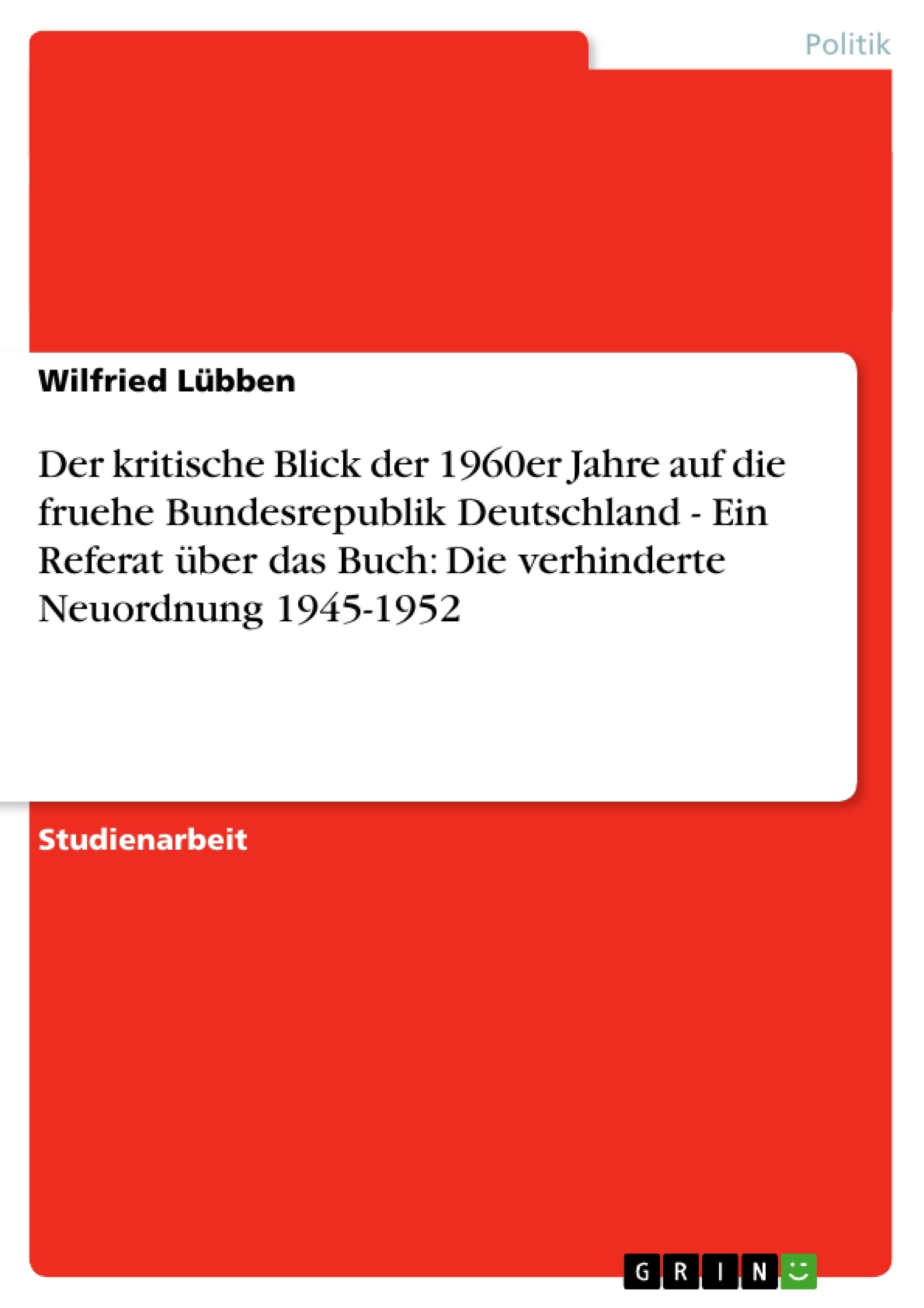Die ersten Ansätze gewerkschaftlicher Tätigkeit kamen noch vor der offiziellen Kapitulation. Laut Eisenhower sollten sich die deutschen Arbeiter sofort , sobald es die Umstände erlaubten, zu demokratischen Gewerkschaften zusammenschließen dürfen. Noch bevor die Besatzungsmächte eingreifen konnten regenerierte sich das gewerkschaftliche Leben auf örtlicher Ebene. In mindestens 29 Städten wurden Gewerkschaftsveranstaltungen abgehalten. Die Betriebsräte waren die Hauptträger und übten damals einen besonders großen Einfluss aus. Die generelle Auseinandersetzung um die Organisationsform, bildete das Zentralproblem der frühen deutschen Gewerkschaftsgeschichte. Sie war der Hauptkonfliktpunkt zwischen den Besatzungsmächten und den Gewerkschaften, aber auch innerhalb der Gewerkschaften selbst.
Breiter Konsens innerhalb der Arbeiterbewegung herrschte über das Ziel einer einheitlichen Gewerkschaftsbewegung, als zwingende Konsequenz aus den Erfahrungen der faschistischen Ära. Die organisatorische Zersplitterung in Richtungsgewerkschaften in der Weimarer Republik wurde durchgängig als eine der Ursachen für die historische Niederlage der Arbeiterbewegung 1933 angesehen. Jedoch traten bereits mit Beginn der Planungen für die Neugründung der Gewerkschaften unterschiedliche Auffassungen über die innere Struktur einer angestrebten Einheitsgewerkschaft zutage. Zwei Konzeptionen bestimmten in dieser Frage die Diskussion:
a.) eine zentralistische Einheitsgewerkschaft, mit nach Industriezweigen gegliederten Abteilungen, ohne autonome Rechte und
b.) eine Einheitsgewerkschaft als Dachverband, als Zusammenschluss weitgehend autonomer Einzelgewerkschaften.
Die Alliierte Zielsetzung in der Bildung der Gewerkschaften bestand darin:
1. Die Bildung freier Gewerkschaften in ganz Deutschland.
2. Sich zu vergewissern, dass die Schaffung freier Gewerkschaften das Ergebnis freiheitlichen Selbstgefühls und Initiative ist, die sich in den grundlegenden Stadien , das heißt bei den Arbeitern selbst, entwickeln.
3. Den Gewerkschaften volle Entwicklungs- und Handlungsfreiheit zu gewähren, vorausgesetzt, dass sich ihre Tätigkeit nicht gegen die alliierten Behörden richtet.1
Inhaltsverzeichnis
- Der Zerfall der Alliierten Kriegskoalition und die Auseinandersetzungen um eine Neuordnung der Wirtschafts- und Betriebsverfassung in den Westzonen (1945 – 1947)
- Das Wiederentstehen von Betriebsvertretungen und Gewerkschaften nach der Kapitulation unter der Kontrolle der alliierten Besatzungsmächte
- Die Maßnahmen der Alliierten zur Neuordnung der deutschen Wirtschaft und die Forderungen der Gewerkschaften nach Sozialisierung und Wirtschaftsdemokratie
- Eine Bilanz der gewerkschaftlichen Situation am Ende der ersten Phase
- Die Zurückdrängung der gewerkschaftlichen Forderungen nach einer Neuordnung der Wirtschaft unter dem Druck des sich verschärften Ost-West-Konflikts (1947 – 1949)
- Die Verschärfung des kalten Krieges zwischen den Großmächten vom scheitern der Moskauer Konferenz bis zur Gründung deutscher Separatstaaten
- Die Zustimmung der Gewerkschaften zum Marshallplan und die Folgen für die gesamtdeutsche Gewerkschaftseinheit
- Die Wiederherstellung der liberalen Wettbewerbswirtschaft und der Widerstand der Arbeitnehmer und Gewerkschaften
- Die Situation der Gewerkschaften bei ihrem Zusammenschluss zum Deutschen Gewerkschaftsbund
- Das Scheitern der gewerkschaftlichen Bemühungen um eine Neuordnung der Wirtschafts- und Betriebsverfassung nach der Wiederherstellung der alten Besitz- und Machtverhältnisse (1949 – 1952)
- Der Kritische Blick der 60er auf die Nachkriegszeit und ein Blick auf die Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der deutschen Gewerkschaftsbewegung in der unmittelbaren Nachkriegszeit von 1945 bis 1952 und untersucht dabei, inwiefern die gewerkschaftlichen Bemühungen um eine Neuordnung der Wirtschafts- und Betriebsverfassung durch die Alliierten und den sich verschärfenden Ost-West-Konflikt verhindert wurden.
- Der Wiederaufbau der Gewerkschaften in den Westzonen unter alliierter Kontrolle
- Die Rolle der Besatzungsmächte bei der Gestaltung der deutschen Wirtschaftspolitik
- Die gewerkschaftlichen Forderungen nach Sozialisierung und Wirtschaftsdemokratie
- Der Einfluss des Ost-West-Konflikts auf die deutsche Gewerkschaftsbewegung
- Das Scheitern der gewerkschaftlichen Bemühungen um eine grundlegende Neuordnung der Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Entstehung der Gewerkschaften in den Westzonen nach der Kapitulation. Es beleuchtet die Herausforderungen und Konflikte, die sich aus der alliierten Kontrolle und der unterschiedlichen Interessen der Besatzungsmächte ergaben.
Kapitel zwei beleuchtet die Eskalation des Kalten Krieges und dessen Einfluss auf die gewerkschaftliche Entwicklung. Es werden die Zustimmung der Gewerkschaften zum Marshallplan und die Auswirkungen auf die gesamtdeutsche Gewerkschaftsbewegung dargestellt.
Das dritte Kapitel analysiert das Scheitern der gewerkschaftlichen Bemühungen um eine Neuordnung der Wirtschaft und die Gründe für die Etablierung der alten Besitz- und Machtverhältnisse.
Schlüsselwörter
Gewerkschaftsbewegung, Nachkriegszeit, Westdeutschland, Alliierte, Besatzungsmächte, Sozialisierung, Wirtschaftsdemokratie, Ost-West-Konflikt, Marshallplan, Betriebsverfassung, Neuordnung.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstanden die deutschen Gewerkschaften nach 1945 neu?
Noch vor der offiziellen Kapitulation regenerierte sich das gewerkschaftliche Leben auf örtlicher Ebene. Betriebsräte waren die Hauptträger dieser frühen Initiative, oft bevor die Besatzungsmächte eingriffen.
Was war der Hauptkonflikt bei der Organisationsform der Gewerkschaften?
Es gab zwei Konzepte: eine zentralistische Einheitsgewerkschaft ohne autonome Rechte der Abteilungen vs. eine Einheitsgewerkschaft als Dachverband autonomer Einzelgewerkschaften.
Welche Rolle spielten die Alliierten beim Wiederaufbau?
Die Alliierten erlaubten die Bildung freier Gewerkschaften, sofern diese aus eigenem Antrieb entstanden und sich nicht gegen die Besatzungsbehörden richteten.
Warum scheiterten die Forderungen nach Sozialisierung der Wirtschaft?
Durch den sich verschärfenden Ost-West-Konflikt und den Druck zur Wiederherstellung einer liberalen Wettbewerbswirtschaft (Marshallplan) wurden radikale Neuordnungspläne zurückgedrängt.
Was bedeutete der Marshallplan für die Gewerkschaftseinheit?
Die Zustimmung zum Marshallplan vertiefte die Spaltung zwischen den Gewerkschaften in den Westzonen und der sowjetischen Zone, was letztlich das Ende der gesamtdeutschen Gewerkschaftseinheit einleitete.
- Arbeit zitieren
- Wilfried Lübben (Autor:in), 2002, Der kritische Blick der 1960er Jahre auf die fruehe Bundesrepublik Deutschland - Ein Referat über das Buch: Die verhinderte Neuordnung 1945-1952, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47476