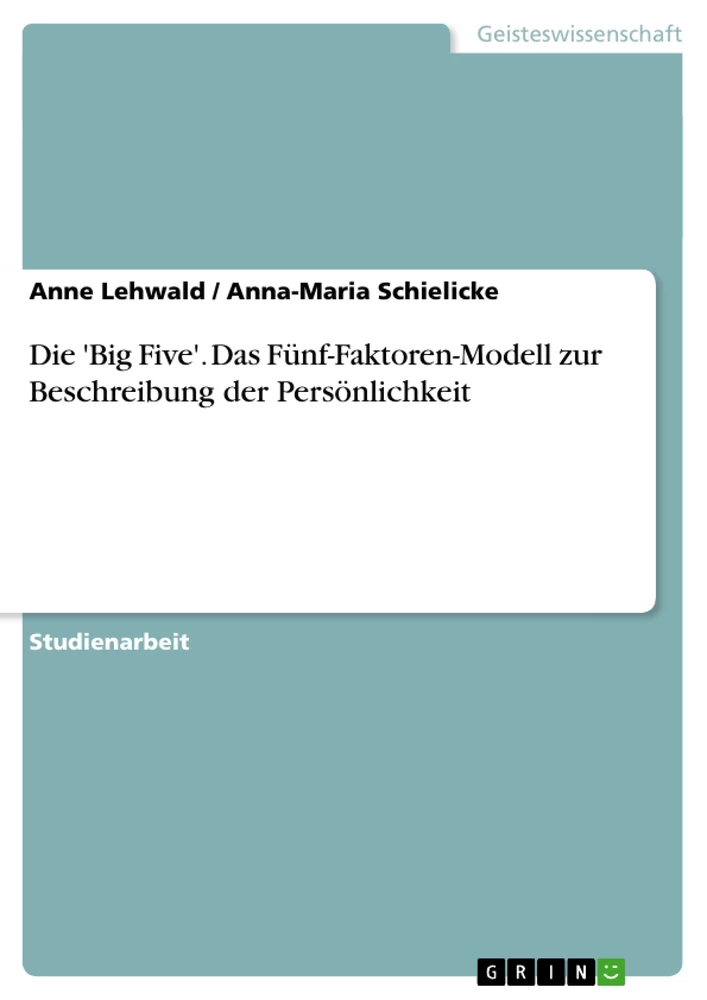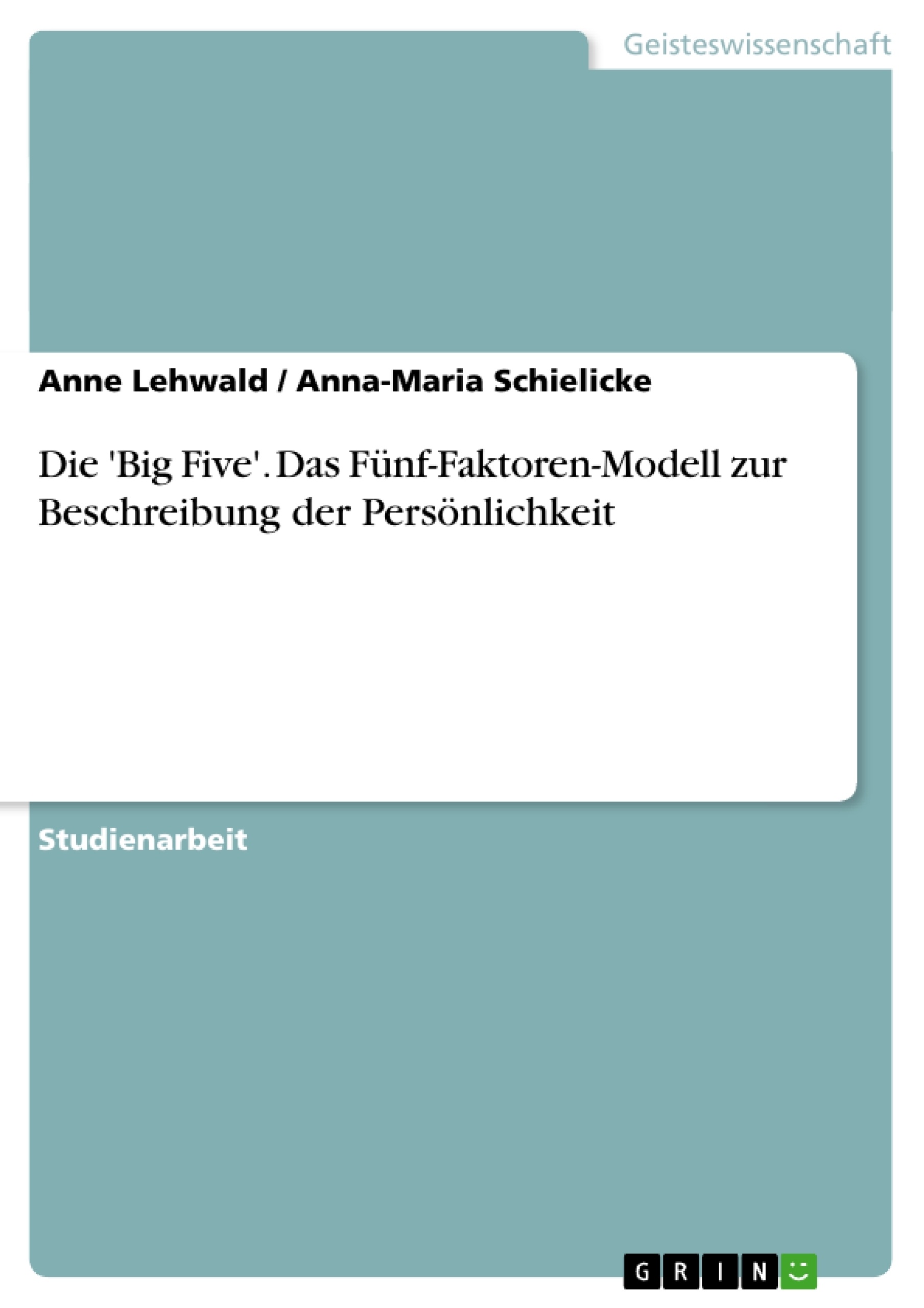„Die Persönlichkeit ist unerforschlich“, behauptete der Dichter Johann Wolfgang von Goethe im ausgehenden 18. Jahrhundert. Dennoch versuchen sich bis heute zahlreiche Psychologen an der Lösung just dieser Aufgabe: Die Persönlichkeit des Menschen zu erforschen und sie zu beschreiben. In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts dominierte allerdings der Eindruck, dass fünfzig Jahre faktorenanalytischer Persönlichkeitsforschung nur ein Bild der Verwirrung erbracht hätten (Amelang & Bartussek 1997, S. 360).
Uneinigkeit unter den Persönlichkeitsforschern herrschte vor allem in den Punkten, wie viele und welche Faktoren eine umfassende Beschreibung der Persönlichkeit ermöglichen. Zu Beginn der neunziger Jahre bildete sich schließlich ein gewisser Konsens darüber, dass fünf Faktoren eine umfassende Beschreibung der Persönlichkeit liefern (Zimbardo 1999, S. 524). Dieses Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitsbeschreibung, das auch als „Big Five“ bezeichnet wird, ist ein deskriptives Modell, das faktorenanalytisch entwickelt wurde. Befürworter dieses Modells behaupten, dass es die wichtigsten Dimensionen individueller Unterschiede beschreibt und einen organisatorischen Rahmen für die Persönlichkeitsforschung bildet (Cloninger 1996, S. 88).
Im Rahmen dieser Arbeit möchten wir die Entwicklung des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit referieren sowie die fünf Dimensionen der Persönlichkeitsbeschreibung erläutern. Einige der Messinstrumente, mit deren Hilfe, individuelle Merkmalsausprägungen jener fünf Faktoren erhoben werden können, werden vorgestellt. Gesondert wollen wir auf die Anwendungsbereiche des häufig verwandten NEO-Fünf-Faktoren Inventars von Paul Costa und Robert McCrae eingehen und dabei auch auf mögliche Probleme hinweisen. Einen Großteil unserer Literaturarbeit nimmt die Kritik an den „Big Five“ ein, die schlussendlich dazu führte, dass aktuell vermeintlich umfassendere Modelle zur Beschreibung der Persönlichkeit diskutiert werden. Darunter das Zwei-Faktoren-Modell „Big Two“, das Vier-Plus-X-Faktoren Modell „FPX“ sowie diverse andere Sechs- und Sieben-Faktoren-Lösungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Genese der „Big Five“
- Der lexikalische Ansatz
- Unübersichtlichkeit im Untersuchungsfeld
- Die „Big Five“ in Fragebogenstudien
- Exkurs: Faktorenanalyse
- Die (?) „Big Five“
- Uneinigkeit trotz Replizierbarkeit
- Korrelationen zwischen den „Big Five“
- Exkurs: Der Faktor V
- Messinstrumente
- Adjektivlisten und Fragebögen
- Exkurs: Vom NEO über den NEO-PI-(R) zum NEO-FFI
- Anwendungsbereiche des „,NEO-Fünf-Faktoren Inventars“ (NEO-FFI) von Paul Costa und Robert McCrae
- Kritik an den „,Big Five“
- Kritik am lexikalischen Ansatz
- Einige Kritik- und Diskussionspunkte am Fünf-Faktoren-Modell
- Aktuelle Forschungsergebnisse: „Beyond the Big Five“
- „Big Two“, „Big Six“ und „FPX“-Modell
- Exkurs: Das HEXACO-Modell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitsbeschreibung, auch bekannt als „Big Five“. Ziel ist es, die Entwicklung dieses Modells darzulegen, die fünf Dimensionen der Persönlichkeitsbeschreibung zu erläutern und gängige Messinstrumente vorzustellen. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Anwendungsbereiche des NEO-Fünf-Faktoren Inventars von Paul Costa und Robert McCrae und geht auf Kritikpunkte ein, die zur Diskussion weiterer Modelle wie dem Zwei-Faktoren-Modell „Big Two“ oder dem Vier-Plus-X-Faktoren Modell „FPX“ führten.
- Entwicklung des Fünf-Faktoren-Modells
- Die fünf Dimensionen der Persönlichkeitsbeschreibung
- Messinstrumente zur Erhebung der Persönlichkeitsfaktoren
- Anwendungsbereiche des NEO-Fünf-Faktoren Inventars
- Kritik am Fünf-Faktoren-Modell und alternative Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Geschichte der Persönlichkeitsforschung und beschreibt den Wandel von einer unübersichtlichen Vielfalt an Faktorenmodellen hin zum Konsens über die „Big Five“. Die Genese der „Big Five“ wird im zweiten Kapitel aus dem lexikalischen Ansatz heraus beleuchtet. Die „Sedimentationshypothese“ von Klages und Cattells Präzisierung für die Persönlichkeitsforschung bilden die Grundlage für die Suche nach Persönlichkeitseigenschaften in der Sprache. Die Arbeit von Allport und Odbert sowie die anschließenden Forschungsarbeiten von Cattell und Fiske werden erläutert, wobei der Schwerpunkt auf der Faktorenanalyse und der Herausbildung der fünf Faktoren liegt. Das dritte Kapitel setzt sich mit den fünf Faktoren auseinander und diskutiert die Uneinigkeit in der Forschung trotz Replizierbarkeit der „Big Five“. Auch die Korrelationen zwischen den Faktoren und der Faktor V werden beleuchtet. Das vierte Kapitel behandelt Messinstrumente wie Adjektivlisten und Fragebögen sowie die Entwicklung des NEO-Fünf-Faktoren Inventars (NEO-FFI) von Costa und McCrae. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Anwendungsbereiche des NEO-FFI. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Kritik am Fünf-Faktoren-Modell, wobei die Kritik am lexikalischen Ansatz und weitere Diskussionspunkte im Fokus stehen. Das siebte Kapitel widmet sich der aktuellen Forschung und stellt alternative Modelle wie „Big Two“, „Big Six“ und „FPX“ sowie das HEXACO-Modell vor.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind die „Big Five“, ein Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitsbeschreibung, der lexikalische Ansatz, Faktorenanalyse, Messinstrumente wie Adjektivlisten und Fragebögen, das NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI), Kritik an den „Big Five“ und alternative Modelle wie „Big Two“, „Big Six“, „FPX“ und HEXACO.
- Quote paper
- Anne Lehwald (Author), Anna-Maria Schielicke (Author), 2004, Die 'Big Five'. Das Fünf-Faktoren-Modell zur Beschreibung der Persönlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47457