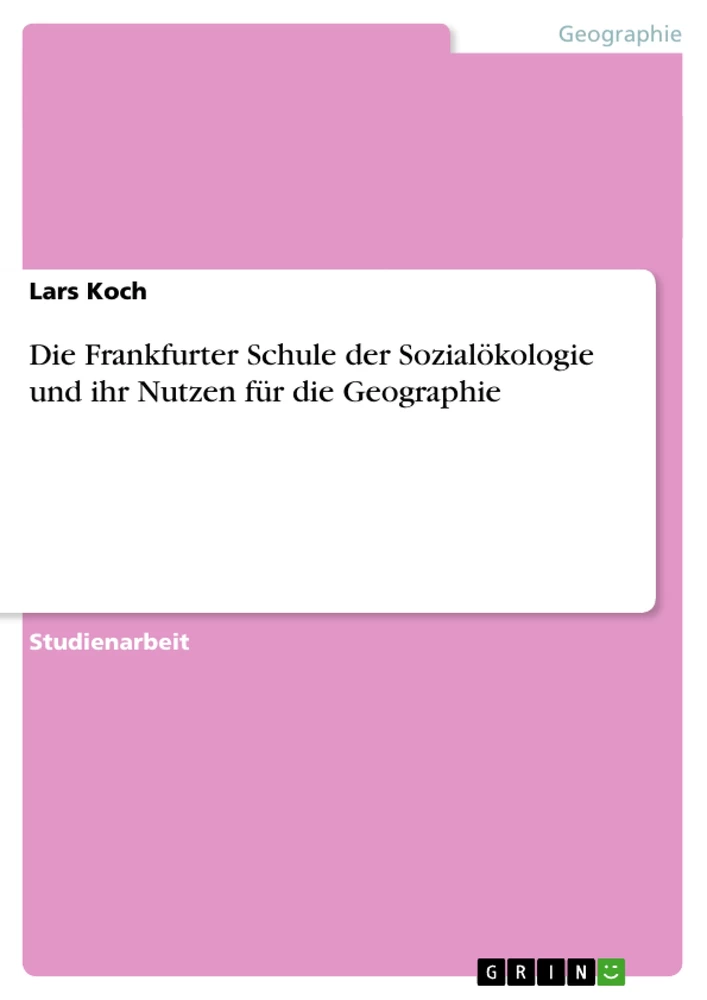„Geographie ist eine moderne Wissenschaft an der Schnittstelle von Natur- und
Sozialwissenschaften, die das Ökosystem Erde und die Gesellschaft mit ihren Ansprüchen an den
Raum untersucht“
So lautet die Definition von Geographie auf der Internetpräsenz des Geographischen Instituts der Universität Mainz (www.geo.uni-mainz.de, 24.06.2005). Der Begriff „Schnittstelle“ impliziert dabei, dass es einen Bereich der Überschneidung von Sozial- und Naturwissenschaften gebe, und genau im Bereich dieser Überschneidung soll also nun die Geographie Wissenschaft betreiben. Die Einschränkung folgt jedoch nur wenige Zeilen weiter:
„Das Geographische Institut besteht aus zwei Abteilungen: der naturwissenschaftlich ausgerichteten
Physischen Geographie und der sozialwissenschaftlich ausgerichteten Humangeographie“Wenn die Geographie denn nun an der Schnittstelle von Natur- und Sozialwissenschaften steht - warum besitzt das Geographische Institut dann zwei Abteilungen? Warum wird etwas, bei dem es anscheinend Überschneidungen gibt, getrennt untersucht? Die Behauptung, Geographie stehe an der Schnittstelle von Natur- und Sozialwissenschaften, wird mit der Unterteilung in eine „naturwissenschaftlich ausgerichtete Physische Geographie“ und eine „sozialwissenschaftlich ausgerichtete Humangeographie“ ins absurde geführt. Die Geographie besitzt zwei Ausprägungen, eine naturwissenschaftliche und eine sozialwissenschaftliche - sie steht damit aber noch nicht an der Schnittstelle zwischen beiden, solange diese beiden Bereiche nicht miteinander in Kontakt treten. Die Frage die sich nun stellt ist, was nötig wäre, um diese Trennung zu überwinden. An diesem Punkt kommt die Frankfurter Schule der Sozialökologie ins Spiel: Hier wird etwas ganz ähnliches versucht, die Integration von Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften, allerdings eingegrenzt auf das Feld der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung. Lassen sich trotz dieser Einschränkung Ideen für eine Geographie übernehmen, die wirklich an der „Schnittstelle“ von Natur- und Sozialwissenschaften steht? Dies soll im Folgenden zu klären versucht werden. Hierzu soll zunächst die Entstehungsgeschichte sozialökologischer Forschung beschrieben und eine Definition von Sozialer Ökologie gegeben werden, bevor einige Charakteristika sozial-ökologischer Forschung und das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse als theoretischer Rahmen vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte sozial-ökologischer Forschung
- Was ist Soziale Ökologie?
- Charakteristika sozial-ökologischer Forschung
- Problemorientierung
- Akteursorientierung
- Interdisziplinarität
- Probleme interdisziplinärer Forschung
- Das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse
- Gesellschaftliche Naturverhältnisse
- Regulierung gesellschaftlicher Naturverhältnisse
- Perspektiven für die Forschung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frankfurter Schule der Sozialökologie und ihren potenziellen Nutzen für die Geographie. Sie befasst sich mit der Entstehung sozial-ökologischer Forschung, definiert den Begriff der Sozialen Ökologie und beleuchtet die besonderen Merkmale dieser Forschungsrichtung. Darüber hinaus werden die Herausforderungen interdisziplinärer Forschung beleuchtet und das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse als theoretischer Rahmen vorgestellt.
- Entstehung und Entwicklung sozial-ökologischer Forschung
- Definition und Merkmale der Sozialen Ökologie
- Herausforderungen interdisziplinärer Forschung
- Das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse
- Potenzial der Sozialen Ökologie für die Geographie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Frage nach der Relevanz der Sozialen Ökologie für die Geographie. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte sozial-ökologischer Forschung und ihren historischen Kontext. Im dritten Kapitel wird der Begriff der Sozialen Ökologie definiert und ihre grundlegenden Prinzipien erläutert. Das vierte Kapitel analysiert die spezifischen Charakteristika sozial-ökologischer Forschung, insbesondere die Problemorientierung, Akteursorientierung und Interdisziplinarität. Im fünften Kapitel werden die Herausforderungen interdisziplinärer Forschung diskutiert, während das sechste Kapitel das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse als theoretischen Rahmen für die Soziale Ökologie vorstellt.
Schlüsselwörter
Soziale Ökologie, Umweltforschung, Interdisziplinarität, gesellschaftliche Naturverhältnisse, Nachhaltigkeit, Frankfurter Schule, Geographie, Problemorientierung, Akteursorientierung, Wissensproduktion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Frankfurter Schule der Sozialökologie?
Dies ist eine Forschungsrichtung (u.a. ISOE), die Natur- und Sozialwissenschaften verbindet, um komplexe Umweltprobleme und Nachhaltigkeit zu untersuchen.
Warum ist die Trennung von Physischer und Humangeographie problematisch?
Die Arbeit kritisiert, dass Umweltprobleme oft beide Bereiche betreffen, die klassische Geographie sie aber getrennt untersucht, anstatt die „Schnittstelle“ wirklich zu nutzen.
Was bedeutet das Konzept der „gesellschaftlichen Naturverhältnisse“?
Es beschreibt die Art und Weise, wie Gesellschaften ihre Beziehung zur Natur organisieren, regulieren und wie sie die Natur für ihre Bedürfnisse umformen.
Was sind die Merkmale sozialökologischer Forschung?
Wichtige Merkmale sind Problemorientierung (Lösung realer Krisen), Akteursorientierung und eine konsequente Interdisziplinarität.
Welchen Nutzen hat die Sozialökologie für die Geographie?
Sie bietet einen theoretischen Rahmen, um die Brücke zwischen naturwissenschaftlichen Daten und gesellschaftlichen Prozessen zu schlagen und so ganzheitliche Lösungen für die Umweltkrise zu finden.
- Citar trabajo
- Lars Koch (Autor), 2005, Die Frankfurter Schule der Sozialökologie und ihr Nutzen für die Geographie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47250