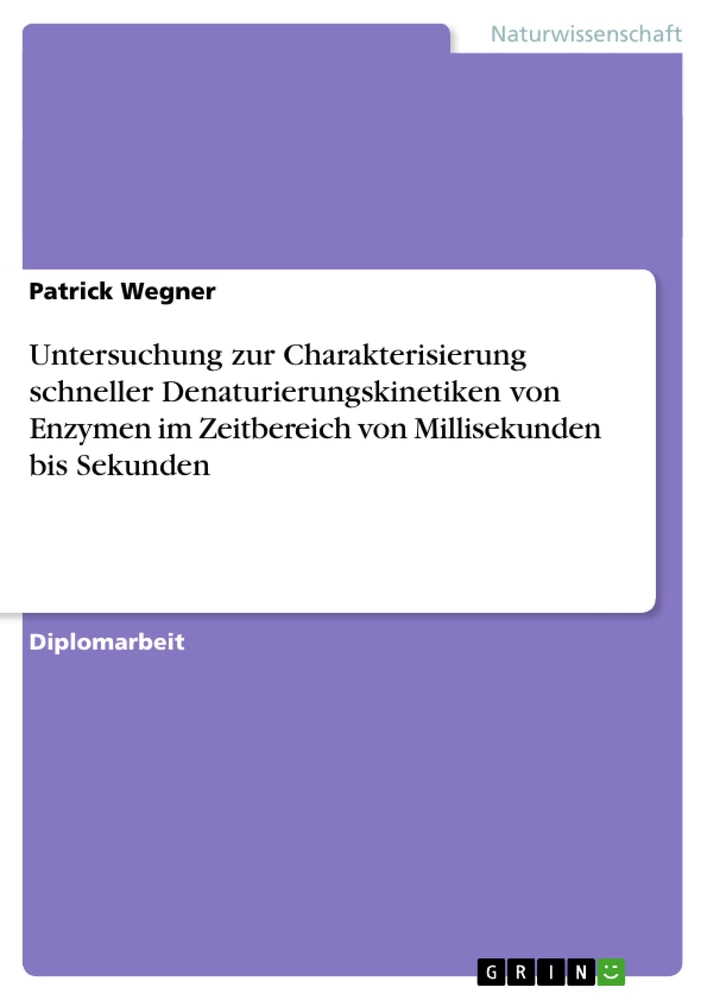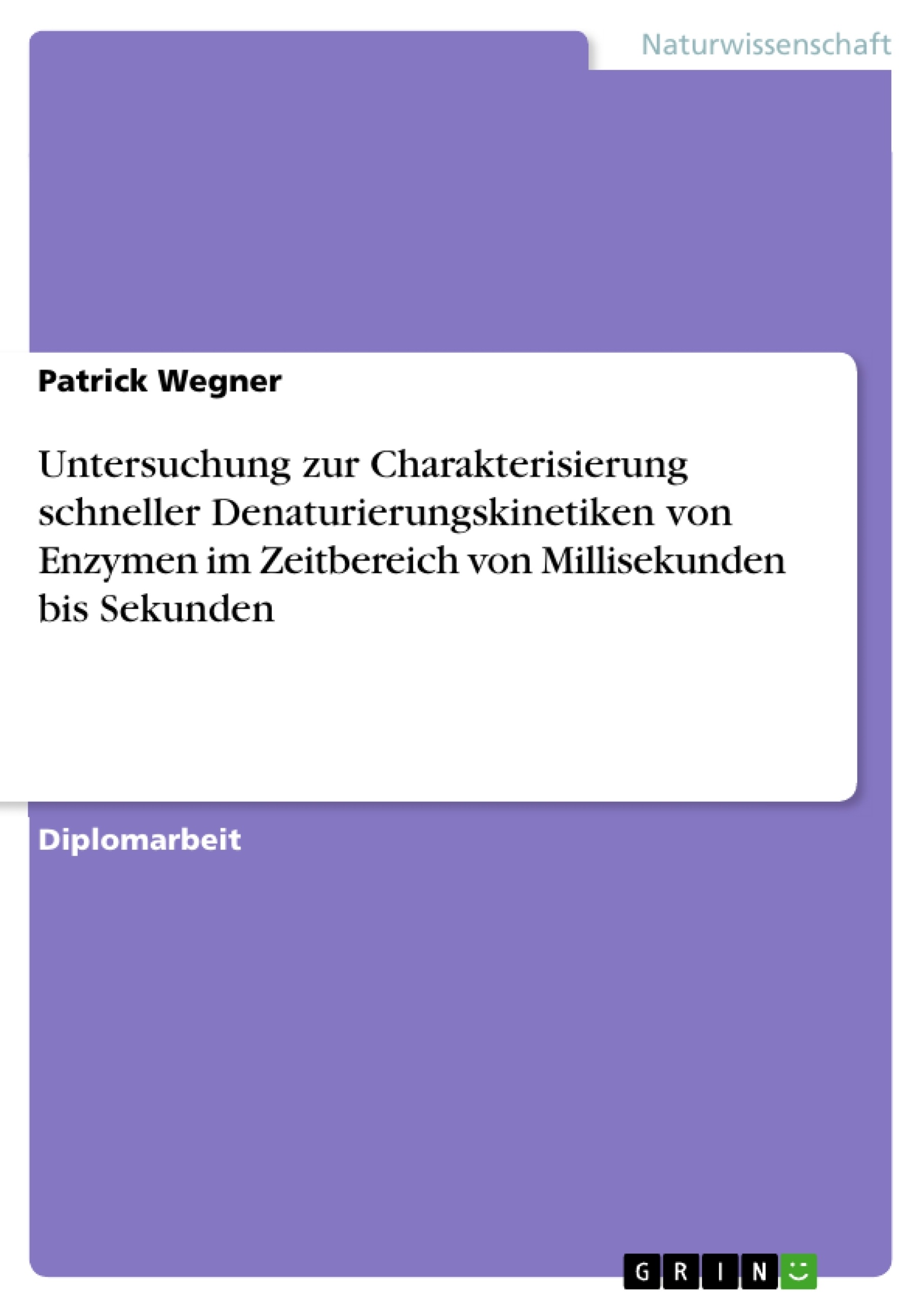Seit den 60er Jahren wird in vielenGebieten der Medizin die lineareAbsorption des Laserlichts im Gewebe benutzt, um dort gezielt Energie zu deponieren, die dann eine Koagulation oder Ablation bewirken. Bei Fokussierung des Laserlichts liegt die untere Grenze für die Präzision thermischer Gewebseffekte aufgrund der Beugung des Lichts bei 0, 5 bis 1 μm. Durch die selektive Absorption der Laserstrahlung in bestimmten Zielstrukturen im Gewebe kann im Prinzip die räumliche Präzision der Energiedeponierung weiter erhöht werden. Die Laserenergie wird dabei nur am Ort der absorbierenden Strukturen deponiert, deren räumliche Ausdehnung damit die prinzipiell erreichbare Präzision vorgibt. Die Temperaturerhöhung in die umgebenden Areale durch Wärmeleitung kann weitgehend vermieden werden, wenn die Laserpulsdauer die thermische Relaxationszeit des Absorbers nicht übersteigt (sog. thermischer Einschluß). Die thermische Relaxationszeit skaliert dabei mit dem Quadrat des Absorberdurchmessers und ist umgekehrt proportional zu den Wärmeleitungseigenschaften des Absorbermediums. In der Lasermedizin wird dieses Prinzip unter anderem bereits bei der selektiven Schädigung stark absorbierender Zellen im retinalen Pigmentepithel ausgenutzt.
Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zur Entwicklung eines Temperatursprungexperiments sind Teil eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts über laser-induzierte thermische Gewebseffekte. Ziel dieses Projektes ist es, grundlegende Erkenntnisse über laser-induzierte thermische Gewebseffekte bei kurzzeitigem Erhitzen des Gewebes zu erlangen. Als Schadensmechanismus bei thermischer Zellschädigung wird allgemein eine Denaturierung der in der Zelle enthaltenen Proteine angenommen.
Die Frage, inwieweit Gewebe und Zellen sich thermisch selektiv
schädigen lassen, ist also über die Notwendigkeit eines thermischen Einschlusses direkt an die Frage gekoppelt, in welchen Zeitskalen eine thermische Proteindenaturierung möglich ist und welche Temperaturen dazu erforderlich sind. Die bereits vorhandenen Kenntnisse der Denaturierungskinetiken der Proteine im Zeitbereich von Sekunden bis Stunden sollen in dem DFG-Projekt bis in kürzere Zeitbereiche erweitert werden. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Experiment soll über ein Temperatursprungverfahren die Denaturierungskinetiken von ausgewählten Proteinen im Bereich von Millisekunden bis Sekunden zugänglich machen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorie
- 2.1 Wärmeleitung und thermische Relaxationszeit
- 2.2 Bewegungsgleichung eines Fluids
- 2.3 Bewegungsgleichung eines fallenden Wassertropfens
- 2.4 Das Cr,Tm,Ho:YAG Lasersystem
- 2.5 Lichtverteilung in Tropfen bei Bestrahlung
- 2.6 Thermische Proteindenaturierung
- 2.7 Das Modellenzym alkalische Phosphatase
- 2.8 Nachweis der Proteinaktivität
- 3 Temperatursprungexperimente mit Kapillaren
- 3.1 Konzept
- 3.2 Material und Methoden
- 3.3 Ergebnisse
- 3.4 Diskussion
- 4 Laserinduzierter Temperatursprung in kleinen Wassertropfen
- 4.1 Konzept
- 4.2 Vorversuche
- 4.3 Konstruktion der klimatisierten Fallstrecke
- 4.4 Test der klimatisierten Fallstrecke
- 4.5 Diskussion
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung und Erprobung von zwei experimentellen Aufbauten zur Durchführung von Temperatursprungexperimenten in wässrigen Lösungen. Ziel ist die Untersuchung von Denaturierungskinetiken von Proteinen im Millisekunden- bis Sekundenbereich. Die Arbeit konzentriert sich auf die Realisierbarkeit und die jeweiligen Herausforderungen beider Methoden.
- Entwicklung eines Temperatursprungexperiments mit Kapillaren
- Entwicklung eines laserinduzierten Temperatursprungexperiments mit kleinen Wassertropfen
- Untersuchung der Wärmeleitung und thermischen Relaxationszeiten
- Analyse der Strömungsdynamik in Kapillaren (laminar und turbulent)
- Nachweis der Proteinaktivität mittels Fluoreszenzmessung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Anwendung linearer Laserlichtabsorption im Gewebe zur gezielten Energiedeposition und die damit verbundenen Herausforderungen hinsichtlich der Präzision thermischer Gewebseffekte. Sie führt in das DFG-Projekt ein, das grundlegende Erkenntnisse über laserinduzierte thermische Gewebseffekte bei kurzzeitigem Erhitzen erlangen möchte, und positioniert die vorliegende Arbeit innerhalb dieses Projekts. Verschiedene existierende Temperatursprungmethoden werden vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert, um den Bedarf für eine neue Methode zu begründen.
2 Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der durchgeführten Experimente dar. Es behandelt die Wärmeleitungsgleichung und deren Anwendung zur Abschätzung thermischer Relaxationszeiten für verschiedene Geometrien (Ebene, Zylinder, Kugel). Die Navier-Stokes-Gleichung wird vorgestellt und im Kontext laminarer und turbulenter Strömungen in Kapillaren diskutiert. Das Kapitel behandelt auch die Bewegungsgleichung eines fallenden Wassertropfens und beschreibt das Cr,Tm,Ho:YAG Lasersystem, die Lichtverteilung in Tropfen bei Bestrahlung, sowie die thermische Proteindenaturierung und den Nachweis der Proteinaktivität. Die Beschreibung der alkalischen Phosphatase als Modellenzym vervollständigt den theoretischen Rahmen.
3 Temperatursprungexperimente mit Kapillaren: Dieses Kapitel beschreibt den ersten experimentellen Ansatz, bei dem eine dünnwandige Kapillare, durchströmt von der zu untersuchenden Flüssigkeit, durch externe Wärmebäder geheizt und gekühlt wird. Das Kapitel präsentiert die experimentelle Methodik zur Bestimmung des Volumenflusses, Reynoldszahlen, und der Visualisierung der Strömungsformen. Die Ergebnisse zeigen die Grenzen des Aufbaus bezüglich der Erzeugung turbulenter Strömungen und der gleichmäßigen Erwärmung auf. Die Diskussion analysiert die Ergebnisse und leitet daraus die Grenzen des Zeitbereichs ab, der mit diesem Aufbau erreicht werden kann.
4 Laserinduzierter Temperatursprung in kleinen Wassertropfen: Dieses Kapitel präsentiert einen zweiten experimentellen Ansatz, bei dem ein frei fallender Wassertropfen durch einen Laserpuls erhitzt wird. Es werden detaillierte Vorversuche zur Lichtverteilung in den Tropfen und zur Abschätzung der Abkühlzeiten in Luft beschrieben. Die Konstruktion und der Test der klimatisierten Fallstrecke werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Bestrahlungsexperimente und des Tests der Klimakammer werden analysiert, um die Funktionsfähigkeit des Aufbaus zu bewerten. Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen bei der homogenen Erwärmung der Tropfen und die Notwendigkeit eines verbesserten Tropfengenerators.
Schlüsselwörter
Temperatursprung, Proteindenaturierung, Wärmeleitungsgleichung, Navier-Stokes-Gleichung, Cr,Tm,Ho:YAG-Laser, turbulente Strömung, Kapillare, Wassertropfen, alkalische Phosphatase, Fluoreszenz, Wärmeleitung, thermische Relaxationszeit, Reynoldszahl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Temperatursprungexperimente zur Untersuchung von Proteindenaturierung
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Erprobung zweier experimenteller Aufbauten zur Durchführung von Temperatursprungexperimenten in wässrigen Lösungen. Ziel ist die Untersuchung der Denaturierungskinetiken von Proteinen im Millisekunden- bis Sekundenbereich. Im Fokus stehen die Realisierbarkeit und die Herausforderungen beider Methoden.
Welche experimentellen Ansätze werden untersucht?
Es werden zwei Ansätze untersucht: 1) Temperatursprungexperimente mit Kapillaren, bei denen eine durchströmte Kapillare durch externe Wärmebäder geheizt und gekühlt wird; und 2) ein laserinduzierter Temperatursprung in kleinen Wassertropfen, bei dem ein frei fallender Tropfen durch einen Laserpuls erhitzt wird.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wärmeleitungsgleichung und deren Anwendung zur Abschätzung thermischer Relaxationszeiten, die Navier-Stokes-Gleichung im Kontext laminarer und turbulenter Strömungen in Kapillaren, die Bewegungsgleichung eines fallenden Wassertropfens, das Cr,Tm,Ho:YAG Lasersystem, die Lichtverteilung in Tropfen bei Bestrahlung, die thermische Proteindenaturierung, und den Nachweis der Proteinaktivität mittels Fluoreszenzmessung. Die alkalische Phosphatase dient als Modellenzym.
Was sind die Ergebnisse der Kapillarexperimente?
Die Kapillarexperimente zeigen die Grenzen des Aufbaus bezüglich der Erzeugung turbulenter Strömungen und der gleichmäßigen Erwärmung auf. Die Diskussion analysiert die Ergebnisse und leitet daraus die Grenzen des Zeitbereichs ab, der mit diesem Aufbau erreicht werden kann.
Was sind die Ergebnisse der Laser-induzierten Temperatursprungexperimente?
Die Laser-induzierten Experimente beschreiben detaillierte Vorversuche zur Lichtverteilung in den Tropfen und zur Abschätzung der Abkühlzeiten in Luft. Die Konstruktion und der Test der klimatisierten Fallstrecke werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse zeigen Herausforderungen bei der homogenen Erwärmung der Tropfen und die Notwendigkeit eines verbesserten Tropfengenerators auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Temperatursprung, Proteindenaturierung, Wärmeleitungsgleichung, Navier-Stokes-Gleichung, Cr,Tm,Ho:YAG-Laser, turbulente Strömung, Kapillare, Wassertropfen, alkalische Phosphatase, Fluoreszenz, Wärmeleitung, thermische Relaxationszeit, Reynoldszahl.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit zielt auf die Entwicklung und Erprobung von Methoden zur Untersuchung von Proteindenaturierungskinetiken im Millisekunden- bis Sekundenbereich ab. Konkret geht es um die Entwicklung eines Temperatursprungexperiments mit Kapillaren und eines laserinduzierten Temperatursprungexperiments mit kleinen Wassertropfen. Weiterhin werden die Wärmeleitung und thermische Relaxationszeiten untersucht, sowie die Strömungsdynamik in Kapillaren und der Nachweis der Proteinaktivität mittels Fluoreszenzmessung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Theorie, Temperatursprungexperimente mit Kapillaren, Laserinduzierter Temperatursprung in kleinen Wassertropfen und Zusammenfassung und Ausblick. Die Einleitung beschreibt den Hintergrund und die Zielsetzung. Das Theoriekapitel legt die Grundlagen dar. Die Kapitel 3 und 4 präsentieren die experimentellen Ansätze und Ergebnisse. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
- Quote paper
- Dr. Patrick Wegner (Author), 2000, Untersuchung zur Charakterisierung schneller Denaturierungskinetiken von Enzymen im Zeitbereich von Millisekunden bis Sekunden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4723