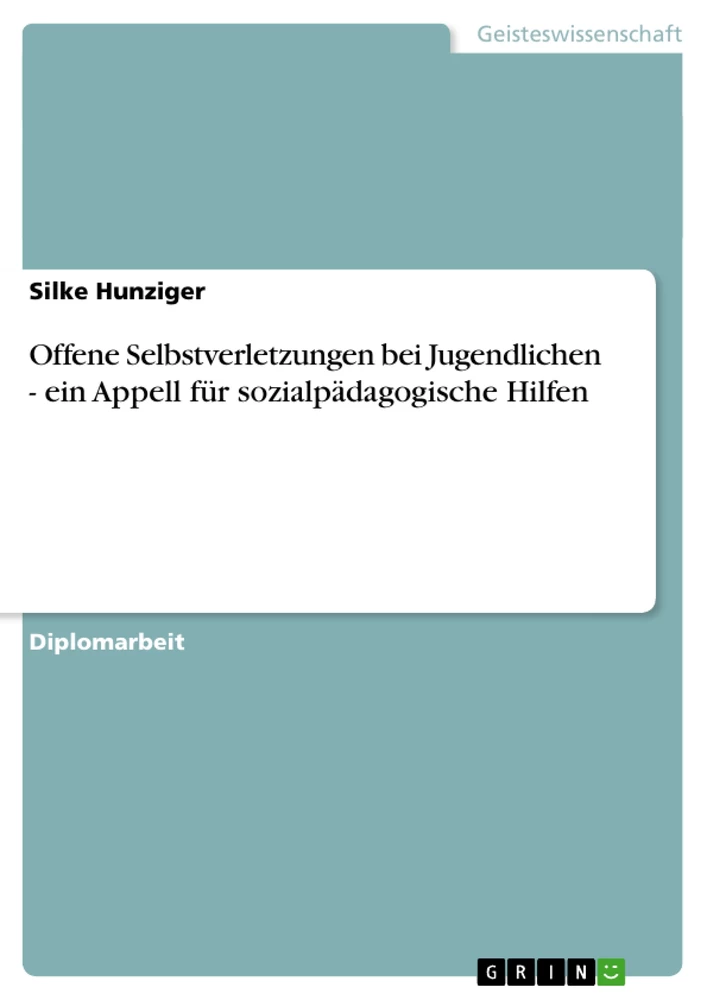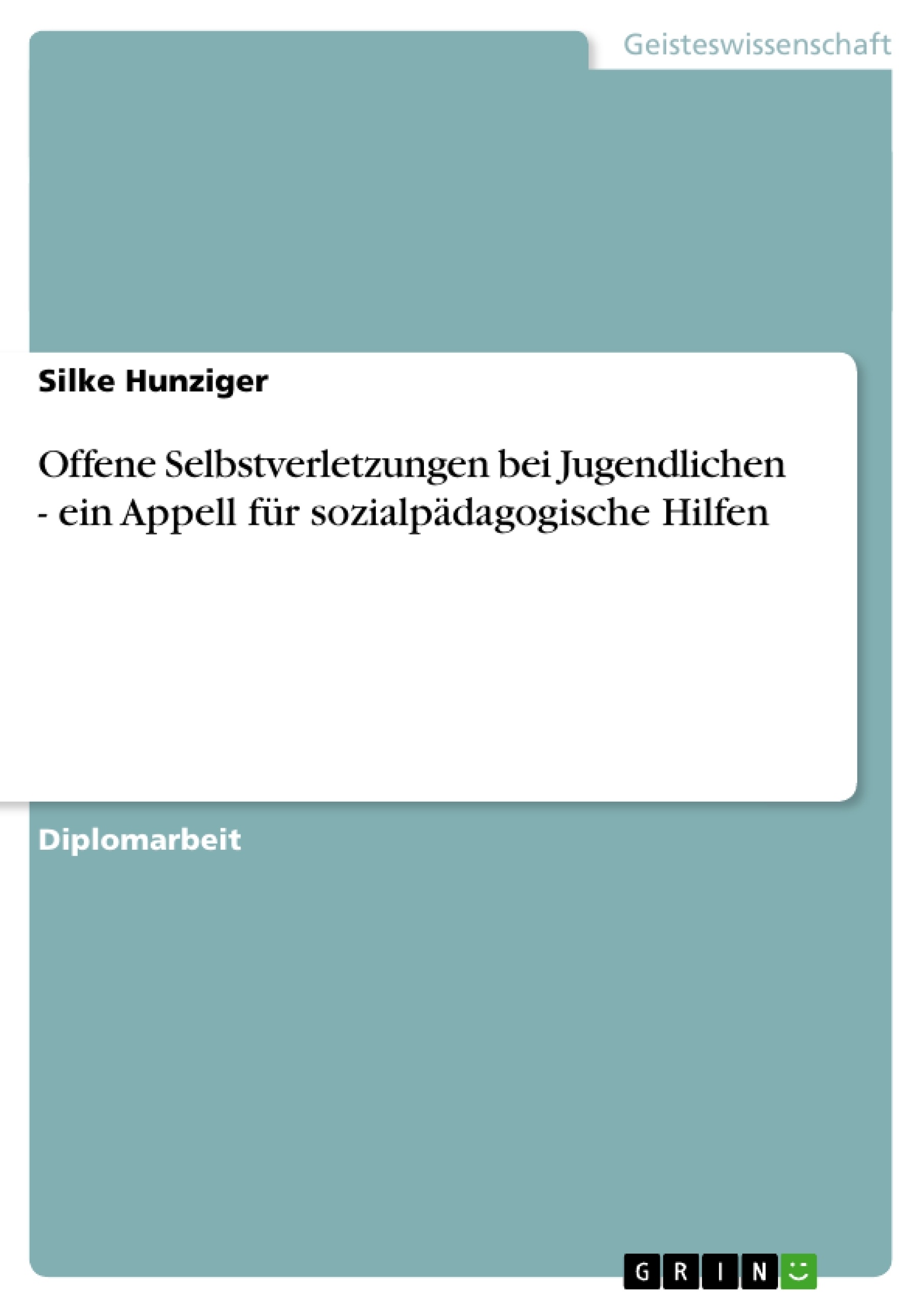Selbstverletzendes Verhalten ist nicht nur ein Zeichen des 20. Jahrhunderts. Auch wenn der Betrachter weiter in die Vergangenheit zurückblickt, findet er in der Literatur Hinweise auf Verhaltensweisen, die dem heutigen selbstverletzenden Verhalten sehr ähneln. Es ist nur schwer eine genaue Prozentzahl, der sich selbst verletzenden Bevölkerung anzugeben. Die Dunkelziffer ist bei dieser Problematik sehr hoch. Experten rechnen mit ca. 1 Prozent der Bevölkerung. Dabei spielt die soziale Herkunft eher eine untergeordnete Rolle. Es wird angenommen, dass zwei Drittel der Menschen mit selbstverletzenden Verhaltensweisen Frauen sind. (Kingma, Renate/2004) Nach einer Analyse der Hauptstadt-Krankenhausgesellschaft Vivantes habe sich in Berlin die Zahl der Selbstverletzungen in den letzten zwei Jahren sogar verdreifacht. Dabei wurde auch festgestellt, dass die Gewalt gegen den eigenen Körper nicht nur häufiger sondern auch heftiger geworden ist (Jörg Diehl in Spiegel/2004) In der mir vorliegenden Literatur wird häufig erwähnt, dass es vor allem Mädchen und Frauen im Alter von 16- 24 bzw. bis 30 Jahre sind, die sich selbst schädigen. (Teuber, Kristin; 2000/Ackermann, Stefanie; 2004/Sachsse, Ulrich; 1999)Demnach nehme ich an, dass neben den persönlichen Problemen auch die signifikanten Probleme und die Entwicklungsaufgaben in der weiblichen Adoleszenz dazu beitragen können, dass sich vor allem weibliche Jugendliche selbst verletzen.Ich bin im Sommer 2002 zum ersten Mal bewusst mit selbstverletzendem Verhalten in Berührung gekommen. Damals suchte eine ehemalige Schülerin meiner Ausbildungsgruppe nach 2 Jahren wieder Kontakt zu mir. Wir blieben in Verbindung, vor allem über das Internet. Hier erfuhr ich auch erstmals etwas von ihren selbstverletzenden Handlungen. Ich muss sagen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt froh war, ihr nicht gegenüber zu sitzen, sondern den Monitor vor mir zu haben. So hatte ich Gelegenheit, mich zu sammeln, mir meine Worte gut zu überlegen und erst dann zu antworten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und wie in vielen Büchern beschrieben, fühlte ich mich auch unwissend, hatte Angst etwas Falsches zu sagen oder mit dem Tod konfrontiert zu werden. Das Internet bot mir die Möglichkeit mich zurückzuziehen, wenn ich an manchen Tagen das Thema Selbstverletzung nicht ertragen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Blickwinkel auf den Begriff der Selbstverletzung
- 3. Annäherung an den Begriff Selbstverletzung
- 3.1 Gesellschaftlich akzeptierte Selbstverletzungen
- 3.2 Selbstbeschädigung als Krankheit
- 3.2.1 Artifizielle Erkrankungen
- 4. Überschneidungen und Abgrenzung zu anderen Krankheiten/Störungen
- 4.1 Das Borderline-Syndrom
- 4.2 Essstörungen
- 4.3 Menschen mit Behinderungen
- 4.4 Zwangsstörungen
- 5. Theorien zur Entstehung von selbstverletzendem Verhalten
- 5.1 Die Psychoanalyse
- 5.2 Lerntheorien
- 6. Ursachen von selbstverletzenden Verhalten
- 6.1 Gestörte Eltern-Kind-Bindung
- 6.2 Familiäre Kindesmisshandlungen
- 6.2.1 Körperliche Misshandlungen
- 6.2.2 Seelische Misshandlungen
- 6.2.3 Sexueller Missbrauch
- 6.3 Posttraumatische Belastungsstörungen
- 6.4 Nachahmendes Verhalten
- 6.5 Zusammenfassung zu den Ursachen von selbstverletzendem Verhalten
- 7. Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens
- 7.1 Abwehr unerträglicher Emotionen
- 7.1.1 Selbstbestrafung
- 7.1.2 Spannungsminderung
- 7.1.3 Steigerung des Selbstkontrollerlebens
- 7.1.4 Suizidprophylaxe
- 7.1.5 Beendigung von Depersonalisationszuständen
- 7.1.6 Ein heimlicher Stolz
- 7.2 Zusammenfassung zu den Funktionen selbstverletzenden Verhaltens
- 7.1 Abwehr unerträglicher Emotionen
- 8. Selbstverletzung und Weiblichkeit
- 8.1 Gesellschaftliche Erwartungen an weibliche Verhaltensweisen
- 8.2 Entwicklungsaufgaben in den einzelnen Entwicklungsphasen
- 8.2.1 Entwicklungsaufgaben in der Kindheit
- 8.2.2 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- 8.2.3 Entwicklungsaufgaben im jungen Erwachsenenalter
- 9. Fallanalysen
- 9.1 Anlass
- 9.2 Methodenauswahl
- 9.3 Interviewleitfaden
- 9.4 Vorgeschichte von Ke.
- 9.5 Vorgeschichte von S.
- 9.6 Interpretation der Aussagen von Ke. und S.
- 10. Konsequenzen für das Handlungsfeld der sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Jugendlichen. Ziel ist es, Ursachen, Funktionen und Zusammenhänge mit gesellschaftlichen Erwartungen und Entwicklungsphasen zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf persönlichen Erfahrungen der Autorin und analysiert Fallstudien.
- Ursachen selbstverletzenden Verhaltens bei Jugendlichen
- Funktionen von Selbstverletzung als Bewältigungsstrategie
- Der Einfluss gesellschaftlicher Erwartungen auf weibliches Selbstverständnis
- Entwicklungspsychologische Aspekte im Zusammenhang mit Selbstverletzung
- Implikationen für die sozialpädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen ein, beschreibt die persönliche Motivation der Autorin und benennt die Forschungslücke, die die Arbeit zu schließen versucht. Die Autorin hebt die hohe Dunkelziffer und die geschlechtsspezifische Verteilung (überwiegend weiblich) hervor und skizziert den Fokus auf weibliche Jugendliche im Alter von 16-24 Jahren.
2. Historischer Blickwinkel auf den Begriff der Selbstverletzung: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Erscheinung von selbstverletzendem Verhalten. Es zeigt, dass Selbstverletzung kein rein modernes Phänomen ist, sondern dass in der Vergangenheit ähnliche Verhaltensweisen dokumentiert wurden. Der historische Kontext hilft zu verstehen, wie die Wahrnehmung und Behandlung von Selbstverletzungen sich im Laufe der Zeit verändert haben.
3. Annäherung an den Begriff Selbstverletzung: Dieses Kapitel differenziert zwischen gesellschaftlich akzeptierten Formen von Selbstverletzung und Selbstverletzung als Krankheitssymptom. Es beleuchtet den Unterschied zwischen intentionaler Selbstverletzung und Unfällen und definiert die problematische Selbstverletzung als Störung, einschließlich der Unterscheidung von artifiziellen Erkrankungen.
4. Überschneidungen und Abgrenzung zu anderen Krankheiten/Störungen: Das Kapitel analysiert die Überschneidungen und Unterscheidungen von selbstverletzendem Verhalten mit anderen psychischen Störungen wie Borderline-Syndrom, Essstörungen, Zwangsstörungen und den Besonderheiten bei Menschen mit Behinderungen. Es verdeutlicht die Komplexität der Thematik und die Schwierigkeit einer eindeutigen Abgrenzung.
5. Theorien zur Entstehung von selbstverletzendem Verhalten: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien, die die Entstehung selbstverletzenden Verhaltens erklären, darunter psychoanalytische und lerntheoretische Ansätze. Es wird die Komplexität der Ursachen und der Einfluss verschiedener Faktoren herausgestellt.
6. Ursachen von selbstverletzenden Verhalten: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Ursachen für selbstverletzendes Verhalten, wie gestörte Eltern-Kind-Bindung, familiäre Kindesmisshandlungen (körperlich, seelisch, sexuell), posttraumatische Belastungsstörungen und Nachahmungseffekte. Es werden die komplexen Wechselwirkungen dieser Faktoren ausführlich beleuchtet und ihre Bedeutung im Kontext von Selbstverletzung betont.
7. Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens: Hier werden die unterschiedlichen Funktionen von Selbstverletzung untersucht. Es geht um die Bewältigung von unerträglichen Emotionen, Selbstbestrafung, Spannungsminderung, die Steigerung des Selbstkontroll-Erlebens, Suizidprophylaxe, die Beendigung von Depersonalisationszuständen und einen möglichen, paradoxen "heimlichen Stolz". Die verschiedenen Funktionen werden detailliert beschrieben und analysiert.
8. Selbstverletzung und Weiblichkeit: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Selbstverletzung und Weiblichkeit, indem es gesellschaftliche Erwartungen an Frauen und die Entwicklungsaufgaben in verschiedenen Lebensphasen (Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter) analysiert. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass gesellschaftlicher Druck und Entwicklungskrisen die Entstehung von selbstverletzendem Verhalten fördern.
9. Fallanalysen: Dieses Kapitel präsentiert Fallanalysen von zwei betroffenen Jugendlichen (Ke. und S.). Die Autorin beschreibt die Methodik der Datenerhebung (Interviews) und analysiert die individuellen Hintergründe und Erfahrungen der jungen Frauen. Diese detaillierten Analysen dienen als Illustration der im vorherigen Kapiteln diskutierten Themen.
10. Konsequenzen für das Handlungsfeld der sozialen Arbeit: Das Kapitel leitet aus den vorherigen Analysen Konsequenzen für die soziale Arbeit ab. Es geht um die Entwicklung von Hilfestrategien und Interventionen für Betroffene. Der Fokus liegt auf der Bedeutung professioneller Unterstützung und der Herausforderungen in der Praxis.
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten, Jugendliche, Mädchen, Frauen, Adoleszenz, psychische Störungen, Borderline, Essstörungen, Trauma, Kindesmisshandlung, Eltern-Kind-Bindung, Psychoanalyse, Lerntheorien, soziale Arbeit, Hilfestrategien, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Jugendlichen. Sie beleuchtet Ursachen, Funktionen und Zusammenhänge mit gesellschaftlichen Erwartungen und Entwicklungsphasen. Die Arbeit basiert auf persönlichen Erfahrungen der Autorin und analysiert Fallstudien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Ursachen selbstverletzenden Verhaltens bei Jugendlichen, Funktionen von Selbstverletzung als Bewältigungsstrategie, den Einfluss gesellschaftlicher Erwartungen auf das weibliche Selbstverständnis, entwicklungspsychologische Aspekte im Zusammenhang mit Selbstverletzung und Implikationen für die sozialpädagogische Praxis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Einleitung, historischer Überblick über Selbstverletzung, Annäherung an den Begriff Selbstverletzung, Abgrenzung zu anderen Krankheiten/Störungen, Theorien zur Entstehung, Ursachen von selbstverletzendem Verhalten, Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens, Selbstverletzung und Weiblichkeit, Fallanalysen und Konsequenzen für die soziale Arbeit.
Wie wird der Begriff "Selbstverletzung" in der Arbeit definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen gesellschaftlich akzeptierten Formen von Selbstverletzung und Selbstverletzung als Krankheitssymptom. Es wird die problematische Selbstverletzung als Störung definiert und die Unterscheidung von artifiziellen Erkrankungen beleuchtet.
Welche Theorien zur Entstehung von selbstverletzendem Verhalten werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Theorien, darunter psychoanalytische und lerntheoretische Ansätze. Die Komplexität der Ursachen und der Einfluss verschiedener Faktoren werden hervorgehoben.
Welche Ursachen für selbstverletzendes Verhalten werden untersucht?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ursachen wie gestörte Eltern-Kind-Bindung, familiäre Kindesmisshandlungen (körperlich, seelisch, sexuell), posttraumatische Belastungsstörungen und Nachahmungseffekte. Die komplexen Wechselwirkungen dieser Faktoren werden ausführlich beleuchtet.
Welche Funktionen hat selbstverletzendes Verhalten laut der Arbeit?
Die Arbeit untersucht verschiedene Funktionen, darunter die Bewältigung unerträglicher Emotionen (Selbstbestrafung, Spannungsminderung), die Steigerung des Selbstkontroll-Erlebens, Suizidprophylaxe, die Beendigung von Depersonalisationszuständen und einen möglichen "heimlichen Stolz".
Wie wird der Zusammenhang zwischen Selbstverletzung und Weiblichkeit betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Selbstverletzung und Weiblichkeit, indem sie gesellschaftliche Erwartungen an Frauen und die Entwicklungsaufgaben in verschiedenen Lebensphasen (Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter) analysiert. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass gesellschaftlicher Druck und Entwicklungskrisen die Entstehung von selbstverletzendem Verhalten fördern können.
Wie werden die Fallanalysen durchgeführt?
Die Arbeit präsentiert Fallanalysen von zwei betroffenen Jugendlichen (Ke. und S.). Die Autorin beschreibt die Methodik der Datenerhebung (Interviews) und analysiert die individuellen Hintergründe und Erfahrungen der jungen Frauen. Diese detaillierten Analysen dienen als Illustration der im vorherigen Kapitel diskutierten Themen.
Welche Konsequenzen für die soziale Arbeit werden abgeleitet?
Das letzte Kapitel leitet aus den vorherigen Analysen Konsequenzen für die soziale Arbeit ab. Es geht um die Entwicklung von Hilfestrategien und Interventionen für Betroffene. Der Fokus liegt auf der Bedeutung professioneller Unterstützung und den Herausforderungen in der Praxis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstverletzendes Verhalten, Jugendliche, Mädchen, Frauen, Adoleszenz, psychische Störungen, Borderline, Essstörungen, Trauma, Kindesmisshandlung, Eltern-Kind-Bindung, Psychoanalyse, Lerntheorien, soziale Arbeit, Hilfestrategien, Prävention.
- Quote paper
- Silke Hunziger (Author), 2005, Offene Selbstverletzungen bei Jugendlichen - ein Appell für sozialpädagogische Hilfen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47223