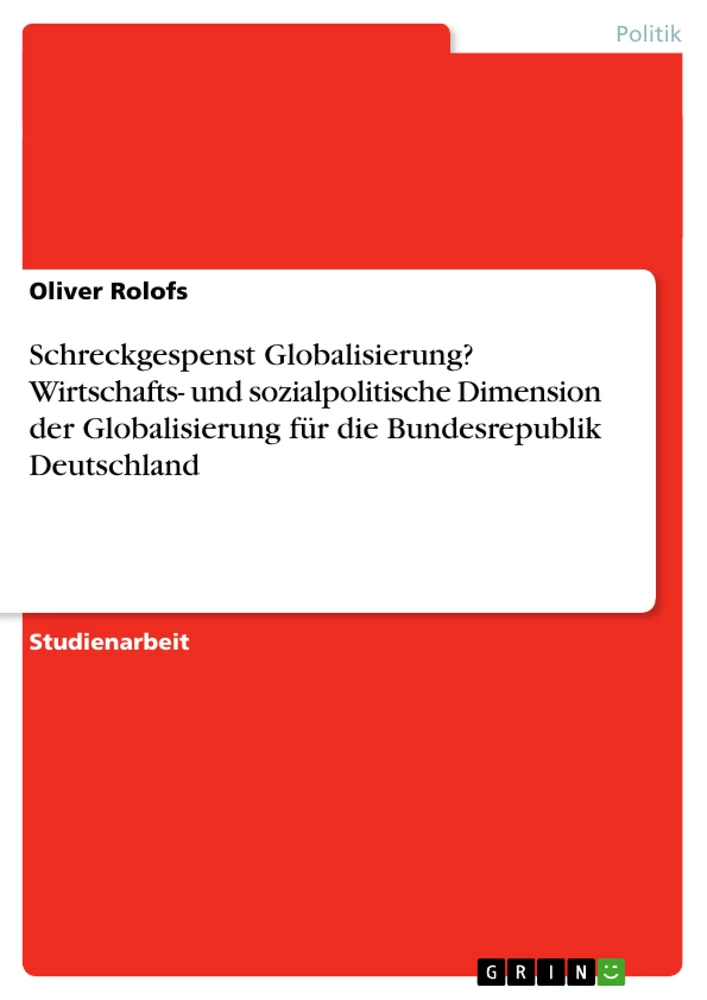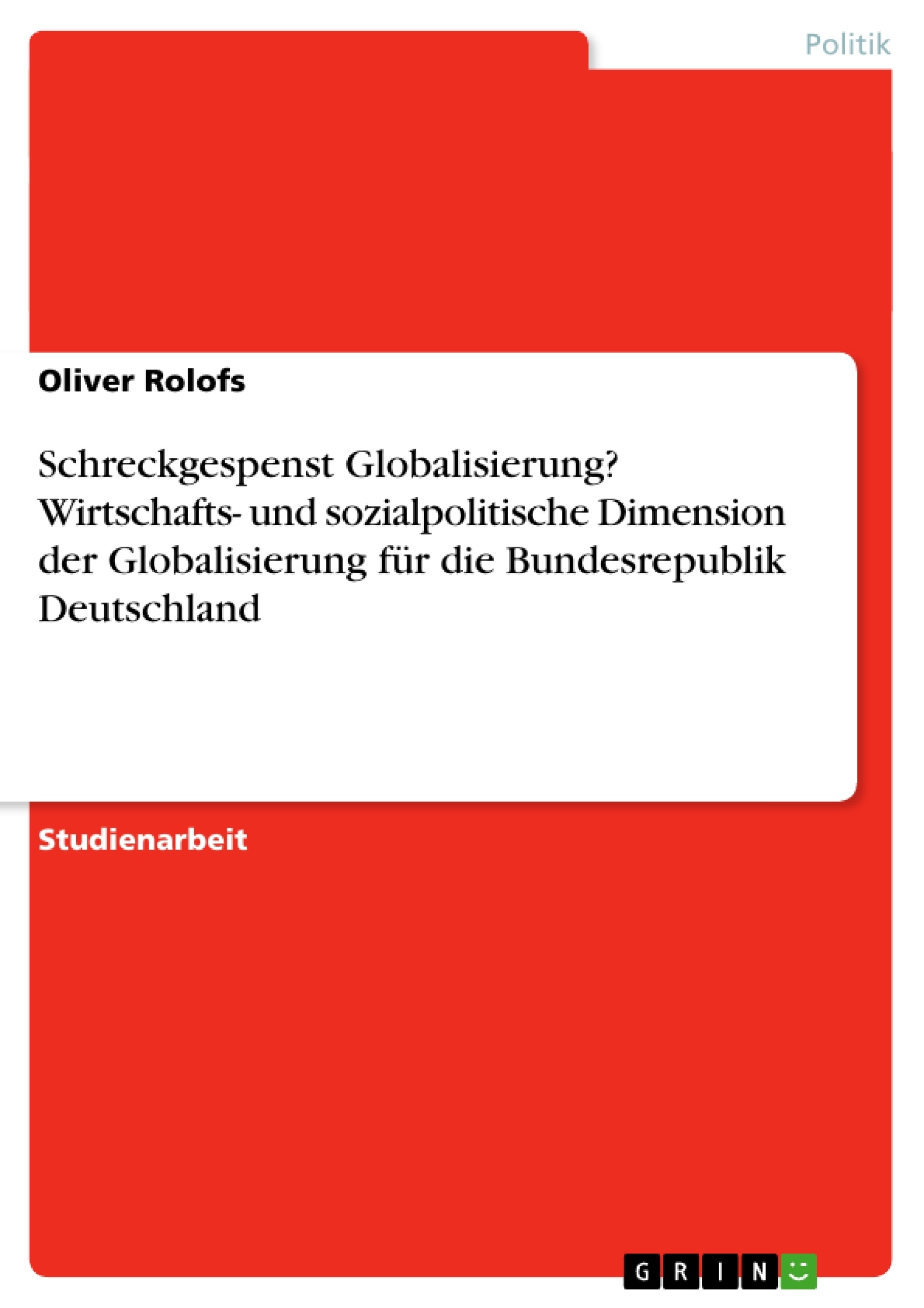„Wir sind mit Risikosituationen konfrontiert, die man in früheren Zeiten nicht kannte [...]. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten betreffen uns unabhängig davon, wie privilegiert oder unterprivilegiert wir sind. Sie hängen unmittelbar mit der Globalisierung zusammen [...].“. Diese Aussage von Giddens beschreiben ein Gefühl, was man als eine politische Ökonomie der Unsicherheit bezeichnen kann, die seit den letzten Jahren besonders die Stimmung in den Gesellschaften hoch industrialisierter Nationen bestimmt. Die Veränderungen der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten haben also dazu beigetragen, dass die Globalisierung heutzutage merkbar alle Aspekte des wirtschaftlichen und sozialen Lebens erfasst. Vor allem in Deutschland hat die politische Ökonomie der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Globalisierung und der Standortfrage gepaart mit den Sozialreformen der Agenda 2010 zu einer wahren „Weltuntergangsstimmung“ geführt, die im Laufe des Jahres 2004 einen weiteren Höhepunkt gefunden hat.
War Deutschland in den letzten Jahrzehnten in fast allen Bereichen auf den obersten Plätzen der Weltrangliste vertreten, so ist die Bundesrepublik im neuen Jahrtausend auf mittlere- und untere Plätze abgerutscht, sei es in den Bereichen Bildung, Innovationen, Forschung oder Wirtschaft. Ist nun also für diesen Negativtrend allein die Globalisierung verantwortlich, wie viele gerne annehmen? Sind die Deutschen also unweigerliche Opfer einer sich seit Jahren neu ordnenden ökonomischen, weltumspannenden
Wirtschaftsordnung, die allein für die hohe Arbeitslosigkeit und den Wandel von Arbeits- und Wirtschaftswelt verantwortlich ist?
Diese Arbeit soll den Zusammenhang zwischen Strukturkrise in der Bundesrepublik Deutschland, der Veränderung der Arbeitsgesellschaft und einer möglichen Verbindung mit der Globalisierung untersuchen. Gerade hier besteht im öffentlichen Sinne noch ein größerer Aufarbeitungsbedarf, da zum einen die Globalisierung fast ausschließlich als Negativfaktor und „Sündenbock für alles“ in den Köpfen der Deutschen präsent ist, zum anderen aber auch keine wesentliche Aufklärung darüber stattfindet. Zuvor gilt es in dieser Arbeit unter Abschnitt zwei im allgemeinen zu klären, was man unter dem Begriff der Globalisierung versteht und wie sich die Auswirkungen dieser neuen Weltordnung auf die wirtschaftlichen, politischen und strukturellen Gefüge der Staaten der Erde, aber besonders auf die der hochindustrialisierten Nationen äußern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Begrifflichkeiten der Globalisierung
- Was versteht man unter Globalisierung?
- Die Terminologie und Ursache der Globalisierung
- Globalisierung und ihre Folgen
- Der Wandel von Arbeits- und Wirtschaftswelt
- Die politischen Folgen
- Die Auswirkungen von Globalisierung auf den Wirtschaftsstandort Deutschland
- Die jetzige Situation des Wirtschaftsstandorts Deutschland
- Arbeitslosigkeit durch Globalisierung – der einzige Grund?
- Warum hat die deutsche Politik nicht ernsthaft reagiert?
- Über- und unterschätzte Standortfaktoren in der deutschen Globalisierungsdebatte
- Unterschätzte Faktoren in der Standortdebatte
- Die Relation von Standort und Sozialstaat
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Strukturkrise in der Bundesrepublik Deutschland, der Veränderung der Arbeitsgesellschaft und einer möglichen Verbindung mit der Globalisierung. Im Fokus steht dabei die öffentliche Wahrnehmung der Globalisierung als Negativfaktor und die Frage nach der tatsächlichen Rolle dieser Prozesse in den aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen Deutschlands. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der Globalisierung auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, analysiert die Situation des deutschen Wirtschaftsstandortes mit seinen Defiziten und befasst sich mit der Frage, inwieweit Staat und Wirtschaft für den globalen Wettbewerb gerüstet sind.
- Die Definition und Auswirkungen der Globalisierung auf die Weltwirtschaft und die hochindustrialisierten Nationen
- Die Situation des Wirtschaftsstandorts Deutschland im globalen Wettbewerb
- Die Ursachen für die Strukturkrise in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Rolle der Globalisierung in der deutschen Arbeitsgesellschaft
- Die Bedeutung von Standortfaktoren im globalen Wettbewerb
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Wahrnehmung der Globalisierung als ein Risikofaktor, der die Stimmung in den hochindustrialisierten Ländern prägt. Sie stellt die Frage, ob die Globalisierung allein für die negative Entwicklung Deutschlands verantwortlich ist, und benennt die Strukturkrise, die Veränderung der Arbeitsgesellschaft und die Globalisierung als zentrale Themen der Arbeit.
Allgemeine Begrifflichkeiten der Globalisierung
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Globalisierung und erläutert die Prozesse der Internationalisierung, Globalisierung und Transnationalisierung. Es beschreibt die Auswirkungen dieser Prozesse auf die Weltwirtschaft, die Arbeitswelt und die Politik.
Die Auswirkungen von Globalisierung auf den Wirtschaftsstandort Deutschland
Dieses Kapitel analysiert die Situation des Wirtschaftsstandorts Deutschland im globalen Wettbewerb und beleuchtet die Auswirkungen der Globalisierung auf die deutsche Wirtschaft. Es untersucht die Rolle der Globalisierung in der Entstehung von Arbeitslosigkeit und diskutiert die Politikmaßnahmen Deutschlands in diesem Zusammenhang. Zudem werden wichtige Standortfaktoren für den globalen Wettbewerb analysiert und die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Kontext gestellt.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Wirtschaftsstandort Deutschland, Strukturkrise, Arbeitsgesellschaft, Internationalisierung, Transnationalisierung, Standortfaktoren, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Politik, Sozialstaat, Weltwirtschaft.
- Quote paper
- Oliver Rolofs (Author), 2004, Schreckgespenst Globalisierung? Wirtschafts- und sozialpolitische Dimension der Globalisierung für die Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47209