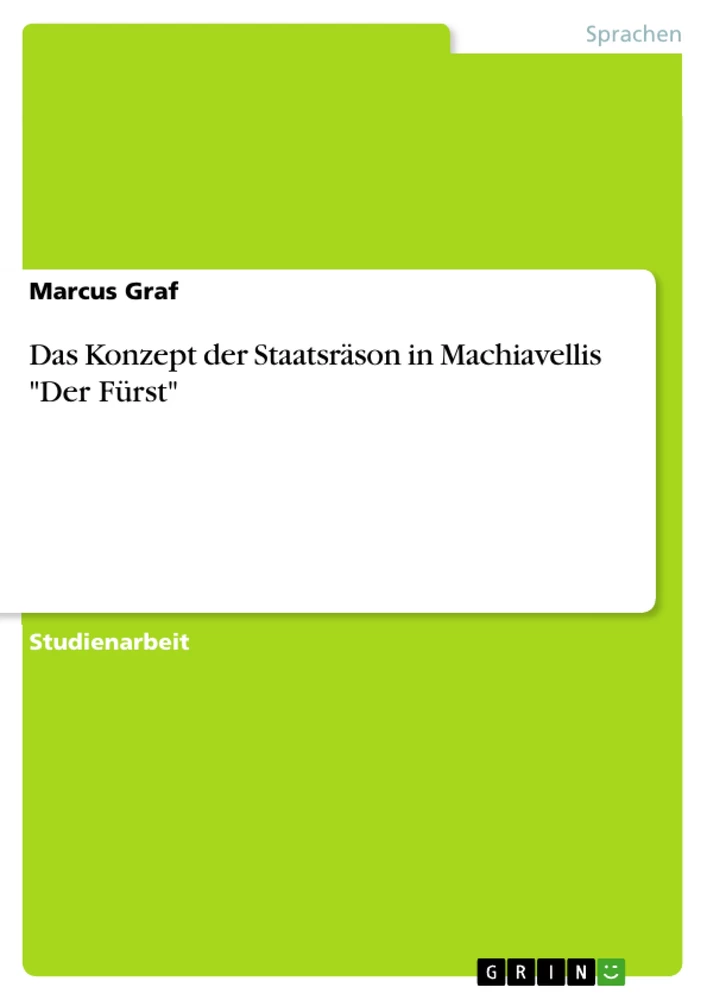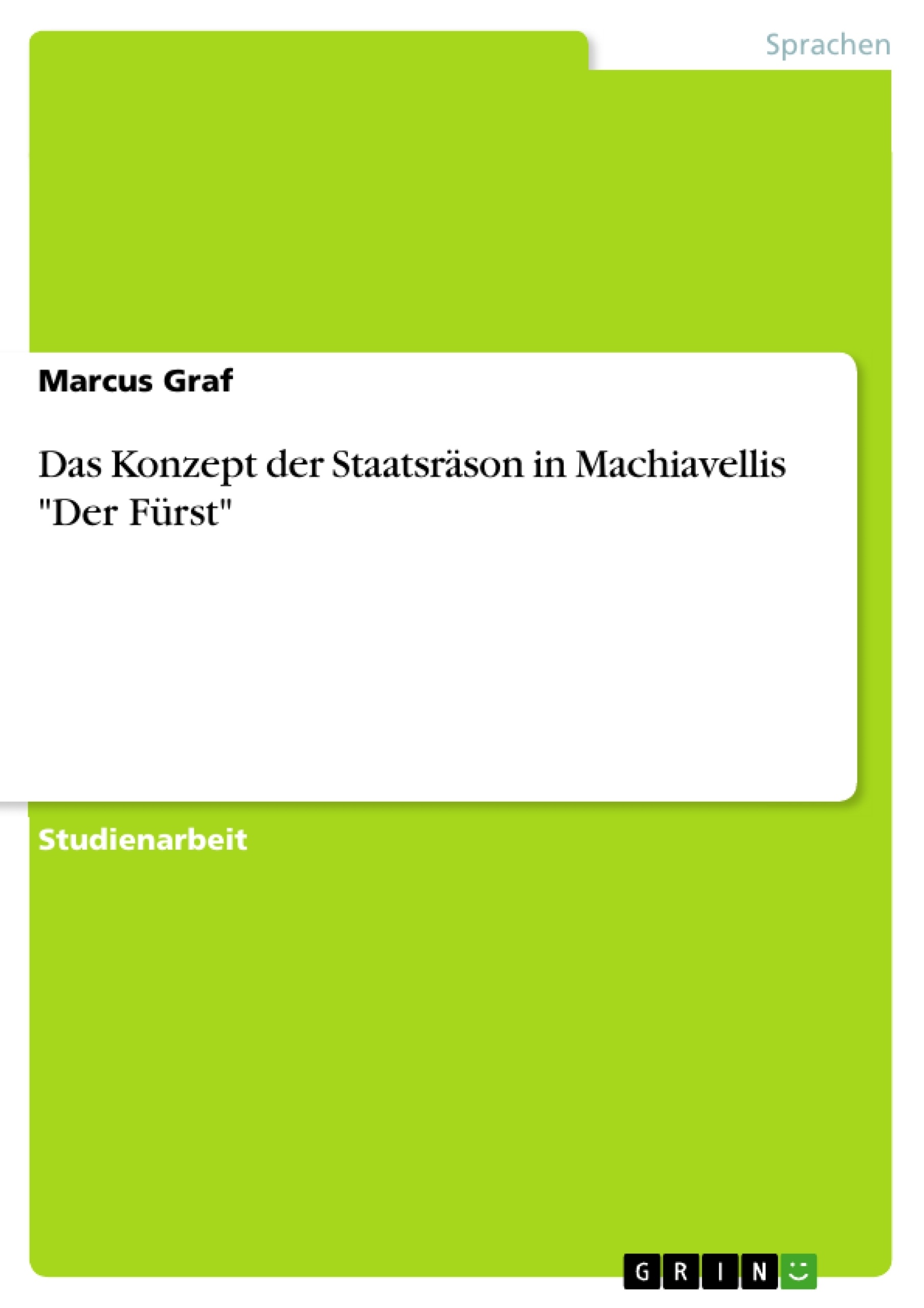Machiavellis Werke, allen voran "Der Fürst", rufen meist zweierlei Reaktion herauf: Auf der einen Seite wird seine nüchterne Politikbetrachtung gepriesen, auf der anderen Seite wird genau diese Ansicht als unmoralisch und religionslos bezeichnet. Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit soll die Frage nach der Verstrickung des Viergestirns aus virtù, fortuna, necessità und occasione mit Machiavellis Konzept der Staatsraison sein.
Dazu wird zunächst Machiavellis Konzept der Staatsraison im Fürsten betrachtet. Hierzu wird primär die Rolle des Fürsten in der Staatsgründung, sowie die Mittel zur Erhaltung des Staates behandelt. Der zweite Teil befasst sich mit dem "magischen Viereck". Dazu wird jedes der Elemente einzeln sowie in der Gesamtbetrachtung beleuchtet. Es ist anzunehmen, dass gerade für die Staatsgründung und Staatserhaltung das Viergestirn für den Fürsten als Herrscher eine wichtige Rolle spielt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Staatsraison
- Der Staatsbegriff
- Staatsgründung
- Staatserhaltung
- Religion
- Militär
- Zwischenfazit
- ,,Das magische Viereck“
- virtù
- Necessità
- fortuna
- Occasione
- Kritische Auseinandersetzung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Staatsräson in Machiavellis „Fürst“ und analysiert dessen Verknüpfung mit den Begriffen „virtù“, „fortuna“, „occasione“ und „necessità“. Sie beleuchtet die Rolle des Fürsten in der Staatsgründung und -erhaltung im Kontext der Staatsräson und untersucht, wie die vier genannten Konzepte in der praktischen Anwendung der Staatsräson zum Tragen kommen.
- Machiavellis Konzept der Staatsräson
- Die Rolle des Fürsten in der Staatsgründung und -erhaltung
- Die Bedeutung von „virtù“, „fortuna“, „occasione“ und „necessità“ für die Staatsräson
- Die ethische und moralische Dimension der Staatsräson
- Die Rezeption von Machiavellis „Fürst“ und seiner Staatsräson in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Relevanz von Machiavellis „Fürst“ in der Geschichte des politischen Denkens dar. Sie beleuchtet die ambivalenten Reaktionen auf Machiavellis Werk und die zentralen Fragen, die diese Arbeit untersucht.
- Staatsraison: Dieses Kapitel analysiert Machiavellis Konzept der Staatsräson, das sich in seinen Werken, insbesondere im „Fürst“, findet. Es betrachtet die Staatsräson als oberstes Prinzip der Staatserhaltung und beleuchtet ihre Unabhängigkeit von moralischen und ethischen Normen. Das Kapitel untersucht, wie Machiavelli die Staatsräson als Mittel zur Sicherung des Staates und zur Durchsetzung der Macht des Fürsten begreift.
- Der Staatsbegriff: Der Staatsbegriff bei Machiavelli wird in diesem Kapitel beleuchtet. Es geht um die Definition des Staates als Instrument der Macht des Herrschers und dessen Verhältnis zu den Untertanen. Der zyklische Charakter des Geschichtsverständnisses bei Machiavelli wird ebenfalls untersucht, wobei es um die Phasen der Ordnung und Unordnung geht, die sich im Laufe der Geschichte wiederholen.
- Staatsgründung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie ein Staat nach Machiavellis Konzept gegründet werden kann. Es analysiert die Rolle des Fürsten im Gründungsprozess und die Bedeutung von Fähigkeiten und Strategien, die er zur Durchsetzung seiner Macht einsetzen muss. Die Verbindung zur Staatsräson und die Notwendigkeit, sich den Gegebenheiten der jeweiligen Zeit anzupassen, werden ebenfalls beleuchtet.
- Staatserhaltung: Im Kontext der Staatsraison wird in diesem Kapitel die Frage der Staatserhaltung behandelt. Machiavelli betrachtet die Erhaltung des Staates als oberstes Ziel und analysiert die Mittel, die der Fürst zu diesem Zweck einsetzen muss. Es geht um den Umgang mit Macht, die Notwendigkeit, sich mit der „fortuna“ auseinanderzusetzen und die Bedeutung von „virtù“ für die Stabilität des Staates.
- Religion: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Religion im Kontext der Staatsräson. Machiavelli betrachtet die Religion als Instrument zur Stärkung der Macht des Fürsten und zur Kontrolle der Bevölkerung. Er analysiert, wie die Religion eingesetzt werden kann, um die Staatsräson zu unterstützen und gleichzeitig die Moral des Volkes zu beeinflussen.
- Militär: Das Militär spielt in Machiavellis Staatsräson eine wichtige Rolle. Dieses Kapitel befasst sich mit dem Aufbau und der Bedeutung des Militärs für die Sicherheit und den Fortbestand des Staates. Machiavelli analysiert die verschiedenen Strategien und Taktiken, die der Fürst im Krieg und in der Verteidigung seines Landes einsetzen muss.
- Zwischenfazit: Dieses Kapitel fasst die zentralen Punkte der bisherigen Kapitel zusammen und zeigt die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung der Staatsräson ergeben. Es betont die Ambivalenz von Machiavellis Konzept und die ethischen und moralischen Fragen, die mit seiner Denkweise verbunden sind.
- ,,Das magische Viereck“: Dieses Kapitel widmet sich den vier zentralen Begriffen „virtù“, „fortuna“, „occasione“ und „necessità“, die in Machiavellis „Fürst“ eine wichtige Rolle spielen. Es untersucht, wie diese Konzepte miteinander verwoben sind und wie sie in der praktischen Anwendung der Staatsräson zum Tragen kommen. Die Bedeutung von „virtù“ für den Fürsten und die Herausforderung, mit der „fortuna“ umzugehen, werden dabei besonders hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Staatsräson, „virtù“, „fortuna“, „occasione“, „necessità“ und dem „Fürsten“ in Machiavellis Werk. Sie analysiert die Rolle des Fürsten in der Staatsgründung und -erhaltung und beleuchtet die ethische und moralische Dimension der Staatsräson. Weitere zentrale Themen sind die Rezeption von Machiavellis Werk in der Literatur und der zyklische Charakter des Geschichtsverständnisses bei Machiavelli.
- Quote paper
- Marcus Graf (Author), 2016, Das Konzept der Staatsräson in Machiavellis "Der Fürst", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470696