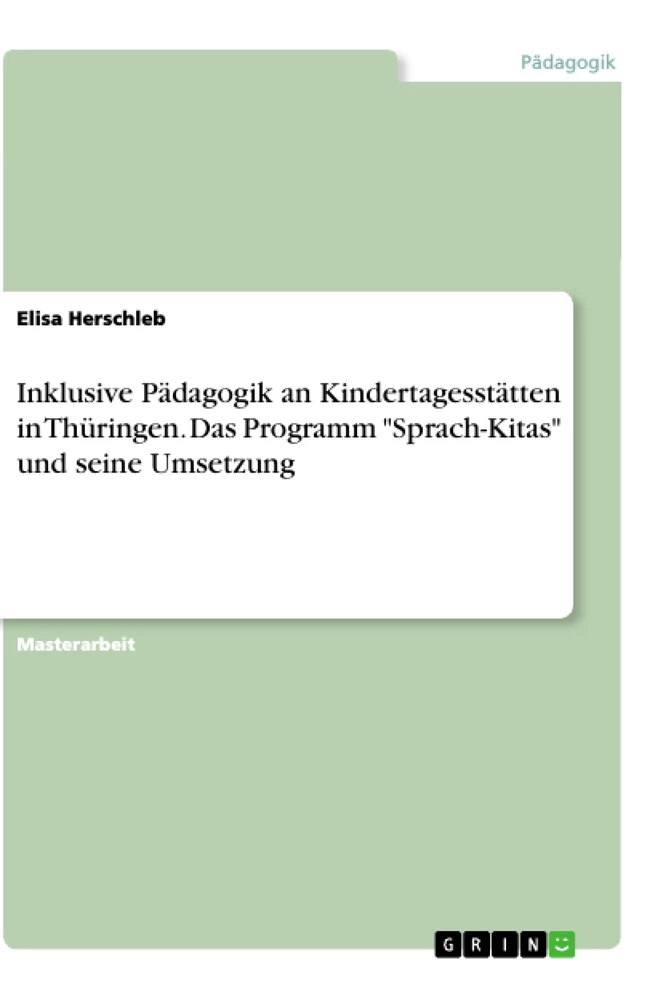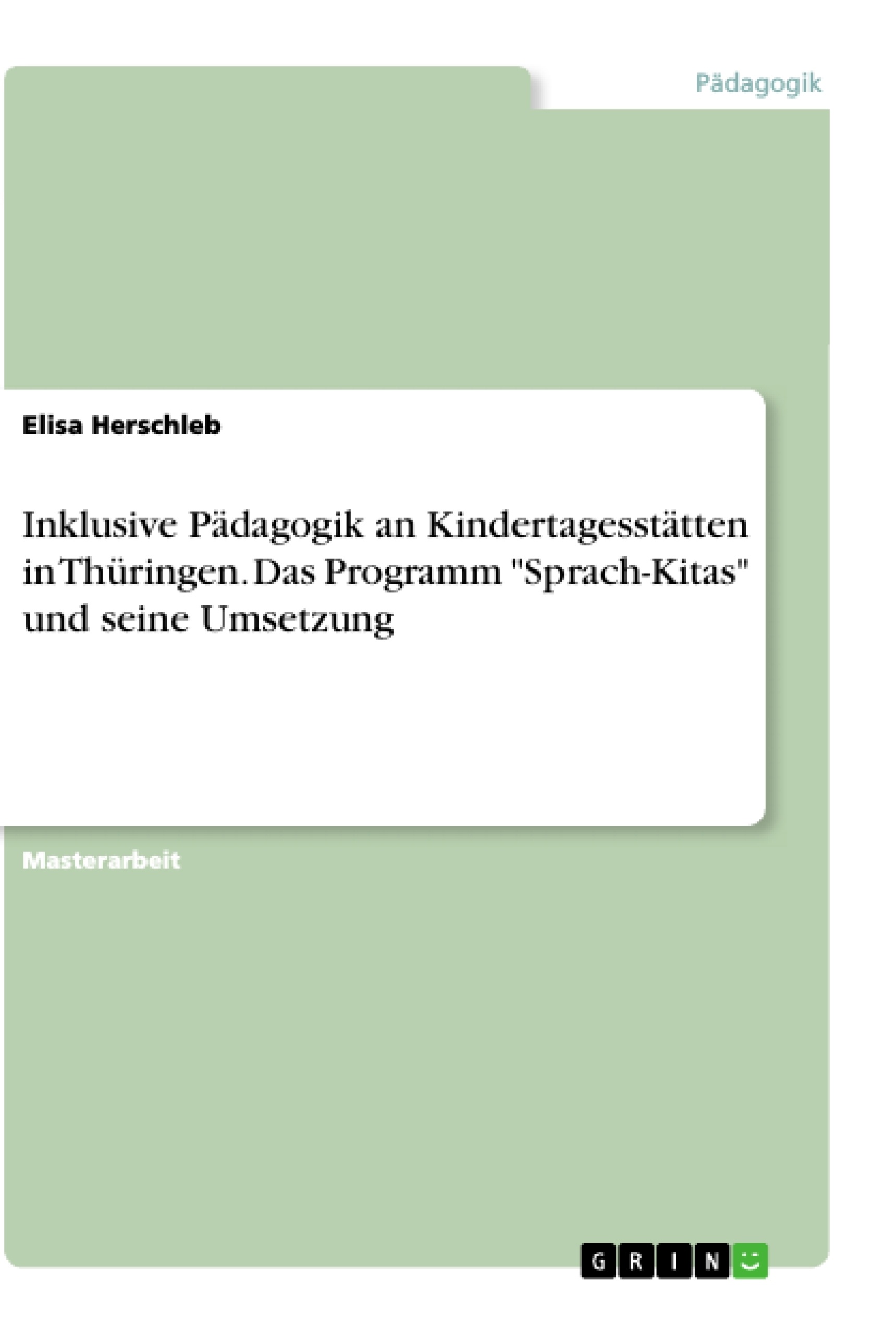Diese Arbeit befasst sich mit der praktischen Umsetzung des Programms Sprach-Kitas in Thüringen. Dazu wurde eine Interviewstudie mit am Programm beteiligten Fachkräften durchgeführt. Der Umgang mit dem Programm lässt sich, basierend auf den Ergebnissen, nicht verallgemeinern, da jede Einrichtung verschiedene Bedarfe aufweist und die Fachkräfte unterschiedliche Herangehensweisen haben.
Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler in der PISA-Studie arbeiteten Bund und Länder an Vorschlägen zur Verbesserung der Bildungsbegebenheiten. Ein Beitrag hierzu ist das Programm Sprach-Kitas. Das Programm möchte sicherstellen, dass alle Kinder, unabhängig ihrer Herkunft, gleiche Startchancen beim Übergang vom Kindergarten zur Schule haben. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im Kindergarten, da Bildung nicht erst in der Schule beginnt. Zudem stellt die Sprache ein zentrales Mittel zur Bildung eines jeden Menschen dar.
Auch wenn das Programm einen durchaus durchdachten Ansatz für Kindertageseinrichtungen bietet, sind die personellen und materiellen Ressourcen vor Ort häufig nicht ausreichend. Auch gibt es in der Gestaltung des Programms und der daraus folgenden Umsetzung Schwachstellen, die aufgezeigt werden. Jede Einrichtung im Programm hat die Aufgabe, gezielt nach ihren spezifischen Defiziten zu suchen und dahingehend zu arbeiten, diese zu verbessern. Nur dann kann ein Erfolg für die Kinder tatsächlich eintreten. Die Ergebnisse zeigen, dass dies ein äußerst schwieriges Unterfangen darstellt, das eines behutsamen Vorgehens bedarf. Eine nachhaltige Etablierung ist bisher schwierig, da viele verschiedene Faktoren einander bedingen und dies zu einem vielschichtigen Prozess machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Input-Faktoren im Spracherwerbsprozess bei Kindern
- 2.1. Allgemeine Faktoren
- 2.2. Aspekte der Sprachförderkompetenz von Fachkräften
- 2.3. Professionalisierung der Sprachförderkompetenz
- 2.4. Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- 2.4.1. Das Vorgängerprogramm: Schwerpunkt-Kitas: Sprache & Integration
- 2.4.2. Das Nachfolgeprogramm Sprach-Kitas
- 2.5. Basis des Porgramms: Orientierungsleitfäden des Deutschen Jugend Institutes
- 2.6. Akteure im Programm
- 3. Sprachentwicklung im Thüringer Bildungsplan
- 4. Begründung für die empirische Arbeit und Forschungsfragen
- 5. Zielgruppe und Untersuchungsinstrumente
- 5.1. Studie 1: Interviewstudie
- 5.2. Zielgruppe für das Interview
- 5.3. Qualitative Erhebungsform: Interview
- 5.4. Studie 2: Beobachtungen
- 5.5. Zielgruppe für die Beobachtung
- 5.6. Qualitative Erhebungsform: Beobachtung
- 6. Untersuchungsdurchführung
- 7. Auswertung der Interviews
- 7.1. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
- 7.2. Inklusives Sprachbildungskonzept
- 7.3. Chancen zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung erkennen und wahrnehmen
- 7.4. Qualitätssicherung
- 7.5. Sprachförderkompetenz
- 7.6. Feinfühlige Dialoghaltung und sprachliches Vorbild
- 7.7. Weiterbildungsmöglichkeiten
- 7.8. Die Arbeit im Team
- 7.9. Mehrsprachigkeit
- 7.10. Elternarbeit
- 7.11. Kritik am Programm
- 8. Auswertung der Beobachtungen
- 8.1. Beobachtung I
- 8.2. Beobachtung II
- 8.3. Vergleich der Beobachtungen
- 9. Zusammenfassung der empirischen Daten
- 10. Diskussion der Ergebnisse
- 10.1. Sprachfachkräfte
- 10.2. Kompetenzerwerb
- 10.3. Bundesprogramm Sprach-Kitas
- 10.4. Rahmenbedingungen in Einrichtungen
- 10.5. Einrichtungsteams
- 10.6. Sprachbildung im Thüringer Bildungsplan
- 10.7. Sprachbildung in der Erstausbildung von pädagogischen Fachkräften
- 11. Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Umsetzung des Programms Sprach-Kitas in Thüringer Kindertagesstätten. Die Arbeit analysiert, wie die in dem Programm formulierten Ziele zur Förderung der Sprachentwicklung und Inklusion in der Praxis umgesetzt werden und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
- Alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kindertagesstätten
- Inklusion und Sprachförderung im Kontext des Programms Sprach-Kitas
- Herausforderungen und Chancen der Programmimplementierung in Thüringen
- Rolle der Fachkräfte und deren Sprachförderkompetenz
- Qualitätssicherung und Evaluation des Programms
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Sprachförderung und Inklusion in Kindertagesstätten, wobei die Bedeutung der Sprache für den Bildungsprozess und die Entwicklung des Kindes im Fokus steht. Anschließend werden die Input-Faktoren im Spracherwerbsprozess bei Kindern, insbesondere die Sprachförderkompetenz von Fachkräften, sowie die Professionalisierung der Sprachförderkompetenz behandelt. Das Programm Sprach-Kitas wird in seiner Entstehung, seinen Zielen und seinen wichtigsten Bestandteilen vorgestellt. Zudem werden die Sprachentwicklung im Thüringer Bildungsplan und die Begründung für die empirische Arbeit sowie die Forschungsfragen erläutert. Die Forschungsmethode beinhaltet eine Interviewstudie mit Fachkräften in Kindertagesstätten, die am Programm Sprach-Kitas teilnehmen. Es werden Interviews und Beobachtungen durchgeführt, um die praktische Umsetzung des Programms in Thüringer Kindertagesstätten zu analysieren. Die Ergebnisse der Interviewstudie und der Beobachtungen werden detailliert dargestellt und in Bezug zu den theoretischen Grundlagen und Forschungsfragen diskutiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammenfasst und einen Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsfragen gibt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sprach-Kitas, Inklusive Pädagogik, Sprachförderung, Alltagsintegrierte Sprachliche Bildung, Sprachförderkompetenz, Inklusion, Kindertagesstätten, Thüringen, empirische Forschung, Interviewstudie, Beobachtung.
- Quote paper
- Elisa Herschleb (Author), 2017, Inklusive Pädagogik an Kindertagesstätten in Thüringen. Das Programm "Sprach-Kitas" und seine Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470511