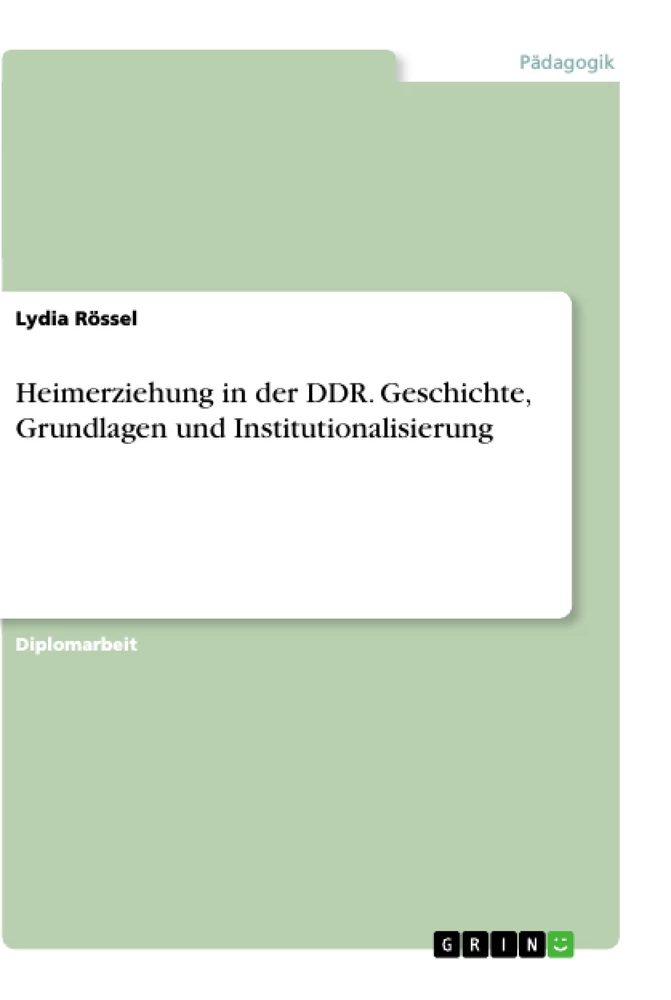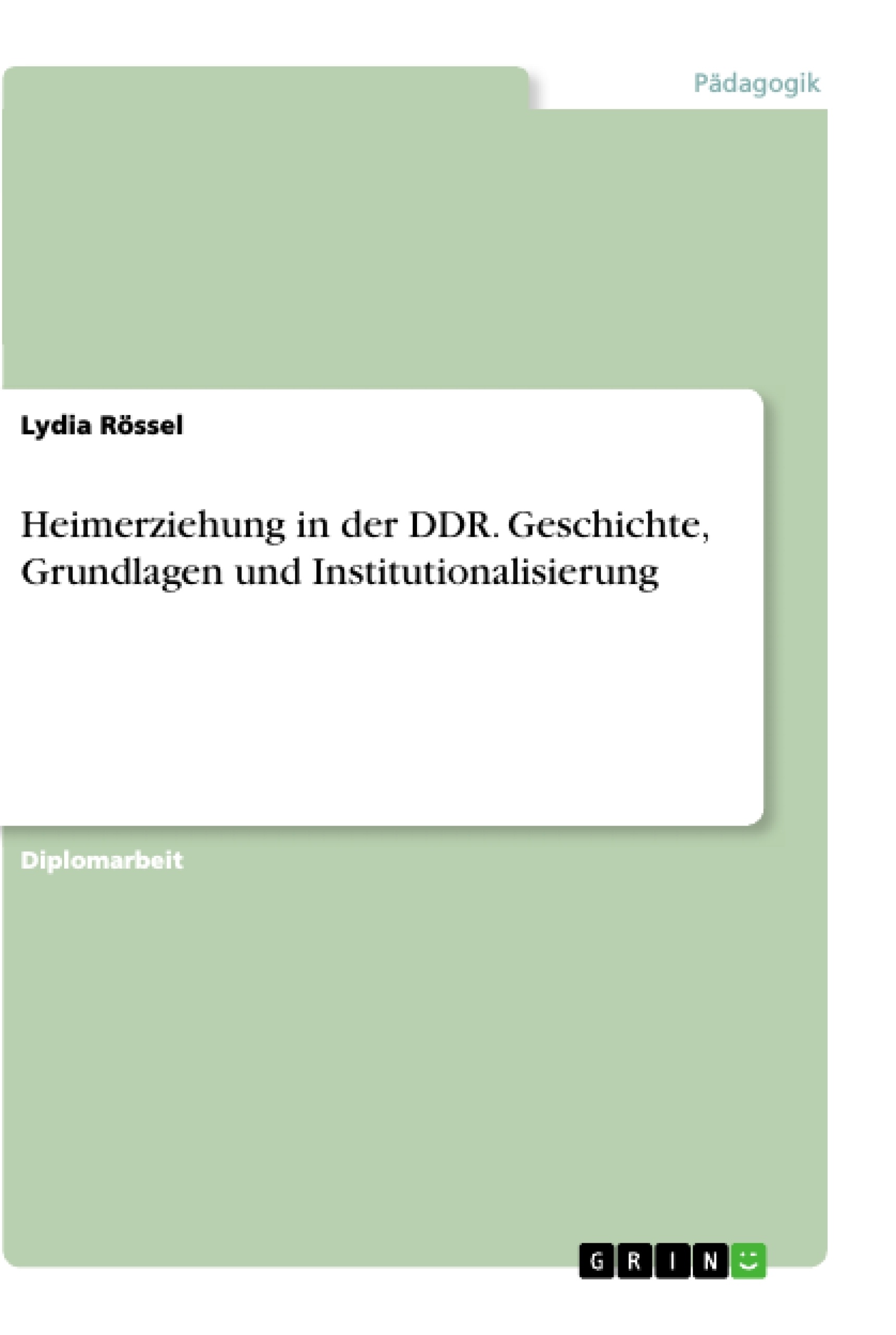Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die Heimerziehung in der DDR zu geben und ihre Geschichte, Grundlagen und Institutionen zu erläutern. Dazu wird zunächst die Jugendhilfe in der Deutschen Demokratischen Republik behandelt. Anschließend beschäftigt sich diese Diplomarbeit ausführlich mit der Geschichte der Heimerziehung in der DDR. Dabei werden zunächst die wichtigsten Wurzeln dargestellt, welche sich hauptsächlich aus Reformpädagogik, Nationalsozialismus und der Sowjetpädagogik zusammensetzen. Darauf folgt eine Darstellung der Entwicklung der Heimerziehung, beginnend beim Umgang mit den Kriegsfolgen und dem Neuaufbau der Heimerziehung. Im Anschluss daran werden die einzelnen Stadien beleuchtet, welche das Heimkonzept durchlief. Dazu gehören die Planungseuphorie der DDR-Funktionäre, die Neudifferenzierung innerhalb der Spezialheime und zahlreiche Pläne, wie man die strukturellen Gegebenheiten modifizieren könnte.
Um die Grundlagen der Heimerziehung aufzuzeigen, werden zunächst die Rahmenbedingungen geklärt, bevor genauer auf die Zusammensetzung, die Qualifikation und die Aufgabenbereiche des Personals eingegangen wird. Anschließend erfolgt eine nähere Erörterung des Aufgabenfeldes der Heimerziehung. Dazu soll zunächst geklärt werden, welche Familien und Kinder in das Blickfeld der Jugendhilfe gerieten, bevor die zentralen Begriffe der Heimerziehung dargestellt werden.
Darauf folgt detailliert das pädagogische Konzept der DDR-Heimerziehung. Im Anschluss daran wird das Prinzip der Kollektiverziehung erläutert, die das Herzstück der DDR-Heimerziehung bildete. Gegen Ende der Arbeit wird die Institutionalisierung der Heimerziehung in der DDR betrachtet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Jugendwerkhöfen in der DDR. Im letzten Teil dieser Arbeit werden einige Gedanken zur Heimerziehung erläutert, welche unter Einbezug wesentlicher Punkte der DDR-Heimerziehung ein Konzept für die Gegenwart darstellen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Jugendhilfe in der DDR
- 2.1 Geschichte der Jugendhilfe in der SBZ/DDR
- 2.2 Die Organe
- 2.3 Die Arbeitsweise
- 2.4 Das Pädagogische Konzept
- 3. Geschichte der Heimerziehung in der DDR
- 3.1 Historische Grundlagen der DDR-Heimerziehung
- 3.1.1 Die Reformpädagogik
- 3.1.2 Die Zeit des Nationalsozialismus
- 3.1.3 Auswirkungen der Sowjetpädagogik auf die DDR-Heimerziehung
- 3.2 Entwicklung der Heimerziehung in der DDR
- 3.2.1 Neubeginn und Umgang mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges
- 3.2.2 Verplanung und Differenzierung
- 3.2.3 Neudifferenzierung innerhalb der Spezialheime
- 3.2.4 Pläne zur Reform von strukturellen Gegebenheiten in der Heimerziehung
- 4. Grundlagen der Heimerziehung in der DDR
- 4.1 Rahmenbedingungen
- 4.2 Personal
- 4.3 Problem- und Aufgabenbeschreibungen
- 4.3.1 Das Aufgabenfeld Familie
- 4.3.2 Gefährdete und gefährliche Kinder
- 4.3.3 Zentrale Begriffe in der Heimerziehung der DDR
- 5. Das pädagogische Konzept der DDR-Heimerziehung
- 5.1 Anton Semjonowitsch Makarenko
- 5.2 Kollektiverziehung
- 5.2.1 Die Kollektiverziehung bei Makarenko
- 5.2.2 Die Kollektiverziehung in der DDR-Heimerziehung
- 5.3 Arbeitserziehung
- 5.3.1 Die Arbeitserziehung bei Makarenko
- 5.3.2 Die Arbeitserziehung in der DDR-Heimerziehung
- 5.4 Die Politisch-ideologische Erziehung in der DDR
- 5.4.1 Die Zeitungsschau
- 5.4.2 Die Öffentlichkeitsarbeit in den Heimen der DDR
- 5.4.3 Die Rolle der FDJ in der DDR-Heimerziehung
- 5.4.4 Die Wehrerziehung innerhalb der DDR-Heimerziehung
- 5.4.5 Politische Provokationen seitens der Jugendlichen in den Jugendwerkhöfen
- 6. Institutionalisierung der DDR-Heimerziehung
- 6.1 Strukturmerkmale
- 6.2 Normalheime
- 6.3 Spezialheime
- 6.4 Durchgangsheime
- 6.5 Sonderheime für verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche
- 6.6 Die Jugendwerkhöfe in der DDR-Heimerziehung
- 6.6.1 Das Aufnahmeverfahren in die Jugendwerkhöfe
- 6.6.2 Unterschiede zwischen den Jugendwerkhöfen
- 6.6.3 Erziehungskonzept
- 6.6.4 Die Entlassung der Jugendlichen aus den Jugendwerkhöfen und deren Nachbetreuung
- 6.7 Der geschlossene Jugendwerkhof in Torgau
- 6.7.1 Struktur der Einrichtung
- 6.7.2 Einweisung und Aufnahme in den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau
- 6.7.3 Das Erziehungsprogramm
- 6.7.4 Der Tagesablauf
- 6.7.5 Erziehungsmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Heimerziehung in der DDR, beleuchtet ihre historische Entwicklung, die zugrundeliegenden Konzepte und ihre institutionelle Gestaltung. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Heimerziehung im Kontext des DDR-Systems zu vermitteln und die komplexen Herausforderungen und Widersprüche aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung der Heimerziehung in der DDR
- Pädagogische Konzepte und ihre ideologischen Grundlagen
- Institutionelle Strukturen und ihre Auswirkungen auf die Erziehung
- Rahmenbedingungen und das Personal der Heime
- Analyse der Problemfelder und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt mit einem Zitat aus dem geschlossenen Jugendwerkhof Torgau in die Thematik ein und verdeutlicht das zentrale Dilemma der DDR-Heimerziehung: den Konflikt zwischen guten Absichten und der Vernachlässigung des Wohls der Kinder und Jugendlichen durch politische Ideologie und übertriebene Planung. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über Geschichte, Grundlagen und Institutionen der DDR-Heimerziehung zu geben.
2. Die Jugendhilfe in der DDR: Dieses Kapitel beschreibt die Jugendhilfe in der DDR, beginnend mit ihrer Geschichte in der SBZ/DDR. Es analysiert die Organe und Arbeitsweisen der Jugendhilfe und beleuchtet das pädagogische Konzept, um den Kontext und die Herausforderungen der Heimerziehung zu verstehen. Die Darstellung schafft eine Grundlage für die spätere detaillierte Auseinandersetzung mit der Heimerziehung selbst.
3. Geschichte der Heimerziehung in der DDR: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der DDR-Heimerziehung, die in der Reformpädagogik, den Auswirkungen des Nationalsozialismus und der Sowjetpädagogik liegen. Es verfolgt die Entwicklung der Heimerziehung von den Nachkriegsjahren bis hin zur Neudifferenzierung in Spezialheimen und den verschiedenen Reformversuchen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Phasen und ihren jeweiligen Charakteristika.
4. Grundlagen der Heimerziehung in der DDR: Dieses Kapitel erläutert die Rahmenbedingungen der Heimerziehung in der DDR, analysiert das Personal hinsichtlich seiner Zusammensetzung, Qualifikation und Aufgabenbereiche. Es beschreibt das Aufgabenfeld der Heimerziehung, indem es die Zielgruppen (Familien und Kinder) und zentrale Begriffe der DDR-Heimerziehung definiert. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der praktischen Umsetzung der pädagogischen Konzepte.
5. Das pädagogische Konzept der DDR-Heimerziehung: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf dem pädagogischen Konzept, wobei die Einflüsse von Anton Semjonowitsch Makarenko (Kollektiverziehung und Arbeitserziehung) im Zentrum stehen. Es vergleicht die Konzepte Makarenkos mit ihrer Umsetzung in der DDR-Heimerziehung und analysiert den starken Einfluss der politisch-ideologischen Erziehung, einschließlich der Rolle von FDJ und Wehrerziehung.
6. Institutionalisierung der DDR-Heimerziehung: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen institutionellen Strukturen der DDR-Heimerziehung, von Normal- und Spezialheimen bis hin zu Durchgangs- und Sonderheimen sowie den Jugendwerkhöfen. Es analysiert die Strukturen, Aufnahmeverfahren, Erziehungskonzepte und die Nachbetreuung, wobei der geschlossene Jugendwerkhof Torgau als besonders relevantes Beispiel detailliert dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Heimerziehung, DDR, Jugendhilfe, Kollektiverziehung, Arbeitserziehung, Politisch-ideologische Erziehung, Jugendwerkhöfe, Reformpädagogik, Sowjetpädagogik, Nationalsozialismus, Institutionalisierung, Rahmenbedingungen, Personal.
Häufig gestellte Fragen zur Heimerziehung in der DDR
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Heimerziehung in der DDR. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung, den pädagogischen Konzepten, den institutionellen Strukturen und den Herausforderungen der Heimerziehung im Kontext des DDR-Systems.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Die Geschichte der Jugendhilfe und Heimerziehung in der DDR, die Einflüsse von Reformpädagogik, Nationalsozialismus und Sowjetpädagogik, die pädagogischen Konzepte (Kollektiverziehung, Arbeitserziehung, politisch-ideologische Erziehung), die verschiedenen institutionellen Strukturen (Normalheime, Spezialheime, Jugendwerkhöfe, u.a.), die Rahmenbedingungen und das Personal der Heime sowie die Herausforderungen und Problemfelder der DDR-Heimerziehung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in sechs Kapitel gegliedert: 1. Einleitung; 2. Die Jugendhilfe in der DDR; 3. Geschichte der Heimerziehung in der DDR; 4. Grundlagen der Heimerziehung in der DDR; 5. Das pädagogische Konzept der DDR-Heimerziehung; 6. Institutionalisierung der DDR-Heimerziehung. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Welche Rolle spielte die politische Ideologie in der DDR-Heimerziehung?
Die politische Ideologie spielte eine zentrale Rolle in der DDR-Heimerziehung. Das pädagogische Konzept war stark von der politisch-ideologischen Erziehung geprägt, einschließlich der Rolle der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und der Wehrerziehung. Diese Einflüsse werden im Dokument detailliert analysiert und ihre Auswirkungen auf die Erziehung der Kinder und Jugendlichen beleuchtet.
Welche Arten von Heimen gab es in der DDR?
Die DDR kannte verschiedene Arten von Heimen: Normalheime, Spezialheime, Durchgangsheime, Sonderheime für verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche sowie Jugendwerkhöfe (einschließlich eines geschlossenen Jugendwerkhofs in Torgau). Das Dokument beschreibt die Strukturen, Aufnahmeverfahren und Erziehungskonzepte dieser verschiedenen Einrichtungen.
Wie wurde die Kollektiverziehung und Arbeitserziehung in der DDR-Heimerziehung umgesetzt?
Die Kollektiverziehung und Arbeitserziehung, stark beeinflusst von Anton Semjonowitsch Makarenko, waren zentrale Elemente des pädagogischen Konzepts. Das Dokument vergleicht die Konzepte Makarenkos mit ihrer Umsetzung in der DDR und analysiert deren praktische Anwendung in den verschiedenen Heimen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Die Schlüsselwörter des Dokuments umfassen: Heimerziehung, DDR, Jugendhilfe, Kollektiverziehung, Arbeitserziehung, Politisch-ideologische Erziehung, Jugendwerkhöfe, Reformpädagogik, Sowjetpädagogik, Nationalsozialismus, Institutionalisierung, Rahmenbedingungen und Personal.
Welches Ziel verfolgt dieses Dokument?
Ziel des Dokuments ist es, ein umfassendes Bild der Heimerziehung in der DDR zu vermitteln. Es soll die historische Entwicklung, die zugrundeliegenden Konzepte und die institutionelle Gestaltung der Heimerziehung im Kontext des DDR-Systems beleuchten und die komplexen Herausforderungen und Widersprüche aufzeigen.
- Citation du texte
- Lydia Rössel (Auteur), 2009, Heimerziehung in der DDR. Geschichte, Grundlagen und Institutionalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470005