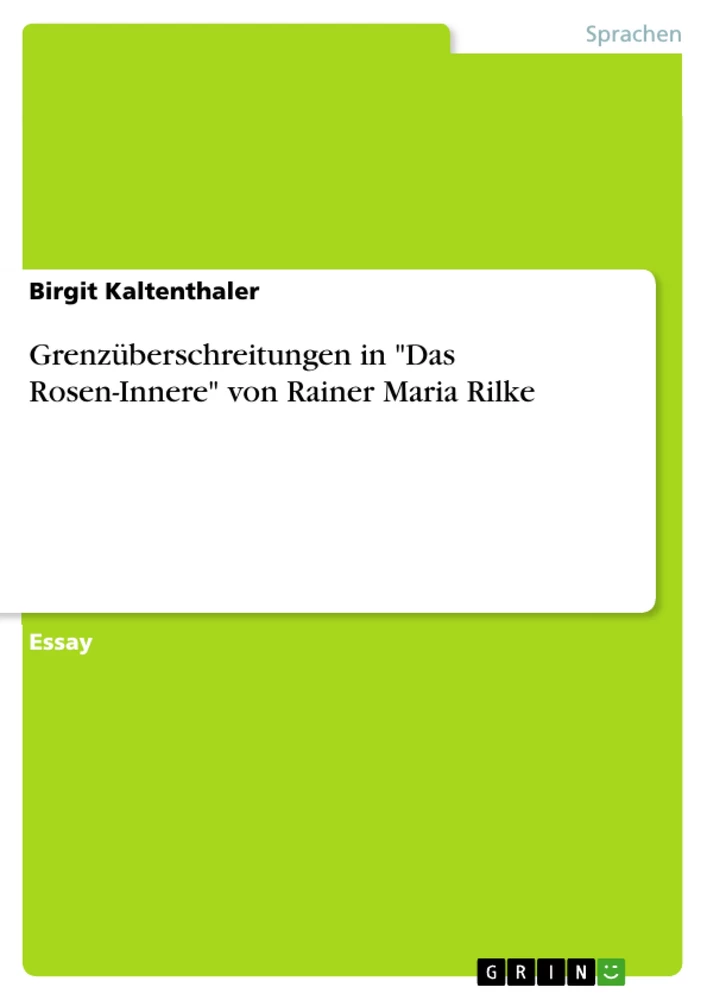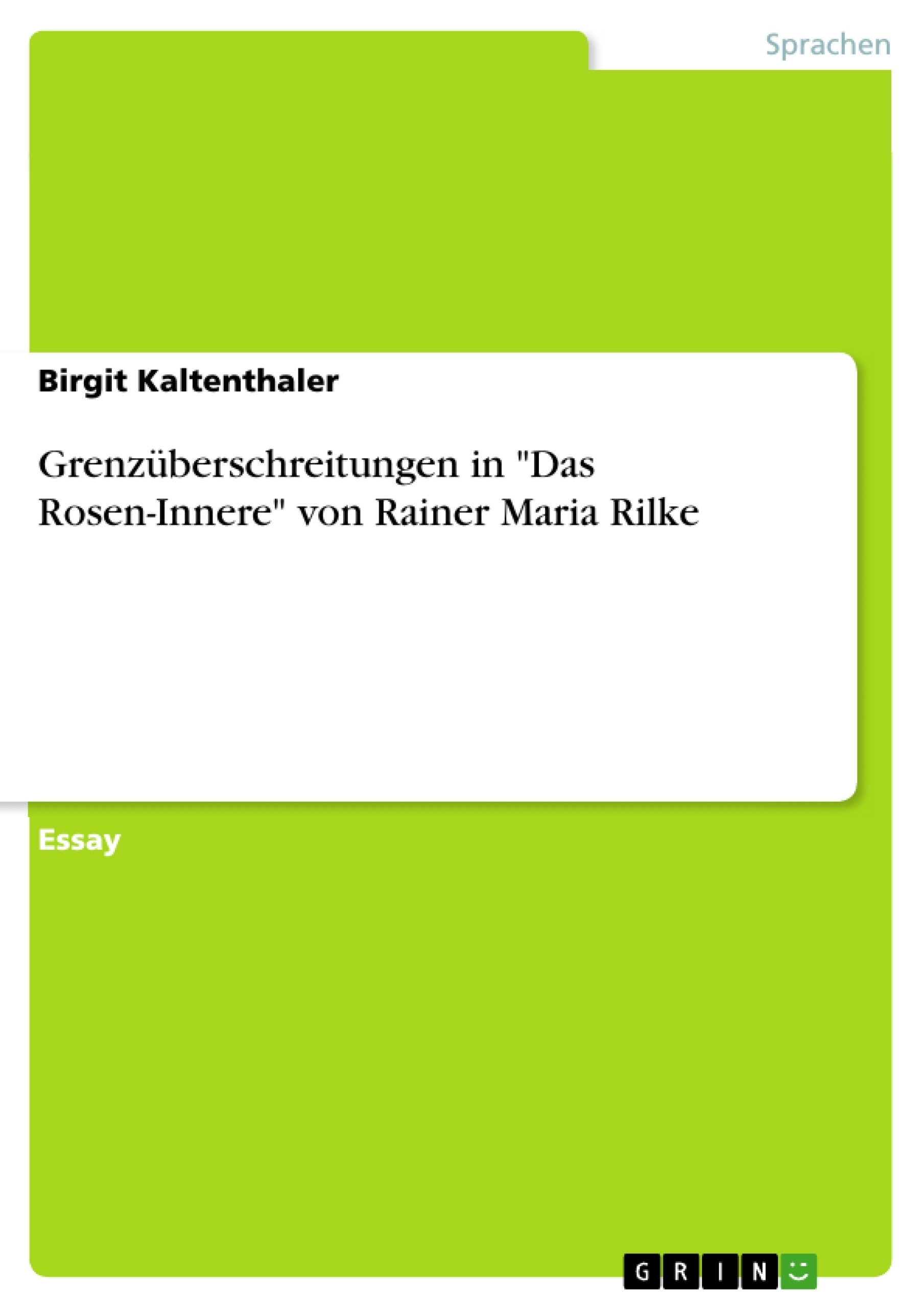Nicht mit Pinsel und Farben, sondern mit Buchstaben, Wörtern, Zeichen und Stilmitteln hat Rainer Maria Rilke (1875–1926) im Jahr 1907 eines seiner zahlreichen Rosen-Bilder, Das Rosen-Innere , zu Papier gebracht. Der Betrachter, Leser bzw. Zuhörer nimmt hier einen Wort- und Klangteppich wahr, der Räume öffnet und wieder schließt, der Grenzen (auf)löst und wieder neu setzt. Ich möchte untersuchen, inwiefern strukturelle Merkmale mit dem Inhalt der Verse 1 bis 10 übereinstimmen und welchen Effekt die Enjambements in Bezug auf Optik, Klang und Inhalt erzielen.
Beim ersten Blick auf die äußere Form fällt das Fehlen von Strophen auf. Es gibt keine optischen Begrenzungen der 18 kurzen Verse untereinander, die außerdem ein regelmäßiges Versmaß vermissen lassen. Nur selten kommt es zu Sprechpausen am Ende der Verse, viele davon werden in die nächste Zeile hinübergebunden. Die Versgrenzen werden insgesamt zwölfmal gebrochen und damit nicht nur inhaltlich, sondern auch klanglich überschritten. Optisch stellen die Zeilenumbrüche das dominante Ordnungsprinzip dar. Sie bestätigen, dass es sich um die äußere Form eines Gedichts (im Gegensatz zur Prosa) handelt. Das Rosen-Innere scheint gerade dadurch, dass der rhythmische Abschluss der Verse des Öfteren nicht mit dem syntaktischen zusammenfällt , belebt zu werden. „Das Enjambement ist ein Ende, das keines ist.“ , schreibt Gerhard Kurz. Dieses Stilmittel zeigt in Rilkes Gedicht ein kontinuierliches Ineinanderfließen der Verse, wie ständig neu heranrollende Meereswellen, die sich auftürmen, brechen und schließlich wieder mit dem großen Ganzen verschmelzen.
Inhaltsverzeichnis
- Grenzüberschreitungen in Das Rosen-Innere
- Äußere Form und Enjambements
- Innen und Außen: Die ersten fünf Verse
- Offene Rosen und Lautmalerei: Verse 6-10
- Fragilität und Appell: Verse 10-18
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Enjambements in Rainer Maria Rilkes Gedicht "Das Rosen-Innere" und deren Wirkung auf Form, Klang und Inhalt. Es wird analysiert, inwiefern strukturelle Merkmale mit dem Inhalt korrespondieren und welchen Effekt die Zeilensprünge erzielen.
- Die Rolle von Enjambements in der Gestaltung des Gedichts
- Das Verhältnis von Innen und Außen im Gedicht
- Die lautmalerische Gestaltung und ihre Bedeutung
- Die Thematik der Vergänglichkeit und Fragilität
- Der Appell an den Leser/Zuhörer
Zusammenfassung der Kapitel
Grenzüberschreitungen in Das Rosen-Innere: Diese Einleitung stellt Rilkes Gedicht "Das Rosen-Innere" vor und skizziert die Forschungsfrage: Wie wirken die strukturellen Merkmale, insbesondere die Enjambements, auf den Inhalt und den Gesamteindruck des Gedichts? Die Arbeit kündigt die Analyse der ersten zehn Verse an und fokussiert auf die Beziehung zwischen äußerer Form und innerem Gehalt. Es wird die These aufgestellt, dass die Enjambements nicht nur klangliche, sondern auch inhaltliche Überschreitungen repräsentieren.
Äußere Form und Enjambements: Dieses Kapitel analysiert die äußere Form des Gedichts. Das Fehlen von Strophen und das häufige Enjambement werden als stilistische Mittel hervorgehoben, welche die optische und klangliche Gestaltung prägen. Die Arbeit erläutert, wie die Versgrenzen durch die Enjambements durchbrochen werden und ein kontinuierliches Ineinanderfließen der Verse erzeugen. Dies wird mit dem Bild von Meereswellen verglichen, die sich auftürmen, brechen und wieder verschmelzen. Die optischen Zeilenumbrüche als dominantes Ordnungsprinzip werden ebenfalls diskutiert.
Innen und Außen: Die ersten fünf Verse: Die Analyse konzentriert sich auf die ersten fünf Verse, die mit drei W-Fragen beginnen. Es wird gezeigt, wie die Enjambements die klangliche Spannung erhöhen und eine enge Verbindung zwischen den Verszeilen herstellen. Der Fokus liegt auf den Reimwörtern ("Innen/Linnen/drinnen" und "Weh/see") und ihrer Rolle im Kontext des Themas "Innen" und "Außen". Die Wiederaufnahme dieser Reime wird als "falsch platzierter Echoreim" interpretiert, der das Reflektieren des Himmels im Wasser symbolisiert. Die Verbindung von Form und Inhalt durch die Positionierung der Reime wird hervorgehoben. Die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Innen und Außen wird als rhetorische Frage identifiziert, die die Verflechtung beider Aspekte impliziert.
Offene Rosen und Lautmalerei: Verse 6-10: Dieses Kapitel untersucht die Verse 6-10, in denen die Rosen erstmals explizit erwähnt werden. Die Beschreibung der "offenen Rosen" wird analysiert, wobei die Personifikation der Rosen ("sorglos") und deren Wirkung auf den Leser betont wird. Der Schwerpunkt liegt auf der lautmalerischen Gestaltung dieser Verse, insbesondere auf dem Wechsel zwischen hellen I- und dunklen O-Vokalen und der Verwendung von stimmhaften Konsonanten. Die lautliche Struktur wird als "Unterströmung an Bedeutung" interpretiert, die das Bild der offenen, losen Rosen unterstreicht und Assoziationen mit Vergänglichkeit weckt. Die Kongruenz von Inhalt und lautlicher Struktur wird erneut betont.
Schlüsselwörter
Rainer Maria Rilke, Das Rosen-Innere, Enjambement, Form und Inhalt, Klanggestaltung, Lautmalerei, Vergänglichkeit, Innen und Außen, Rhetorische Frage, Appell.
Häufig gestellte Fragen zu Rilkes "Das Rosen-Innere"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Rainer Maria Rilkes Gedicht "Das Rosen-Innere" mit einem Fokus auf die Wirkung der Enjambements auf Form, Klang und Inhalt. Es untersucht, wie strukturelle Merkmale mit dem Inhalt korrespondieren und welchen Effekt die Zeilensprünge erzielen.
Welche Themen werden im Gedicht und in der Analyse behandelt?
Zentrale Themen sind die Rolle der Enjambements in der Gestaltung des Gedichts, das Verhältnis von Innen und Außen, die lautmalerische Gestaltung und ihre Bedeutung, die Thematik der Vergänglichkeit und Fragilität sowie der Appell an den Leser/Zuhörer.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in folgende Kapitel: "Grenzüberschreitungen in Das Rosen-Innere" (Einleitung und Forschungsfrage), "Äußere Form und Enjambements" (Analyse der äußeren Form und des Enjambements), "Innen und Außen: Die ersten fünf Verse" (Analyse der ersten fünf Verse und des Verhältnisses von Innen und Außen), "Offene Rosen und Lautmalerei: Verse 6-10" (Analyse der Verse 6-10 mit Fokus auf Lautmalerei und Personifikation) und implizit ein abschließendes Kapitel, das in der Zusammenfassung der Kapitel enthalten ist.
Wie werden die Enjambements in der Analyse interpretiert?
Die Enjambements werden als stilistische Mittel interpretiert, welche die optische und klangliche Gestaltung prägen und inhaltliche Überschreitungen repräsentieren. Sie erzeugen ein kontinuierliches Ineinanderfließen der Verse, vergleichbar mit Meereswellen. Sie erhöhen die klangliche Spannung und schaffen enge Verbindungen zwischen den Verszeilen.
Welche Rolle spielt die Lautmalerei?
Die lautmalerische Gestaltung, insbesondere der Wechsel zwischen hellen I- und dunklen O-Vokalen und die Verwendung von stimmhaften Konsonanten, wird als "Unterströmung an Bedeutung" interpretiert, die das Bild der offenen, losen Rosen unterstreicht und Assoziationen mit Vergänglichkeit weckt. Es wird eine Kongruenz zwischen Inhalt und lautlicher Struktur betont.
Wie wird das Verhältnis von "Innen" und "Außen" im Gedicht dargestellt?
Das Verhältnis von "Innen" und "Außen" wird als zentrale Frage des Gedichts betrachtet, die durch rhetorische Fragen und die Wiederaufnahme von Reimen ("Innen/Linnen/drinnen" und "Weh/see") veranschaulicht wird. Die Verflechtung beider Aspekte wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rainer Maria Rilke, Das Rosen-Innere, Enjambement, Form und Inhalt, Klanggestaltung, Lautmalerei, Vergänglichkeit, Innen und Außen, Rhetorische Frage, Appell.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass die Enjambements in Rilkes "Das Rosen-Innere" nicht nur klangliche, sondern auch inhaltliche Überschreitungen repräsentieren und eine enge Verbindung zwischen äußerer Form und innerem Gehalt herstellen.
- Citar trabajo
- Birgit Kaltenthaler (Autor), 2019, Grenzüberschreitungen in "Das Rosen-Innere" von Rainer Maria Rilke, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468888