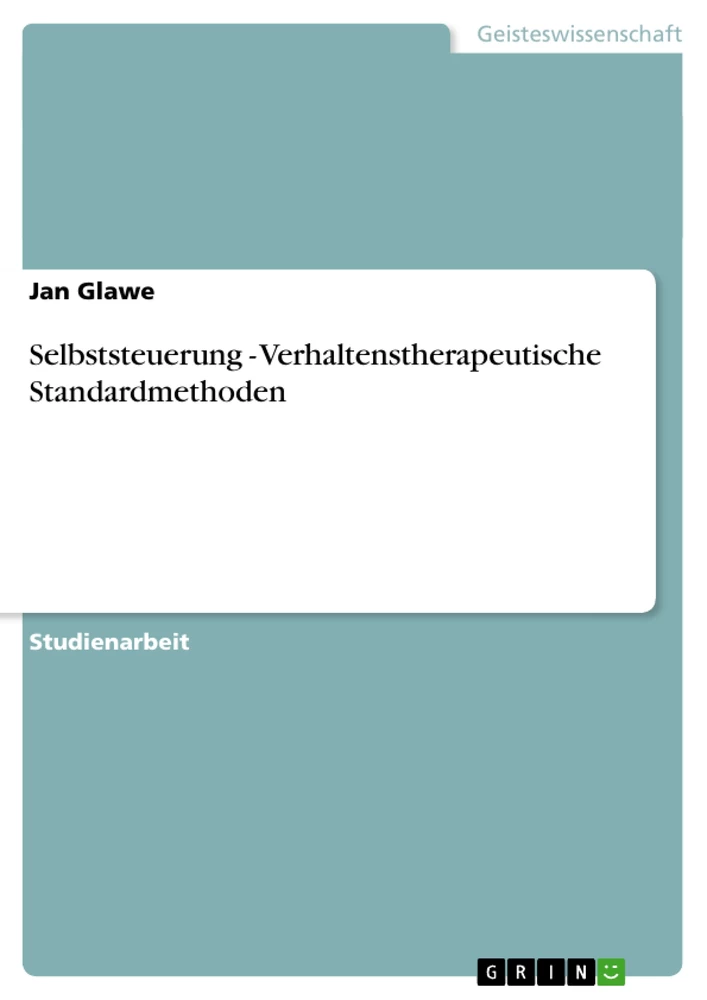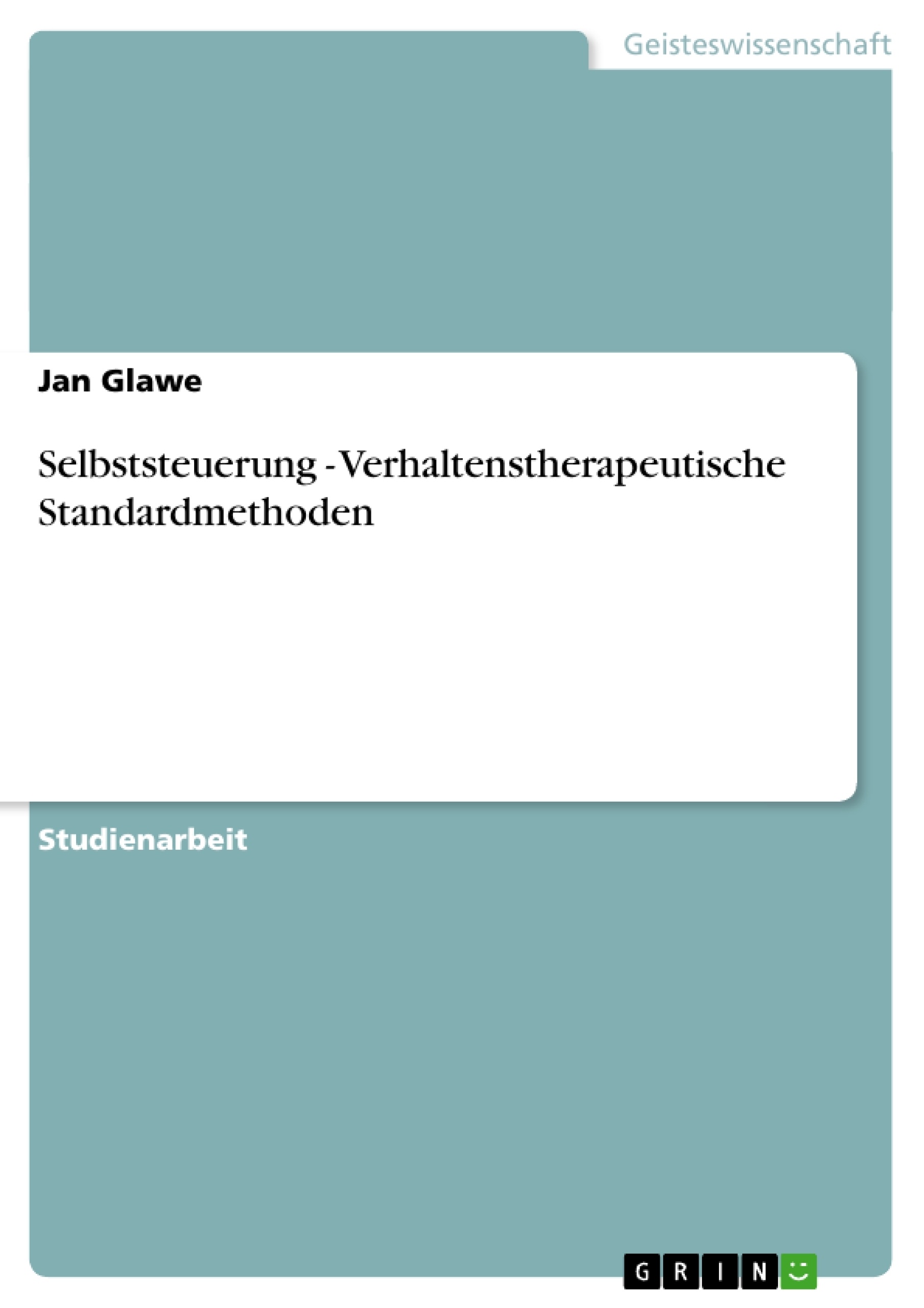Inhaltsverzeichnis
Einleitung ... 1
1. Selbstbeobachtung ... 1
1.1 Theoretische und empirische Grundlagen ... 2
1.2 Selbstbewertung und Selbstverstärkung ... 3-4
2. Soziale Kontrakte ... 4-5
2.1 Theoretische und empirische Grundlagen ... 5-6
2.2 Vertragsvereinbarung ... 6-7
3. Stimuluskontrolle ... 7
3.1 Theoretische und empirische Grundlagen ... 7-8
3.2 Praktische Anwendung ... 8
4. Selbstverstärkung und Bestrafung ... 8-9
4.1 Theoretische und empirische Grundlagen ... 9
4.2 Praktische Anwendung ... 9-11
5. Gedankenstopp ... 11-12
5.1 Theoretische und empirische Grundlagen ... 12
5.2 Praktische Anwendung ... 12
6. Verdecktes Konditionieren ... 13-14
6.1 Theoretische und empirische Grundlagen ... 15-16
6.2 Praktische Anwendung ... 16
7. Anleitung zum „eigenen Therapeuten“ ... 17
7.1 Programme zur Selbstmodifikation ... 17
7.2 Theoretische und empirische Grundlagen ... 18
8. Zusammenfassung ... 19
9. Quellenangabe ... 19
Einleitung
Diese Hausarbeit ist im Rahmen der Veranstaltung „Verhaltenstherapeutische Standardmethoden“ entstanden. Mit dieser Arbeit werde ich mich mit dem Thema der Selbststeuerung intensiv auseinandersetzen und ihrer Teildisziplinen für mich überschaubar machen. Neben der Selbstbeobachtung und den Sozialen Kontrakten, werde ich auf die Stimuluskontrolle, die Selbstverstärkung und -bestrafung, den Gedankenstopp, das Verdeckte Konditionieren und auf das „eigene Therapeuten“ eingehen. Neben der Beschreibung des Ablaufs dieser Methoden werde ich zusätzlich auf die empirischen Grundlagen und die praktische Anwendung eingehen.
1 Selbstbeobachtung
Als „Basisfähigkeiten“ für den Prozess der Selbststeuerung werden die Selbstbeobachtung und Selbstprotokollierung angesehen. Eine planvolle und selbstgesteuerte Verhaltensmodifikation wäre, ohne eine Beobachtung des problematischen Verhaltens in bestimmten Situationen und das Festhalten der Ergebnisse, nicht möglich. Durch die Selbstbeobachtung werden sogar schon Veränderungen in Gang gesetzt. Doch erfordert eine systematische Selbstbeobachtung zumindest in der Anfangsphase eine Anleitung durch einen Therapeuten. Schritte zum Aufbau von systematischer Selbstbeobachtung schlägt Kanfer (1975, 1980) vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstbeobachtung
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Selbstbewertung und Selbstverstärkung
- Soziale Kontrakte
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Vertragsvereinbarung
- Stimuluskontrolle
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Praktische Anwendung
- Selbstverstärkung und Bestrafung
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Praktische Anwendung
- Gedankenstopp
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Praktische Anwendung
- Verdecktes Konditionieren
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Praktische Anwendung
- Anleitung zum „eigenen Therapeuten“
- Programme zur Selbstmodifikation
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Zusammenfassung
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Selbststeuerung und analysiert die wichtigsten verhaltenstherapeutischen Standardmethoden, die für die Selbststeuerung relevant sind. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den Grundlagen und der praktischen Anwendung dieser Methoden. Neben der Selbstbeobachtung werden auch Soziale Kontrakte, Stimuluskontrolle, Selbstverstärkung und -bestrafung, Gedankenstopp, Verdecktes Konditionieren und die Anleitung zum "eigenen Therapeuten" behandelt.
- Selbstbeobachtung und Selbstprotokollierung als Basisfähigkeiten für die Selbststeuerung
- Theoretische und empirische Grundlagen der Selbststeuerung und deren Einfluss auf das Verhalten
- Praktische Anwendung von verhaltenstherapeutischen Standardmethoden in der Selbststeuerung
- Veränderungen und Herausforderungen bei der Selbststeuerung
- Entwicklung von Strategien zur erfolgreichen Selbststeuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Selbststeuerung und die Ziele der Hausarbeit vor. Sie zeigt die Relevanz der verhaltenstherapeutischen Standardmethoden für die Selbststeuerung und stellt die Themengebiete der Arbeit vor.
Selbstbeobachtung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen und empirischen Grundlagen der Selbstbeobachtung und Selbstprotokollierung. Es wird erläutert, wie die Selbstbeobachtung als "Basisfähigkeit" für die Selbststeuerung fungiert und welche Rückwirkende Effekte sie auf das Verhalten hat. Der Einfluss von Feedback- und Operantenmodellen auf die Selbstbeobachtung werden diskutiert.
Soziale Kontrakte
Dieses Kapitel behandelt die Theorie und Praxis von Sozialen Kontrakten. Es werden die theoretischen Grundlagen des Konzepts der Sozialen Kontrakte sowie die praktische Anwendung in der Verhaltenstherapie erläutert. Das Kapitel geht auf die Bedeutung der Vertragsvereinbarung und die Rolle von Sozialen Kontrakten bei der Veränderung von Verhalten ein.
Stimuluskontrolle
Das Kapitel beleuchtet die Stimuluskontrolle als eine wichtige Methode der Selbststeuerung. Es werden die theoretischen Grundlagen der Stimuluskontrolle sowie die praktische Anwendung im therapeutischen Kontext besprochen. Das Kapitel geht auf die Bedeutung von Reizkontrolle und deren Anwendung bei der Verhaltensmodifikation ein.
Selbstverstärkung und Bestrafung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Prinzipien der Selbstverstärkung und -bestrafung. Es werden die theoretischen Grundlagen der Selbstverstärkung und -bestrafung sowie deren Anwendung in der Selbststeuerung erläutert. Das Kapitel geht auf die verschiedenen Möglichkeiten der Selbstverstärkung und -bestrafung sowie auf deren Vor- und Nachteile ein.
Gedankenstopp
Dieses Kapitel behandelt den Gedankenstopp als eine Methode der Selbststeuerung. Es werden die theoretischen Grundlagen des Gedankenstopps sowie die praktische Anwendung in der Verhaltenstherapie erläutert. Das Kapitel geht auf die Bedeutung von Gedankenkontrolle und deren Anwendung bei der Veränderung von negativen Gedanken ein.
Verdecktes Konditionieren
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verdeckten Konditionieren als eine Methode der Selbststeuerung. Es werden die theoretischen Grundlagen des Verdeckten Konditionierens sowie die praktische Anwendung in der Verhaltenstherapie erläutert. Das Kapitel geht auf die Bedeutung von Reiz- und Reaktionssystemen und deren Anwendung bei der Veränderung von Verhalten ein.
Anleitung zum „eigenen Therapeuten“
Dieses Kapitel stellt die Methode der "eigenen Therapeuten" vor. Es werden die Prinzipien der Selbstmodifikation und die theoretischen Grundlagen des Konzepts "eigener Therapeut" erläutert. Das Kapitel geht auf die Anwendung von Programmen zur Selbstmodifikation und deren Nutzen für die Selbststeuerung ein.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den wichtigsten verhaltenstherapeutischen Standardmethoden der Selbststeuerung. Zu den zentralen Schlüsselbegriffen gehören: Selbstbeobachtung, Selbstprotokollierung, Selbstbewertung, Selbstverstärkung, Soziale Kontrakte, Stimuluskontrolle, Gedankenstopp, Verdecktes Konditionieren, "eigener Therapeut" und Selbstmodifikation.
- Quote paper
- Jan Glawe (Author), 2005, Selbststeuerung - Verhaltenstherapeutische Standardmethoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46878