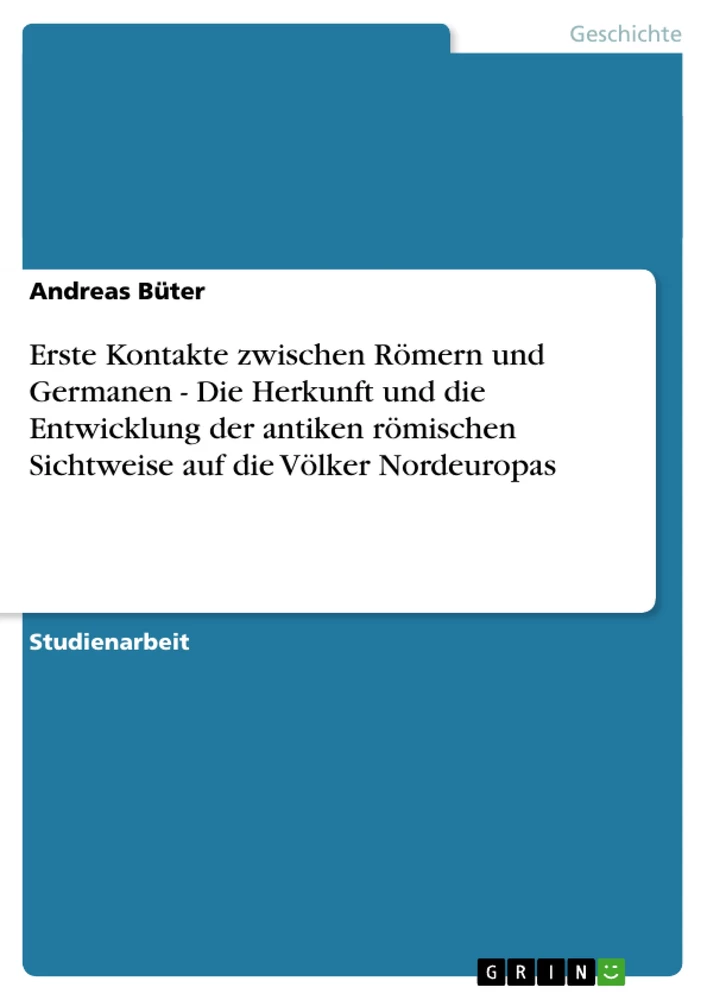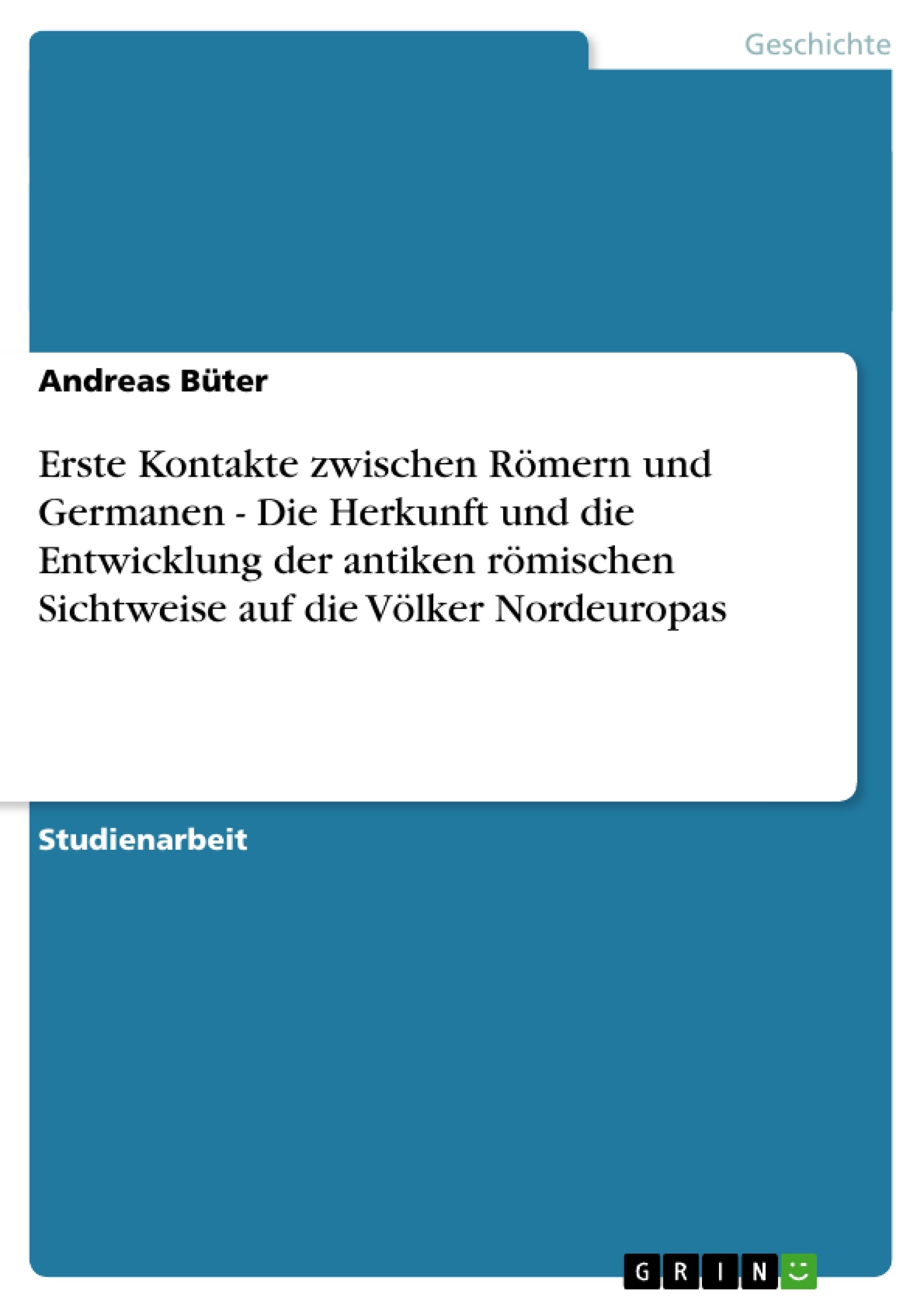Römer, Germanen, Kelten, Antike, Barbaren, Ethnozentrismus, Fremdenbild, Fremdenangst, Xenophobie, Keltensturm, Polybios, Livius, politische Instrumentalisierung. -
Heutige Kenntnisse über das Verhältnis Roms zu den Völkern nördlich der Alpen entstammen neben archäologischen Funden, fast ausschließlich römischen Schriftquellen.
Diese geben im wesentlichen eine subjektive römisch-mediterrane Perspektive wieder und sind zudem oftmals nur fragmentarisch erhalten. Es stellt sich die Frage, woher die meist einseitige römische Darstellung und Charakterisierung ihrer nördlichen Nachbarn stammt, und aus welchen Gründen sich dieses Bild zunehmend in einen undifferenzierten, verallgemeinernden Bereich verschoben hat. Außerdem soll untersucht werden, ob diese Verschiebung aus Unwissenheit bestimmter antiker Autoren geschah, oder ob sich dahinter ein bestimmtes Motiv verbirgt.
Die zeitliche Eingrenzung des bearbeitenden Bereiches erstreckt sich von der Lebenszeit des Hekataios bis zu Titus Livius und Strabon, also etwa vom sechsten Jahrhundert vor, bis zum zweiten Jahrzehnt nach Christus.
Dem methodischen Vorgehen dieser Arbeit liegt ein begriffsgeschichtlicher Ansatz zugrunde. Die Herkunft und die Entwicklung bestimmter Begrifflichkeiten soll im historischen Zusammenhang beschrieben und gleichzeitig kritisch hinterfragt werden.
Verschiedene antike Autoren, Historiker und Geographen, in deren Werken Völkernamen wie Kelten, Skythen oder Germanen auftauchen, werden, wenn auch nur ansatzweise, auf ihre jeweilige Intention hin untersucht.
Im zweiten Teil der Arbeit wird der „Keltensturm“ von 387/6 v.Chr. als Grundereignis für die Entwicklung des späteren Verhältnisses beschrieben. Der Umgang mit dem verstärkt subjektiv verarbeiteten Germanen- bzw. Keltenbild zeigt sich deutlich im beispielhaften Vergleich der Werke von Polybios und Livius. Letzterer entwickelte und gebrauchte besonders intensiv den Gegensatz der wilden Barbaren aus dem Norden zu den zivilisierten Römern. Autoren wie er entfernten sich durch die politische Nutzbarmachung der Fremdheitsdarstellung besonders weit von der Realität. Dieses macht eine neutrale Betrachtung der tatsächlichen Kontakte aus heutiger Sicht besonders schwierig. Andererseits lassen sich aus der literarischen Verarbeitung wiederum Rückschlüsse auf die Sorgen und Ängste der antiken Römer bezüglich ihrer nördlichen Nachbarn nachvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Grundlagen antiker ethnisch-geographischer Beschreibungen
- Territorialprinzip/polygenetische Vorstellungen
- „Barbaren“ am Rand der Oikumene
- Hekataios
- Herodotos
- Anthropogeographische Theorie
- 2. Germanen als „neue“ ethnische Volksgruppe
- Caesars Kategorie der Germanen
- Strabon
- Fremdbezeichnung / pseudoethnische Einteilung
- 3. Antike Beschreibungen Nordeuropas
- Fabelvölker
- Nordfahrt des Pytheas
- Eratosthenes
- 4. Vermischung von griech. und röm. Weltanschauung
- Polybios
- Scipio Aemilianus
- Poseidonios
- 5. Der „Keltensturm“ und die spätere Darstellung
- Schlacht an der Allia / Eroberung Roms
- Verarbeitung durch spätere Autoren
- Livius
- „Brennus“-Mythos
- 6. Das Keltenbild in der politischen Instrumentalisierung
- Existenzangst der Römer
- Aussehen und Auftreten der Kelten
- Antithese „impetus“ - „patientia“
- Spätere Beschreibung der Germanen auf gleicher Basis
- Politischer Nutzen des Freund-Feind-Schemas
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der antiken römischen Sichtweise auf die Völker Nordeuropas, insbesondere die Germanen. Sie analysiert die Quellen und die verschiedenen Perspektiven, die in der antiken Literatur zu finden sind, und beleuchtet die Rolle von Vorurteilen und politischen Interessen bei der Konstruktion dieser Bilder.
- Die Grundlagen antiker ethnisch-geographischer Beschreibungen
- Die Konstruktion der Germanen als "neue" ethnische Gruppe
- Die Rolle von Mythen und Legenden in der Darstellung der Germanen
- Die Vermischung griechischer und römischer Weltanschauungen in der Beschreibung Nordeuropas
- Die politische Instrumentalisierung des Bildes der Kelten und Germanen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der antiken römischen Wahrnehmung der germanischen und keltischen Völker ein und umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie skizziert den Fokus auf die Analyse der Quellen und die Identifizierung von politischen und ideologischen Einflüssen auf die Darstellung dieser "anderen" Kulturen.
1. Die Grundlagen antiker ethnisch-geographischer Beschreibungen: Dieses Kapitel untersucht die methodischen Grundlagen der antiken Geographie und Ethnographie. Es analysiert Konzepte wie das Territorialprinzip und polygenetische Vorstellungen, sowie die Kategorisierung von "Barbaren" im Kontext der damaligen Weltordnung. Die Beiträge von Hekataios und Herodotos werden eingehend betrachtet, ebenso wie die Entwicklung der anthropogeographischen Theorie.
2. Germanen als „neue“ ethnische Volksgruppe: Dieses Kapitel fokussiert auf die Herausbildung des Begriffs "Germanen" in der antiken Literatur. Es analysiert Caesars Rolle bei der Definition dieser ethnischen Gruppe und untersucht alternative Klassifikationen und Fremdbezeichnungen, wie sie etwa bei Strabon zu finden sind. Die Grenzen und die Problematik einer solchen Kategorisierung werden kritisch beleuchtet.
3. Antike Beschreibungen Nordeuropas: Dieses Kapitel befasst sich mit den antiken Beschreibungen Nordeuropas, einschließlich der Rolle von Mythen und Fabelwesen. Es untersucht die Berichte über die Nordfahrt des Pytheas und die geographischen Vorstellungen von Eratosthenes, um ein Bild der damaligen Kenntnisse und Unsicherheiten über diese Region zu zeichnen.
4. Vermischung von griech. und röm. Weltanschauung: Dieses Kapitel analysiert die Verschmelzung griechischer und römischer Perspektiven in der Beschreibung Nordeuropas. Die Beiträge von Polybios, Scipio Aemilianus und Poseidonios werden untersucht, um den Einfluss unterschiedlicher kultureller und politischer Kontexte auf die Wahrnehmung dieser Völker zu beleuchten.
5. Der „Keltensturm“ und die spätere Darstellung: Dieses Kapitel behandelt die Darstellung des Keltensturms und der Eroberung Roms durch die Kelten. Es analysiert die Verarbeitung dieses Ereignisses durch spätere Autoren, insbesondere Livius, und die Entstehung des „Brennus“-Mythos. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Veränderung der Erzählung im Laufe der Zeit und der damit verbundenen politischen Implikationen.
6. Das Keltenbild in der politischen Instrumentalisierung: Dieses Kapitel untersucht die politische Instrumentalisierung des Kelten- und später auch des Germanenbildes in der römischen Propaganda. Es beleuchtet die Existenzängste der Römer und die Konstruktion des "anderen" als Gegensatz zum römischen Selbstverständnis. Die Antithese von „impetus“ und „patientia“ wird als zentrales Element der Konstruktion dieses Bildes analysiert, ebenso wie die langfristige Wirkung dieses Freund-Feind-Schemas.
Schlüsselwörter
Römisches Germanien, Germanen, Kelten, Antike, Ethnographie, Geographie, Quellenkritik, politische Instrumentalisierung, Freund-Feind-Schema, Mythen, Legenden, Caesar, Livius, Polybios, Weltanschauung.
Häufig gestellte Fragen zu: Antike Beschreibungen Nordeuropas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die antike römische Wahrnehmung der Völker Nordeuropas, insbesondere der Germanen und Kelten. Sie analysiert die Quellen und Perspektiven der antiken Literatur und beleuchtet den Einfluss von Vorurteilen und politischen Interessen auf die Konstruktion dieser Bilder.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundlagen antiker ethnisch-geographischer Beschreibungen, die Konstruktion der Germanen als "neue" ethnische Gruppe, die Rolle von Mythen und Legenden, die Vermischung griechischer und römischer Weltanschauungen, und die politische Instrumentalisierung der Bilder von Kelten und Germanen. Konkrete Autoren wie Caesar, Strabo, Livius, Polybios, Hekataios, Herodotos, Eratosthenes und Poseidonios werden analysiert.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse antiker literarischer Quellen, die die damaligen Vorstellungen von den Völkern Nordeuropas widerspiegeln. Die verwendeten Quellen umfassen geographische und ethnographische Schriften sowie historische Berichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen antiker ethnisch-geographischer Beschreibungen, ein Kapitel zur Konstruktion der Germanen als "neue" ethnische Gruppe, ein Kapitel zu antiken Beschreibungen Nordeuropas, ein Kapitel zur Vermischung griechischer und römischer Weltanschauungen, ein Kapitel zum "Keltensturm" und seiner späteren Darstellung, und schließlich ein Kapitel zur politischen Instrumentalisierung des Kelten- und Germanenbildes.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen quellenkritischen Ansatz, um die antiken Texte zu analysieren und die politischen und ideologischen Einflüsse auf die Darstellung der "anderen" Kulturen zu identifizieren. Es wird die Entwicklung der Beschreibungen im Laufe der Zeit untersucht.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: Territorialprinzip, polygenetische Vorstellungen, "Barbaren", Fremdbezeichnung, pseudoethnische Einteilung, Fabelvölker, Vermischung von Weltanschauungen, "Keltensturm", "Brennus"-Mythos, politische Instrumentalisierung, Freund-Feind-Schema, "impetus" und "patientia".
Welche Autoren werden besonders betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Beiträge von Caesar, Strabo, Livius, Polybios, Hekataios, Herodotos, Pytheas, Eratosthenes, Scipio Aemilianus und Poseidonios.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die antiken römischen Beschreibungen der germanischen und keltischen Völker stark von Vorurteilen und politischen Interessen geprägt waren. Die Konstruktion des "anderen" diente der Legitimierung der römischen Herrschaft und der Stärkung des römischen Selbstverständnisses.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studenten, die sich mit der antiken Geschichte, Geographie, Ethnographie und der Quellenkritik befassen.
Wo finde ich die vollständigen Kapitelzusammenfassungen?
Die vollständigen Kapitelzusammenfassungen sind im HTML-Dokument enthalten, das die Grundlage dieser FAQs bildet.
- Quote paper
- Andreas Büter (Author), 2003, Erste Kontakte zwischen Römern und Germanen - Die Herkunft und die Entwicklung der antiken römischen Sichtweise auf die Völker Nordeuropas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46859