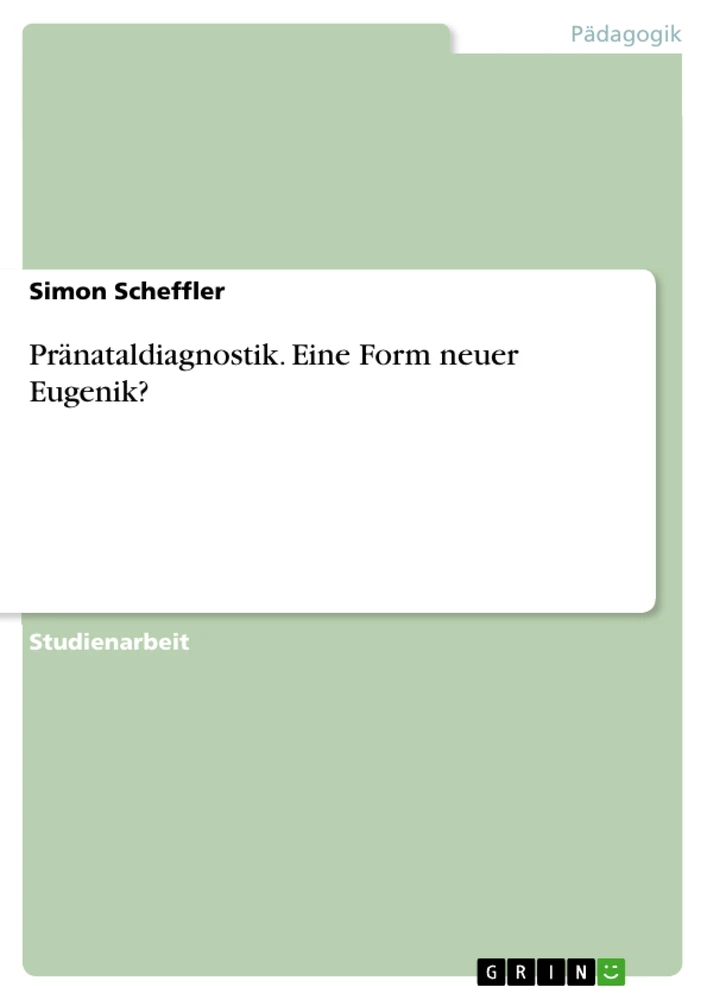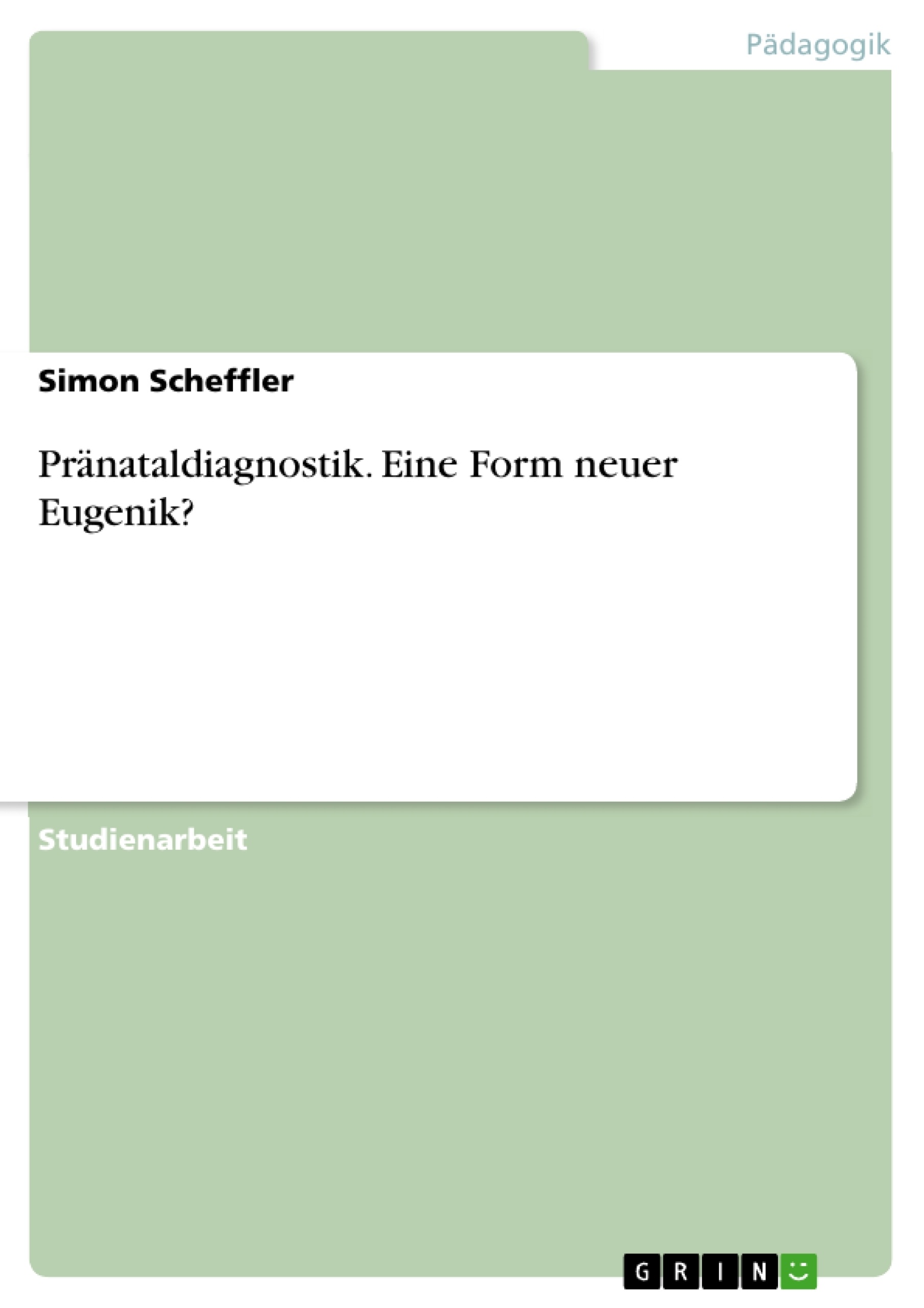Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die Pränataldiagnostik als eugenische Praktik der Gegenwart interpretiert werden kann. Zunächst wird die Eugenik als Denkströmung mit ihren wichtigsten Aspekten präsentiert und kritisch betrachtet. Sie wird dabei aufgespalten in ihr klassisches Erscheinungsmuster der "alten" Eugenik und ihre modernes Vorkommen als "neue" Eugenik. Danach wird die Pränataldiagnostik ebenfalls präsentiert und ebenso kritisch betrachtet. Weil beispielsweise eine harmlose Untersuchung schon allerlei Konsequenzen nach sich ziehen kann, werden die Motive für die Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik beleuchtet. Eben weil eine Konsequenz die Abtreibung sein kann, muss die Potentialität eines Schwangerschaftsabbruchs ergründet werden.
Die "Attraktivität" des Abbruchs im Gegensatz zur "Hässlichkeit" eines Lebens mit einem "geschädigten" Kind lässt sich beispielsweise kritisieren. Tötet man mit seiner Entscheidung ein ungeborenes Kind oder verhindert man "lediglich" ein Leben, das von Leid und Ausgrenzung geprägt sein kann? Darüber hinaus wird zwischen der Mühe und den Kosten abgewägt, die die Pflege mit sich bringen kann, sowie der Stärke der emotionalen Bindung zum Ungeborenen. Dass es zu dieser Auffassung und der Abwägung "zwischen Leben und Tod" kommt, ist unter anderem der "genetischen Gouvernementalität" zuzurechnen, die im vorletzten Kapitel Behandlung erfährt.
Durch die Pränataldiagnostik kommt es bei schwangeren Frauen oft zu der Entscheidung, das Kind bei einer positiven Diagnose auf etwaige Erbkrankheiten oder Beeinträchtigungen abtreiben zu lassen. Hierbei ist zu untersuchen, ob es sich um eine Form von neuer Eugenik handelt, weil die Argumentation in einem solchen Falle jener der Eugeniker ähnelt, die Anfang des 20. Jahrhunderts für "Rassehygiene" plädierten.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- 1.1: Die Bedeutung des Themas
- 1.2: Zielsetzung und Forschungsfragen
- Kapitel 2: Theoretischer Rahmen
- 2.1: Konzepte und Definitionen
- 2.2: Relevante Theorien
- Kapitel 3: Forschungsmethodik
- 3.1: Forschungsdesign
- 3.2: Datenerhebung und -analyse
- Kapitel 4: Ergebnisse
- 4.1: Erste Ergebnisse
- 4.2: Weitere Ergebnisse
- Kapitel 5: Diskussion
- 5.1: Interpretation der Ergebnisse
- 5.2: Bedeutung und Relevanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk befasst sich mit der Erforschung eines komplexen Themas und hat zum Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen und bestehende Theorien zu erweitern. Es basiert auf einer umfassenden Analyse von Daten und verfolgt eine wissenschaftlich fundierte Methodik.
- Die Bedeutung des Themas in der heutigen Gesellschaft
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Thema ergeben
- Die Relevanz der Forschungsarbeit für die Praxis
- Die Anwendung theoretischer Konzepte auf die empirischen Daten
- Die Diskussion der Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Forschungsarbeit. Es werden die Ziele der Studie und die wichtigsten Forschungsfragen vorgestellt.
Kapitel 2 präsentiert den theoretischen Rahmen, der als Grundlage für die Untersuchung dient. Es werden wichtige Konzepte und Theorien definiert und in Beziehung zueinander gesetzt.
Kapitel 3 beschreibt die Forschungsmethodik, die für die Datenerhebung und -analyse verwendet wurde. Es werden das Forschungsdesign, die Datenerhebungsmethoden und die Analyseverfahren vorgestellt.
Kapitel 4 präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der Studie. Es werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und in Beziehung zu den Forschungsfragen gesetzt.
Kapitel 5 diskutiert die Bedeutung der Ergebnisse und setzt sie in den Kontext der bestehenden Literatur. Es werden die Relevanz der Forschungsarbeit und die Implikationen für die Praxis beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche [Keywords1], [Keywords2] und [Keywords3]. Die Ergebnisse basieren auf [Keywords4] und [Keywords5].
- Quote paper
- Simon Scheffler (Author), 2013, Pränataldiagnostik. Eine Form neuer Eugenik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468595