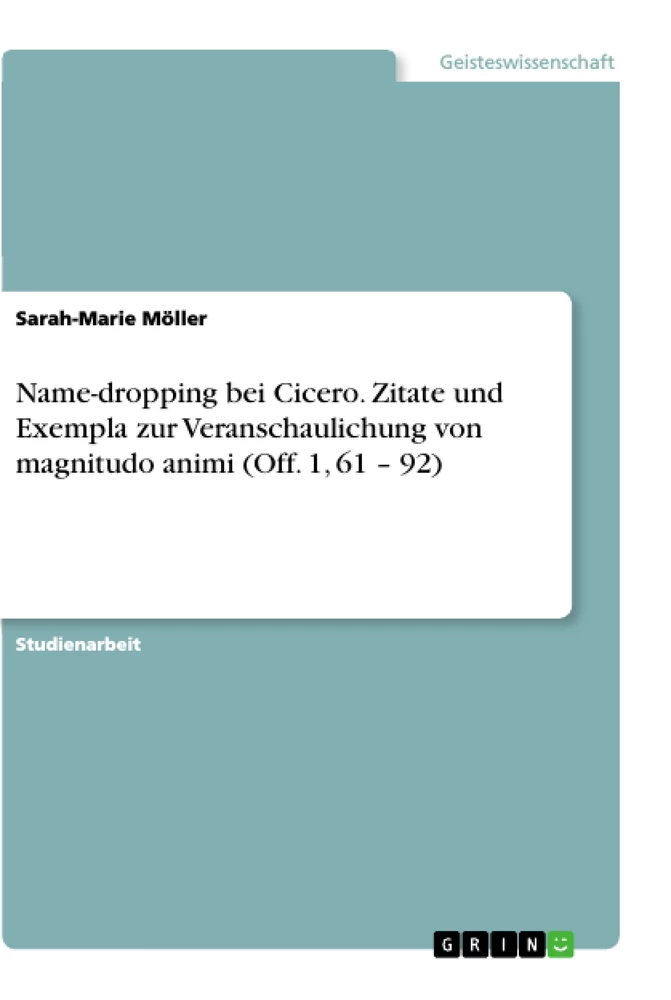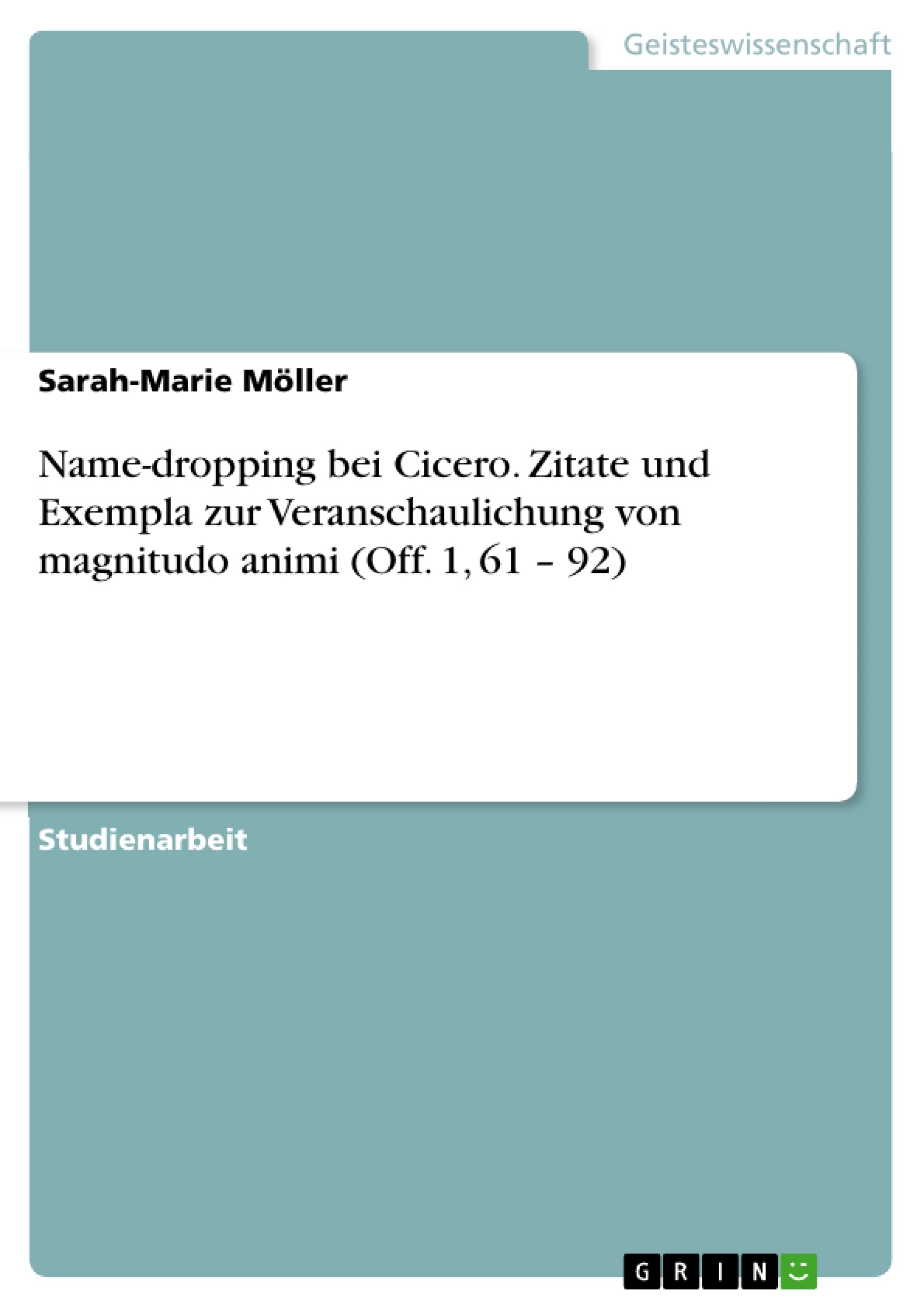Um die Verbindung von Beschreibung der Tugend und Handlungsanweisung zu erkennen, soll im ersten Teil der vorliegenden Arbeit – nach einer kurzen Einführung zu Autor und Werk – untersucht werden, wie Cicero magnitudo animi definiert (beziehungsweise umschreibt) und wie sein Argumentationsgang in Hinblick auf die praecepta gestaltet ist. Da die Nachfolgegeneration der römischen Staatsmänner als Adressatenkreis identifiziert worden ist, soll analysiert werden, inwiefern speziell hierauf argumentiert wird.
Aus der ausgiebigen Illustration seiner Argumente mit Zitaten und exempla ergibt sich der zweite Teil. Callicratides, Q. Maximus und Pompeius sind nur einige der Namen, die Cicero als Beispiele in seiner Darstellung der magnitudo animi von Panaitios übernimmt oder selbst aufzählt, während andere, die zum Beispiel Aristoteles in diesem Zusammenhang anführt, keine Erwähnung finden. Selbstverständlich kann es sich bei einem Autor wie Cicero nicht um bloßes "name-dropping" handeln.
Aus diesem Grund muss untersucht werden, wer als exemplum angeführt wird, wie das entsprechende Beispiel in die Stelle passt und was der Leser daraus (an Einsichten) gewinnen kann. Hierbei wird unterschieden zwischen griechischen und römischen exempla, wobei Cicero sich selbst als Vorbild für seinen Sohn zwei Paragraphen widmet. Ein weiterer interessanter Punkt ist die ausgiebige Verwendung von Zitaten, die seiner Argumentation Anschaulichkeit verleihen. Namen berühmter Philosophen und Dichter verleihen Autorität, markante Vergleiche runden die Schrift ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Autor und Werk
- 3 Magnitudo animi
- 3.1 Die griechischen Begriffe...
- 3.2 und ihre lateinische Definition bei Cicero (61–73)
- 3.3 Bedeutung für den Adressatenkreis – de officiis als Handlungsanweisung
- 3.3.1 An wen richtet sich De officiis?
- 3.3.2 Gliederung und Folgerungen für den Staatsmann (74-92): non nobis solum nati sumus
- 4 Zitate und exempla
- 4.1 Zitate zur Veranschaulichung von magnitudo animi
- 4.2 Griechische und römische exempla
- 4.3 Ciceros Selbstdarstellung
- 4.4 Bewertung: exempla als uneingeschränkte Vorbilder?
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Ciceros Darstellung von magnitudo animi in De officiis (1, 61-92). Ziel ist es, die Verbindung zwischen der Beschreibung dieser Tugend und ihrer Funktion als Handlungsanweisung für den römischen Staatsmann zu analysieren. Es wird untersucht, wie Cicero magnitudo animi definiert und wie sein Argumentationsgang gestaltet ist, insbesondere im Hinblick auf den Adressatenkreis (die Nachfolgegeneration römischer Staatsmänner).
- Definition und Darstellung von magnitudo animi bei Cicero
- Analyse der Argumentationsstruktur und der praecepta in De officiis
- Die Rolle von Zitaten und exempla zur Veranschaulichung von magnitudo animi
- Untersuchung der ausgewählten griechischen und römischen Beispiele (exempla)
- Ciceros Selbstdarstellung als Vorbild
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext von Ciceros De officiis als politisches Vermächtnis. Sie benennt die zu untersuchende Textstelle (Off. 1, 61-92) innerhalb des Werkes und skizziert den Forschungsansatz: die Analyse der Definition von magnitudo animi, die Untersuchung der Argumentationsstruktur und die Rolle von Zitaten und Beispielen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: die Analyse von Ciceros Definition und Argumentation sowie die Untersuchung der verwendeten Zitate und Beispiele.
2 Autor und Werk: Dieses Kapitel beleuchtet Ciceros Leben und Werk im Kontext seiner Zeit. Es beschreibt seinen Werdegang als Anwalt, Politiker und Redner und hebt seine Hinwendung zur Philosophie in Zeiten politischer Untätigkeit hervor. Die Entstehung von De officiis wird im Zusammenhang mit Caesars Diktatur und den folgenden politischen Unruhen in Rom erläutert. Das Werk wird als politisches und moralisches Vermächtnis für Ciceros Sohn und die römische Jugend charakterisiert, das in Form einer Lehrschrift verfasst ist. Die Wahl Panaetius' als Quelle und der Verzicht auf die Dialogform werden diskutiert. Der Abbruch seiner Reise nach Athen und der Aufenthalt seines Sohnes werden als Schreibanlass genannt.
3 Magnitudo animi: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Tugend magnitudo animi. Es untersucht die griechischen Begriffsbildungen und deren lateinische Definition durch Cicero. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von magnitudo animi für den Adressatenkreis, die römischen Staatsmänner. Die Kapitel analysieren die Handlungsanweisungen und Implikationen dieser Tugend für das politische Handeln. Das Kapitel soll die Verbindung zwischen der Beschreibung der Tugend und ihrer Funktion als Handlungsanweisung aufzeigen.
4 Zitate und exempla: Dieses Kapitel analysiert die reichhaltige Verwendung von Zitaten und Beispielen (exempla) in Ciceros Argumentation. Es untersucht die Auswahl der Beispiele (griechische und römische), die Einordnung der Beispiele in den Kontext und den Erkenntnisgewinn für den Leser. Besondere Aufmerksamkeit wird Ciceros Selbstdarstellung als Vorbild gewidmet und die Frage diskutiert, ob die exempla als uneingeschränkte Vorbilder zu verstehen sind. Der analytische Fokus liegt auf der Funktion der Zitate und Beispiele für die Veranschaulichung und Stärkung der Argumentation.
Schlüsselwörter
Cicero, De officiis, magnitudo animi, Handlungsanweisung, Staatsmann, Tugend, Zitate, exempla, griechische Philosophie, römische Republik, politische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen zu Ciceros "De Officiis" (Kapitel 1, 61-92): Magnitudo Anim
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Ciceros Darstellung von magnitudo animi (Großmut) in seinem Werk De officiis (Kapitel 1, 61-92). Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen der Beschreibung dieser Tugend und ihrer Funktion als Handlungsanweisung für römische Staatsmänner.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Definition von magnitudo animi bei Cicero, analysiert die Argumentationsstruktur und die Rolle von Zitaten und Beispielen (exempla), untersucht die ausgewählten griechischen und römischen Beispiele und beleuchtet Ciceros Selbstdarstellung als Vorbild.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Autor und Werk, ein Kapitel zu magnitudo animi, ein Kapitel zu Zitaten und Beispielen und ein Fazit. Der erste Teil analysiert Ciceros Definition und Argumentation, der zweite Teil untersucht die verwendeten Zitate und Beispiele.
Wie definiert Cicero magnitudo animi?
Die Arbeit untersucht die griechischen Begriffsbildungen und deren lateinische Definition durch Cicero. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung von magnitudo animi für den Adressatenkreis, die römischen Staatsmänner, und wie diese Tugend in Handlungsanweisungen und Implikationen für das politische Handeln umgesetzt wird.
Welche Rolle spielen Zitate und Beispiele (exempla)?
Die Arbeit analysiert die reichhaltige Verwendung von Zitaten und Beispielen in Ciceros Argumentation. Sie untersucht die Auswahl der Beispiele (griechisch und römisch), deren Einordnung in den Kontext und den Erkenntnisgewinn für den Leser. Besondere Aufmerksamkeit wird Ciceros Selbstdarstellung als Vorbild und der Frage gewidmet, ob die exempla als uneingeschränkte Vorbilder zu verstehen sind.
Wer ist der Adressatenkreis von Ciceros Ausführungen?
Ciceros Ausführungen in De officiis richten sich primär an die Nachfolgegeneration römischer Staatsmänner. Die Arbeit untersucht, wie Cicero magnitudo animi für diesen Adressatenkreis definiert und welche Handlungsanweisungen er daraus ableitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cicero, De officiis, magnitudo animi, Handlungsanweisung, Staatsmann, Tugend, Zitate, exempla, griechische Philosophie, römische Republik, politische Philosophie.
Was ist der Kontext von Ciceros "De Officiis"?
De Officiis wird als politisches und moralisches Vermächtnis Ciceros für seinen Sohn und die römische Jugend beschrieben, verfasst in Form einer Lehrschrift in einer Zeit politischer Unruhen in Rom, nach Caesars Diktatur. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des Werkes in diesem Kontext.
Welche Quellen verwendet Cicero?
Die Arbeit erwähnt Panaetius als Quelle für Ciceros Ausführungen in De Officiis. Der Verzicht auf die Dialogform wird ebenfalls diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im Text nicht explizit zusammengefasst, jedoch wird die Analyse von Ciceros Definition und Argumentation sowie die Untersuchung der verwendeten Zitate und Beispiele als zwei Hauptteile der Arbeit genannt.
- Quote paper
- Sarah-Marie Möller (Author), 2015, Name-dropping bei Cicero. Zitate und Exempla zur Veranschaulichung von magnitudo animi (Off. 1, 61 – 92), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468199