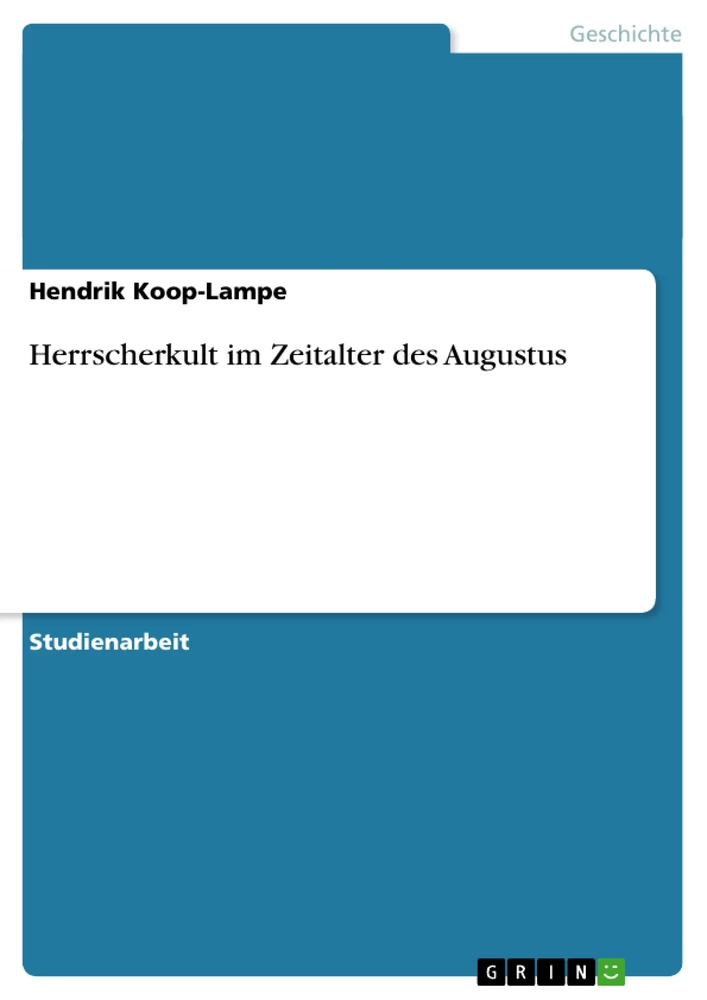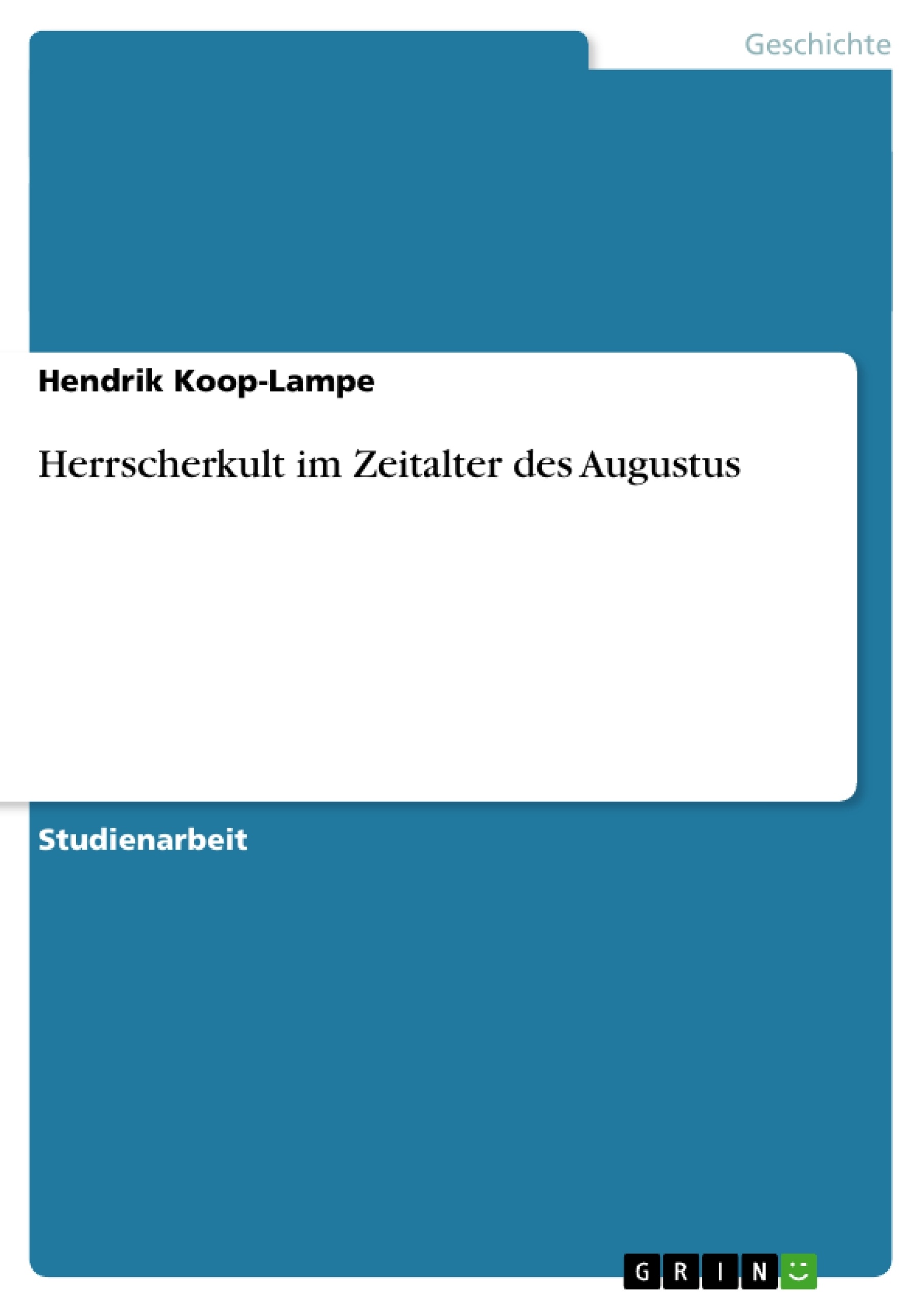„Jener wird immer ein Gott mir sein, und an seinem Altare Wird aus unserem Stall ein Lamm ihm, ein zartes, geopfert.“ In diesen zwei kurze n Zeilen findet sich möglicherweise ein erstes Indiz für eine Verehrung Octavians, des späteren römischen Princeps Augustus, als Gott. Der Ausspruch stammt aus der ersten Ekloge Vergils aus dem Jahre 41. Darin berichtet ein Hirte einem anderen Hirten davon, dass ihm sein Hof zurückgegeben worden sei und er dies einem Gott verdanke. Nach der Schlacht bei Philippi, bei der die republikanischen Kräfte unter Cassius und Brutus ausgeschaltet worden waren, wurde Octavian mit der wenig Dank versprechenden Aufgabe betraut, die Veteranen mit Land zu versorgen. Von den dafür notwendigen Enteignungen waren mindestens achtzehn Städte in Italien betroffen. Zu den wenigen Ausnahmen, die gemacht wurden, zählte unter anderem das Landgut des Vaters von Vergil. Dies macht es nicht unwahrscheinlich, dass Vergil mit dieser Szene aus der ersten Ekloge ein Gefühl von Dankbarkeit und Verehrung gegenüber Octavian zum Ausdruck bringen wollte.
Setzt man diese Vermutung als zutreffend voraus, wird ersichtlich, welche Motive und Intentionen einen Menschen in der Antike dazu bewegt haben könnten, in einem anderen Menschen einen Gott zu sehen und ihn als solchen zu verehren. Die Erkenntnis, dass Emotionen von Dankbarkeit und Zustimmung ein wesentliches konstitutives Element der kultische n Verehrung des ersten Princeps Augustus waren, soll im folgenden behilflich sein bei der Untersuchung der Fragestellung, ob sich Augustus entgegen der Überlieferung der Quellen auch in Rom und Italien bereits zu seinen Lebzeiten als Gott verehren ließ und auf welche Weise sich die Vorraussetzungen, Bedingungen und Formen einer göttlichen Verehrung in Rom und Italien von denen in den Provinzen des Ostens unterschieden. Hinsichtlich der Frage nach einem Herrscherkult im kernrömischen Gebiet selbst ist die Quellenlage äußerst widersprüchlich und die moderne Forschung zerstritten. Ich möchte im folgenden versuchen, ohne mich gänzlich auf die eine oder anderen Seite zu schlagen, einen Kompromiss zwischen den scheinbar konträren Aussagen der Quellen herbeizuführen und herauszustellen, dass die Frage, ob sich Augustus in Rom und Italien als Gott verehren ließ, weder mit einem klaren Ja noch mit einem klaren Nein beantwortet werden kann, sondern dass hier mehr differenziert werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Wer oder was ist ein Gott?
- Gründe für eine Ablehnung göttlicher Ehrung in Rom und Italien
- Octavian als Beschützer römischer Tradition
- Überlieferungen von einer Duldung göttlicher Ehrungen in Rom und Italien
- Die Haltung des Augustus zur göttlichen Überhöhung seiner Person
- Vorraussetzungen einer kultischen Verehrung des Princeps in Rom
- Der Augustuskult als Loyalitätsreligion
- Die Etablierung des Geniuskultes in Rom
- Die Ausdehnung des Augustuskultes auf Italien
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob sich Augustus bereits zu seinen Lebzeiten in Rom und Italien als Gott verehren ließ. Sie untersucht die religiösen, politischen und kulturellen Voraussetzungen sowie die Hindernisse für eine göttliche Verehrung in Rom, insbesondere im Vergleich zu den Provinzen des Ostens. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Emotionen wie Dankbarkeit und Zustimmung für die kultische Verehrung des ersten Princeps.
- Die Definition eines Gottes im antiken Verständnis
- Gründe für die Ablehnung göttlicher Ehrungen in Rom und Italien
- Die Haltung des Augustus zur göttlichen Verehrung seiner Person
- Die Vorraussetzungen einer kultischen Verehrung des Princeps in Rom
- Der Vergleich zwischen dem Augustuskult in Rom und den Provinzen des Ostens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Frage nach der göttlichen Verehrung Octavians/Augustus anhand eines Beispiels aus Vergils erster Ekloge. Die Kapitel des Hauptteils untersuchen verschiedene Aspekte der Frage, ob und in welcher Form sich Augustus als Gott verehren ließ. Der erste Teil befasst sich mit der Definition eines Gottes im antiken Verständnis und erläutert die wichtigsten Elemente kultischer Interaktion. Der zweite Teil analysiert die Gründe für die Ablehnung göttlicher Ehrungen in Rom und Italien und zeigt auf, dass die religiösen, politischen und sozialen Voraussetzungen für die Verehrung eines Menschen als Gott zu seinen Lebzeiten in Rom nicht gegeben waren.
Schlüsselwörter
Augustus, Herrscherkult, göttliche Verehrung, Rom, Italien, antikes Verständnis von Gott, religiöse Praxis, kultische Interaktion, politische Voraussetzungen, Loyalitätsreligion, Geniuskult, Provinzkult, östliche Provinzen, Vergleich, Quellenkritik
- Quote paper
- Hendrik Koop-Lampe (Author), 2005, Herrscherkult im Zeitalter des Augustus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46702