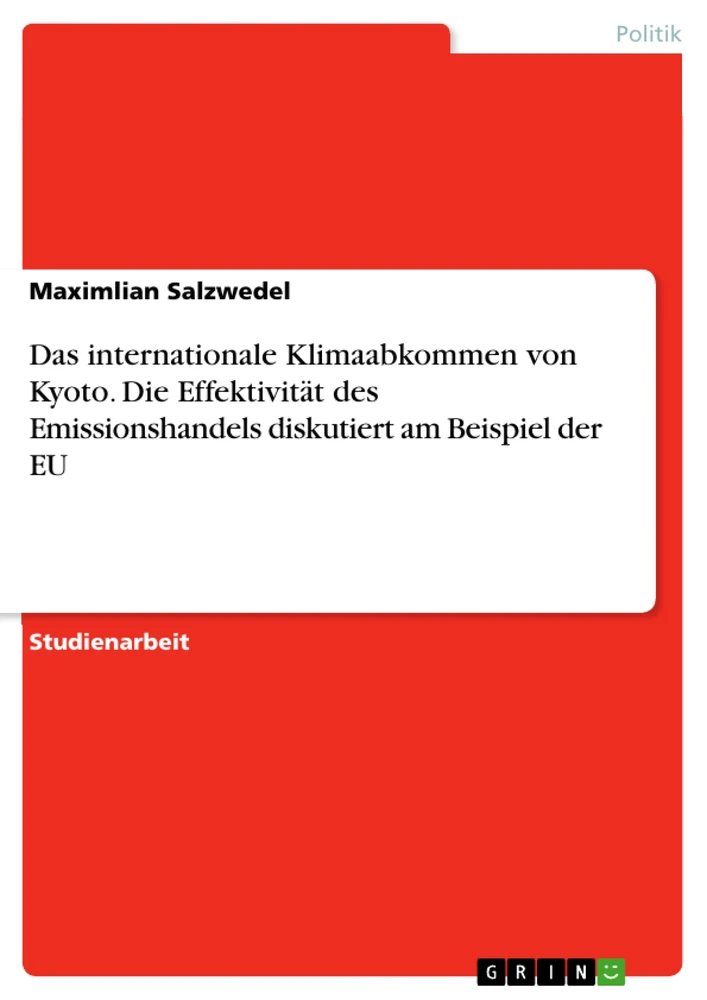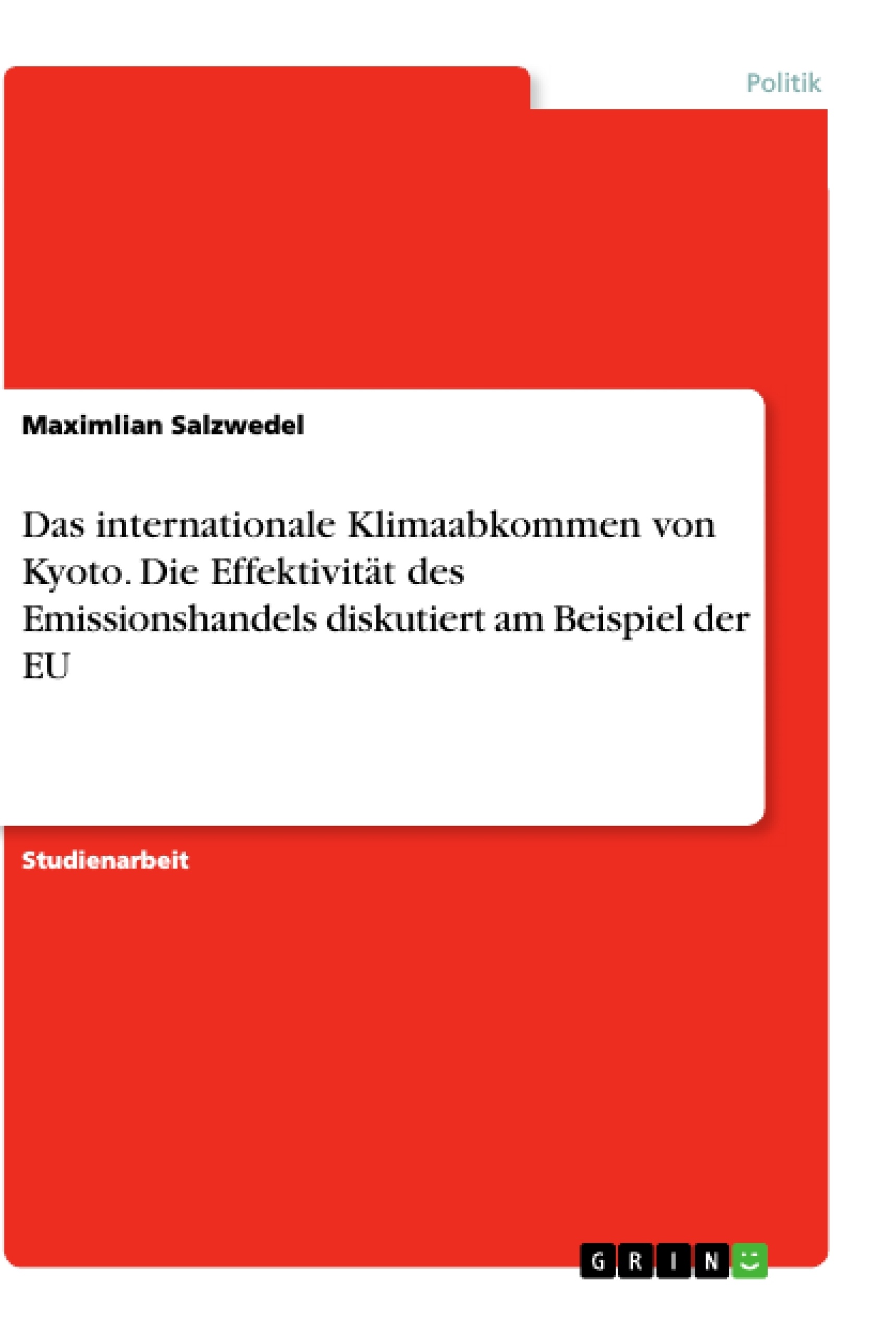Schon immer erwärmen natürliche Treibhausgase (THG) die Erde und halten die Erdmitteltemperatur konstant. Es besteht jedoch die Vermutung, dass der Treibhauseffekt durch den Menschen auf unnatürliche Weise verstärkt wird.
Die Konzentration des THG in der Atmosphäre ist mit Beginn der Industrialisierung stark gestiegen. Durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen für Elektroenergieerzeugung/Wärmeerzeugung, durch Massentierhaltung, durch die Brandrodung des Regenwaldes und durch ein immer weiter wachsendes Verkehrsaufkommen, wird dieser Aufwärtstrend bis heute stetig verstärkt. Die Folgen: Die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, das Wetter wird extremer und auch politische und wirtschaftliche Folgen sind absehbar.
Extreme Wetterereignisse richten Schäden in Millionenhöhe an und bremsen die regional betroffene Wirtschaft. Die Abwanderung der Bevölkerung mit allen politischen und wirtschaftlichen Folgen ist zu beobachten. Der Klimawandel wird allen schaden, auch in finanzieller Hinsicht. Es besteht die Notwendigkeit, diese Klimaveränderung zu bremsen.
Da sich die Menge der THG Emissionen von Nation zu Nation unterscheiden, kann es keinen Erfolg haben, wenn einzelne Nationen gegen den Klimawandel ankämpfen. Emissionen können nur über weite geographische Räume betrachtet und bekämpft werden. Um effektiv Emissionen zu reduzieren, muss auf globaler Ebene gehandelt werden.
Eine übergreifende, handlungsfähige Weltregierung existiert nicht. Klimaziele können weder vorgeben, noch einfach durchgesetzt werden. Lediglich eine globale, völkerrechtlich verankerte Verpflichtung könnte die Nationen dieser Erde zu gemeinsamen Klimazielen und angepassten Maßnahmen bewegen.
Der Grundstein für die notwendige Verpflichtung wurde 1997 in Kyoto (Japan) gelegt. Mit dem Kyoto-Protokoll (KP) wurden erstmals verbindliche, völkerrechtliche Klimaziele zur Verringerung der THG für einzelne Länder oder Länderverbände (EU) festgelegt. Aktuell haben 191 Nationen das KP ratifiziert und agieren und kooperieren global im Kampf gegen die Erderwärmung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grundlagen des Emissionshandels
- Das Kyoto-Protokoll, Kernpunkte und Zielsetzung
- Die 3 flexiblen Mechanismen
- Umsetzung in der Europäischen Union (EU ETS)
- Verteilung der Emissionsrechte
- Die EU im globalen Vergleich
- Probleme des Emissionshandels
- Diskussion / Bewertung des Emissionshandels
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das internationale Klimaabkommen von Kyoto und analysiert die Effektivität des Emissionshandels am Beispiel der Europäischen Union. Im Fokus steht die Frage, inwieweit der Emissionshandel als Instrument des Kyoto-Protokolls zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen kann. Die Arbeit beleuchtet die grundlegenden Prinzipien des Emissionshandels, die Umsetzung des EU ETS und die damit verbundenen Herausforderungen.
- Das Kyoto-Protokoll als völkerrechtliches Abkommen zur Reduktion von Treibhausgasen
- Die Funktionsweise des Emissionshandels und die Rolle der Emissionszertifikate
- Die Umsetzung des EU ETS und seine Effektivität bei der Reduktion von Emissionen
- Die Herausforderungen des Emissionshandels im globalen Kontext und die Bedeutung der Einbindung von Entwicklungsländern
- Das Potenzial und die Grenzen des Emissionshandels im Kampf gegen den Klimawandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort führt in die Thematik des Klimawandels ein und erläutert die Notwendigkeit internationaler Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Es beschreibt die Entstehung des Kyoto-Protokolls und die Rolle des Emissionshandels als Instrument des Abkommens.
- Das Kapitel „Grundlagen des Emissionshandels“ erklärt die grundlegenden Prinzipien des Emissionshandels und die Zielsetzung des Instruments im Hinblick auf den Klimaschutz. Es beleuchtet die verschiedenen Mechanismen des Emissionshandels, darunter der projektbezogene Mechanismus „Joint Implementation“ und der „Clean Development Mechanism“.
- Im Kapitel „Umsetzung in der Europäischen Union (EU ETS)“ wird die konkrete Umsetzung des Emissionshandels in der EU erläutert. Es wird die Funktionsweise des EU ETS, die Verteilung der Emissionsrechte und die Rolle der EU im globalen Vergleich diskutiert.
- Das Kapitel „Probleme des Emissionshandels“ identifiziert die Herausforderungen, die mit dem Emissionshandel verbunden sind. Es beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Einbindung aller relevanten Akteure, insbesondere von Entwicklungsländern, und diskutiert den „Hot air“-Handel sowie die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den Emissionshandel.
- Das Kapitel „Diskussion / Bewertung des Emissionshandels“ analysiert die Effektivität des Emissionshandels und die Frage, inwieweit das Instrument zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen kann. Es diskutiert die Bedeutung der Einbindung aller Länder und die Notwendigkeit einer gerechten Verteilung der Emissionsrechte.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des internationalen Klimaabkommens von Kyoto, dem Emissionshandel und der Reduktion von Treibhausgasemissionen. Im Fokus stehen dabei die Funktionsweise des Emissionshandels, die Umsetzung des EU ETS, die Rolle der Europäischen Union im globalen Vergleich, die Herausforderungen des Emissionshandels und die Bedeutung der Einbindung aller Länder in den Kampf gegen den Klimawandel. Weitere wichtige Begriffe sind: Kyoto-Protokoll, Treibhausgase, Emissionszertifikate, Clean Development Mechanism, Joint Implementation, „Hot air“-Handel, Entwicklungsländer, Nachhaltigkeit.
- Quote paper
- Maximlian Salzwedel (Author), 2018, Das internationale Klimaabkommen von Kyoto. Die Effektivität des Emissionshandels diskutiert am Beispiel der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465591