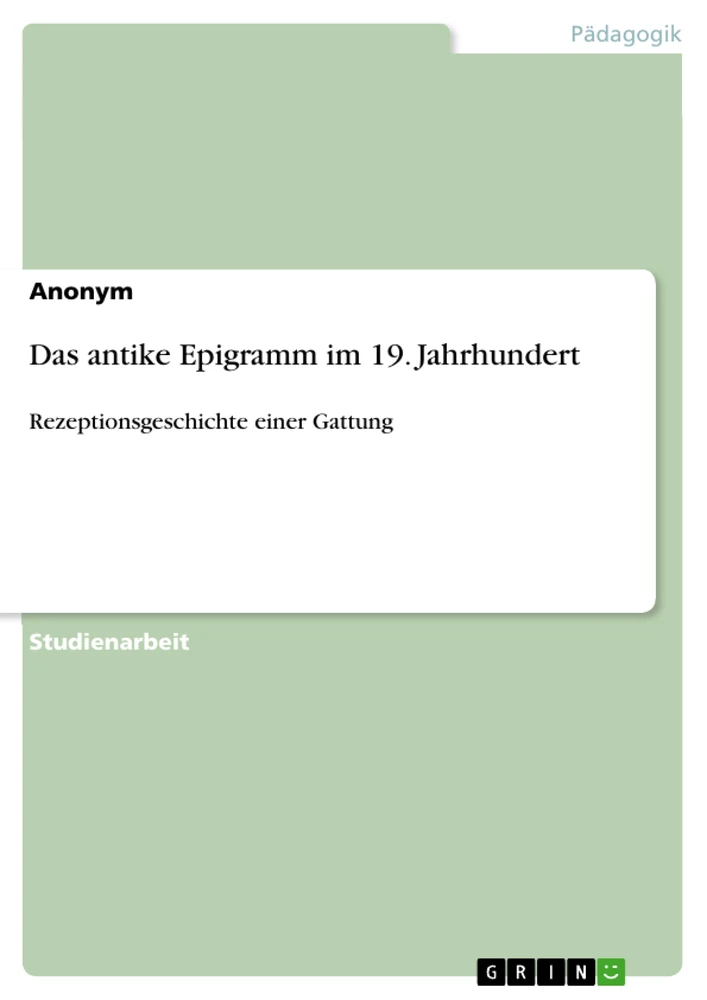Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern eine ganze Gattung sich verändert, wenn sie in einem neuen historischen Kontext rezipiert wird. Als Untersuchungsgegenstand für die Rezeptionsgeschichte einer Gattung erweist sich dabei, aufgrund seiner Kürze und langen Geschichte, das Epigramm als besonders geeignet.
Nachdem die Gattung im Allgemeinen Kontext näher erläutert wurde, schließt sich deshalb in den folgenden Kapiteln eine Untersuchung ihrer Veränderung im Wandel der Zeit an. Dazu wird zunächst das antike Epigramm, das die Ursprünge der Gattung bildet fokussiert. Um diesem ein Epigramm gegenüberzustellen, das das Potential hat, eine Veränderung der Gattung zu verdeutlichen, soll daraufhin kein Epigramm der Renaissance analysiert werden, sondern das Epigramm des 19. Jahrhunderts. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Epochen und ihrer exemplarisch gewählten Einzelwerke sollen im letzten Kapitel dieser Arbeit dann gegenübergestellt werden, sodass das Potential der Gattung, anhand ihres Rezeptionsweges, in einem Fazit zusammengefasst werden kann.
Diese Gegenüberstellung findet hinsichtlich sprachlicher und inhaltlicher Aspekte statt. Da im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Werke der Epochen untersucht werden können, handelt es sich ausschließlich um den Vergleich der zuvor untersuchten Exemplare aus literarischer Perspektive. Dementsprechend wird von der historischen Begründung der Veränderungen abgesehen und da hinsichtlich der Einzelwerke bereits eine Vielzahl von Untersuchungen vorliegt, kann die Sekundärliteratur diesbezüglich vorrangig genutzt und in einen neuen Kontext übertragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Epigramm als Untersuchungsgegenstand
- Das antike Epigramm
- Martial als Epigrammatiker
- Die zwölf „Epigrammaton libri“
- Merkmale und Inhalte der Sammlung
- Formale Entscheidungen
- Das Epigramm des 19. Jahrhunderts
- Goethe und Schiller als Epigrammatiker
- Die „Xenien“
- Merkmale und Inhalte der Sammlung
- Formale Entscheidungen
- Gegenüberstellung des antiken und neuzeitlichen Epigramms
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte der Gattung des Epigramms, insbesondere die Veränderungen, die es im Wandel der Zeit erfährt. Sie befasst sich mit dem antiken Epigramm als Ursprung der Gattung und dem Epigramm des 19. Jahrhunderts als Beispiel für eine neuzeitliche Rezeption. Dabei steht die Frage im Vordergrund, inwieweit sich die Gattung in ihrem Rezeptionsweg verändert und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich zwischen den Epochen feststellen lassen.
- Die Entwicklung des Epigramms von den inschriftlichen Ursprüngen zur literarischen Gattung
- Die Rezeption des antiken Epigramms im 19. Jahrhundert
- Sprachliche und inhaltliche Merkmale des Epigramms in den verschiedenen Epochen
- Der Vergleich von exemplarischen Werken aus der Antike und dem 19. Jahrhundert
- Die erzieherische Funktion des Epigramms und seine Rolle als lehrhafte Kunstform
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Rezeptionsgeschichte der Gattung des Epigramms.
- Das Epigramm als Untersuchungsgegenstand: Dieses Kapitel definiert das Epigramm als Gattung, beleuchtet seine Ursprünge in der Antike und beschreibt seine wesentlichen Merkmale in Bezug auf Form, Inhalt und Funktion.
- Das antike Epigramm: Dieses Kapitel fokussiert auf die literarischen Epigramme der Antike, insbesondere auf die Werke Martials und seine Sammlung „Epigrammaton libri“. Es analysiert die Merkmale und Inhalte der Sammlung sowie die formalen Entscheidungen Martials als Epigrammatiker.
- Das Epigramm des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert das Epigramm des 19. Jahrhunderts am Beispiel der „Xenien“ von Goethe und Schiller. Es untersucht die Merkmale und Inhalte der Sammlung sowie die formalen Entscheidungen der beiden Dichter.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Rezeptionsgeschichte des Epigramms, insbesondere mit den historischen Entwicklungen der Gattung und dem Vergleich des antiken und neuzeitlichen Epigramms. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen die Merkmale des Epigramms, wie Kürze, Pointierung, Zweideutigkeit, Überraschung und erzieherische Funktion. Darüber hinaus werden wichtige Autoren wie Martial, Goethe und Schiller sowie deren Werke „Epigrammaton libri“ und „Xenien“ behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet die Gattung des Epigramms?
Das Epigramm zeichnet sich durch Kürze, Pointierung, Zweideutigkeit und oft eine überraschende Wendung am Ende aus. Ursprünglich als Inschrift entstanden, entwickelte es sich zu einer literarischen Kunstform.
Wer war Martial und welche Bedeutung hat er für das Epigramm?
Martial war ein bedeutender römischer Dichter, dessen „Epigrammaton libri“ die Gattung maßgeblich prägten. Er perfektionierte die satirische und pointierte Form des Epigramms.
Was sind die „Xenien“ von Goethe und Schiller?
Die „Xenien“ sind eine Sammlung von Epigrammen des 19. Jahrhunderts, in denen Goethe und Schiller literarische und gesellschaftliche Missstände ihrer Zeit kritisierten und verspotteten.
Wie unterschied sich die Funktion des Epigramms im 19. Jahrhundert von der Antike?
Während das antike Epigramm oft deskriptiv oder persönlich-satirisch war, nutzten Dichter des 19. Jahrhunderts die Form verstärkt als lehrhafte Kunstform mit einer erzieherischen oder gesellschaftskritischen Funktion.
Welche formalen Merkmale blieben über die Epochen hinweg erhalten?
Die prägnante Kürze und die Zuspitzung auf eine Pointe blieben als konstante Merkmale erhalten, auch wenn sich die sprachlichen Stile und historischen Kontexte änderten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Das antike Epigramm im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465009