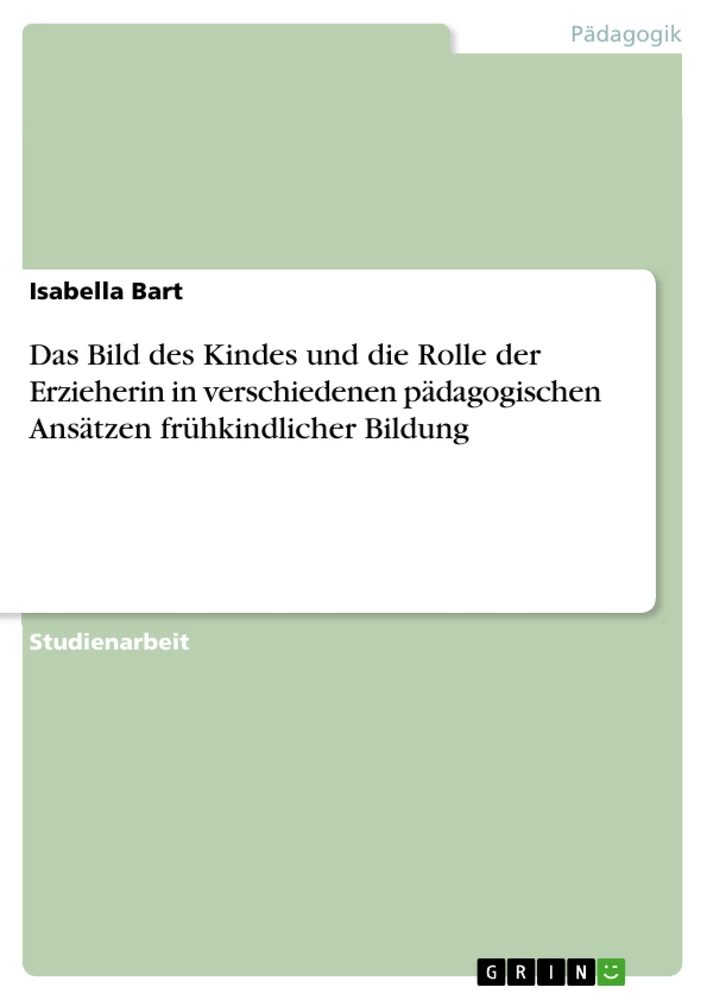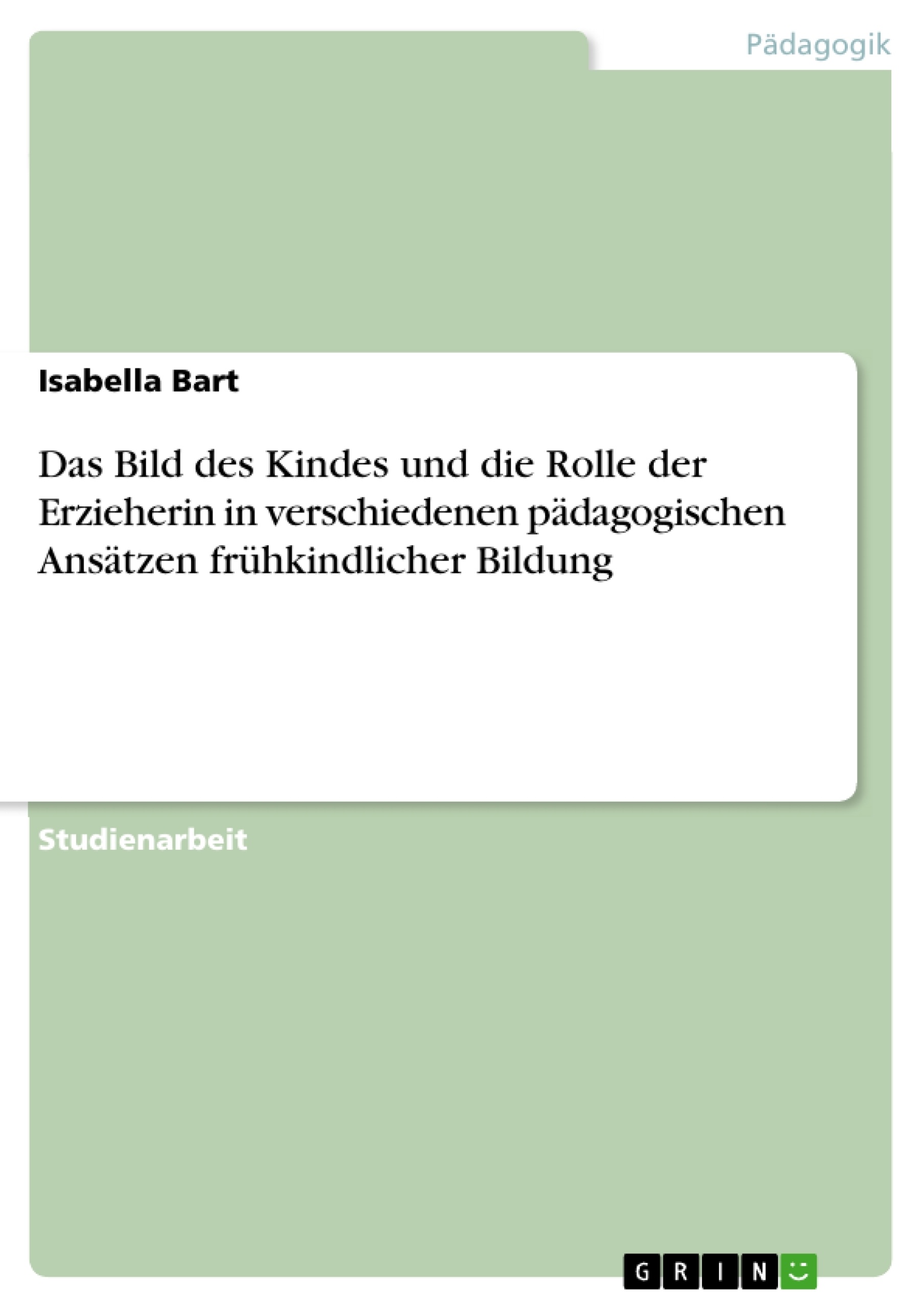Heutzutage erscheint es uns selbstverständlich, dass Kinder sich einbringen können und wollen und dass Bewegung, Altersmischung und freies Spiel den Lernprozess fördern. Doch wie entstanden diese Ansätze, die vor einigen Jahrzehnten noch ganz und gar nicht verbreitet waren? Sie alle gehen zumindest teilweise auf einige reformistische Pädagogen zurück, deren Erziehungsstile bis heute aktuell sind. Drei dieser Vorreiter werden in dieser Arbeit näher betrachtet und hinsichtlich ihrer verschiedenen Meinungen zum Bild des Kindes und der Rolle der Erzieherin verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Auszug aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan
- B. Das Bild des Kindes und die Rolle der Erzieherin in verschiedenen pädagogischen Ansätzen frühkindlicher Bildung
- B.I. Kindbilder
- B.I.1. Das Bild des Kindes bei Friedrich Fröbel
- B.I.1.a) Der angeborene Tätigkeits- und Bildungstrieb
- B.I.1.b) Entwicklung vom Unbewusstsein zum Bewusstsein
- B.I.2. Das Bild des Kindes bei Maria Montessori
- B.I.2.a) Das Kind als Baumeister seiner Selbst
- B.I.2.b) Sensible Phasen
- B.I.3. Das Bild des Kindes bei Rudolf Steiner
- B.I.3.a) Das Kind als Sinnesorgan
- B.I.3.b) Entwicklung zur Freiheit
- B.I.1. Das Bild des Kindes bei Friedrich Fröbel
- B.I. Kindbilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bild des Kindes und die Rolle der Erzieherin in verschiedenen pädagogischen Ansätzen der frühkindlichen Bildung. Im Fokus stehen die Ansätze von Friedrich Fröbel, Maria Montessori und Rudolf Steiner. Ziel ist ein Vergleich der unterschiedlichen Kindbilder und ihrer Auswirkungen auf die pädagogische Praxis.
- Das Bild des Kindes in der frühkindlichen Pädagogik
- Vergleich der Kindbilder bei Fröbel, Montessori und Steiner
- Die Rolle der Erzieherin in den verschiedenen Ansätzen
- Der Einfluss der Pädagogik auf den Alltag in Kindertageseinrichtungen
- Entwicklung des Kindes von Unbewusstsein zu Bewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
A. Auszug aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan: Dieser Abschnitt präsentiert Zitate aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, die die aktuelle Sichtweise auf das Kind und seine aktive Rolle im Bildungsprozess verdeutlichen. Die Zitate betonen die Bedeutung von freiem Spiel, Bewegung und Altersmischung als förderliche Elemente für das Lernen. Sie dienen als Ausgangspunkt für die Betrachtung historischer pädagogischer Ansätze, die zu dieser modernen Sichtweise beigetragen haben.
B.I. Kindbilder: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem es die Bedeutung des Kindbildes für die pädagogische Praxis in Kindertagesstätten erläutert. Es wird deutlich, dass die jeweilige erziehungswissenschaftliche Grundlage die Herangehensweise an die Betreuung maßgeblich beeinflusst. Die folgenden Abschnitte befassen sich mit den Kindbildern dreier wichtiger Pädagogen.
B.I.1. Das Bild des Kindes bei Friedrich Fröbel: Fröbels revolutionäres Bild vom Kind als vernunftbegabtes Wesen, das ein Recht auf würdevolle Behandlung hat, wird hier vorgestellt. Sein pädagogischer Ansatz, der auf Pestalozzis Philosophie aufbaut, betont den angeborenen Tätigkeits- und Bildungstrieb des Kindes. Fröbel sieht das Spiel als elementares Lernmittel und entwickelt die Fröbelgaben als pädagogische Spielmaterialien. Die Entwicklung wird als Prozess der Bewusstwerdung beschrieben, der durch Selbsttätigkeit vorangetrieben wird und von der Sensomotorik bis zum abstrakt-begrifflichen Denken reicht.
B.I.2. Das Bild des Kindes bei Maria Montessori: Montessori erweitert Fröbels Ansatz, indem sie das Kind als "Baumeister seiner Selbst" beschreibt, dessen Entwicklung durch angeborene Aktivität und Anpassungsfähigkeit vorangetrieben wird. Der Begriff der "sensiblen Phasen" wird eingeführt, um die spezifischen Lernbereitschaften in verschiedenen Entwicklungsphasen zu beschreiben. Die erste Phase (Geburt bis 6 Jahre) wird als grundlegende Phase der Menschwerdung hervorgehoben, in der die Grundlagen für Bewegung, Sprache und soziale Bindungen gelegt werden. Der Vergleich mit der Entwicklung von Himmelskörpern aus Nebelflecken verdeutlicht die individuelle und nicht vollständig vorbestimmte Entwicklung des Kindes.
B.I.3. Das Bild des Kindes bei Rudolf Steiner: Steiner's anthroposophische Pädagogik betont die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung in der frühkindlichen Entwicklung. Das Kind wird als "ganz Sinnesorgan" beschrieben, das seine Umwelt unmittelbar aufnimmt und nachahmt. Die Entwicklung zur Freiheit und Selbstbestimmung, basierend auf dem individuellen Lebensmotiv des Kindes, bildet einen zentralen Aspekt dieses Ansatzes.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Bildung, Kindbild, Pädagogische Ansätze, Fröbel, Montessori, Steiner, Erziehung, Spiel, Selbsttätigkeit, Sensible Phasen, Entwicklung, Bewusstwerdung, Bewegung, Altersmischung, Freie Tätigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Bild des Kindes und die Rolle der Erzieherin in verschiedenen pädagogischen Ansätzen frühkindlicher Bildung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Kindbilder und die Rolle der Erzieherin in verschiedenen pädagogischen Ansätzen der frühkindlichen Bildung, insbesondere die Ansätze von Friedrich Fröbel, Maria Montessori und Rudolf Steiner. Sie analysiert die unterschiedlichen Kindbilder und deren Auswirkungen auf die pädagogische Praxis und bezieht den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan mit ein.
Welche pädagogischen Ansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze von Friedrich Fröbel, Maria Montessori und Rudolf Steiner. Es wird untersucht, wie diese Pädagogen das Kind sehen und welche Rolle sie der Erzieherin in der Bildung zukommen lassen.
Wie wird das Kind in den verschiedenen Ansätzen gesehen?
Fröbel: Das Kind wird als vernunftbegabtes Wesen mit einem angeborenen Tätigkeits- und Bildungstrieb gesehen. Das Spiel ist ein zentrales Lernmittel. Die Entwicklung wird als Prozess der Bewusstwerdung beschrieben. Montessori: Das Kind ist der "Baumeister seiner Selbst", dessen Entwicklung durch angeborene Aktivität und Anpassungsfähigkeit vorangetrieben wird. Sensible Phasen kennzeichnen besondere Lernbereitschaften. Steiner: Das Kind ist ein "ganz Sinnesorgan", das seine Umwelt unmittelbar aufnimmt und nachahmt. Die Entwicklung zur Freiheit und Selbstbestimmung steht im Vordergrund.
Welche Rolle spielt die Erzieherin in den verschiedenen Ansätzen?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Erzieherin in den drei genannten Ansätzen, jedoch ohne explizit die jeweiligen Rollen zu definieren. Der Fokus liegt stärker auf den Kindbildern und deren Einfluss auf die pädagogische Praxis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Bild des Kindes in der frühkindlichen Pädagogik, einen Vergleich der Kindbilder bei Fröbel, Montessori und Steiner, die Rolle der Erzieherin in den verschiedenen Ansätzen, den Einfluss der Pädagogik auf den Alltag in Kindertageseinrichtungen und die Entwicklung des Kindes vom Unbewusstsein zum Bewusstsein.
Wie wird der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan berücksichtigt?
Ein Auszug aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan dient als Ausgangspunkt und zeigt die aktuelle Sichtweise auf das Kind und seine aktive Rolle im Bildungsprozess. Die Zitate betonen die Bedeutung von freiem Spiel, Bewegung und Altersmischung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Frühkindliche Bildung, Kindbild, Pädagogische Ansätze, Fröbel, Montessori, Steiner, Erziehung, Spiel, Selbsttätigkeit, Sensible Phasen, Entwicklung, Bewusstwerdung, Bewegung, Altersmischung, Freie Tätigkeit.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, welche die Kernaussagen jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen beschreiben den Inhalt und die wichtigsten Erkenntnisse jedes Abschnitts.
- Quote paper
- Isabella Bart (Author), 2013, Das Bild des Kindes und die Rolle der Erzieherin in verschiedenen pädagogischen Ansätzen frühkindlicher Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464966