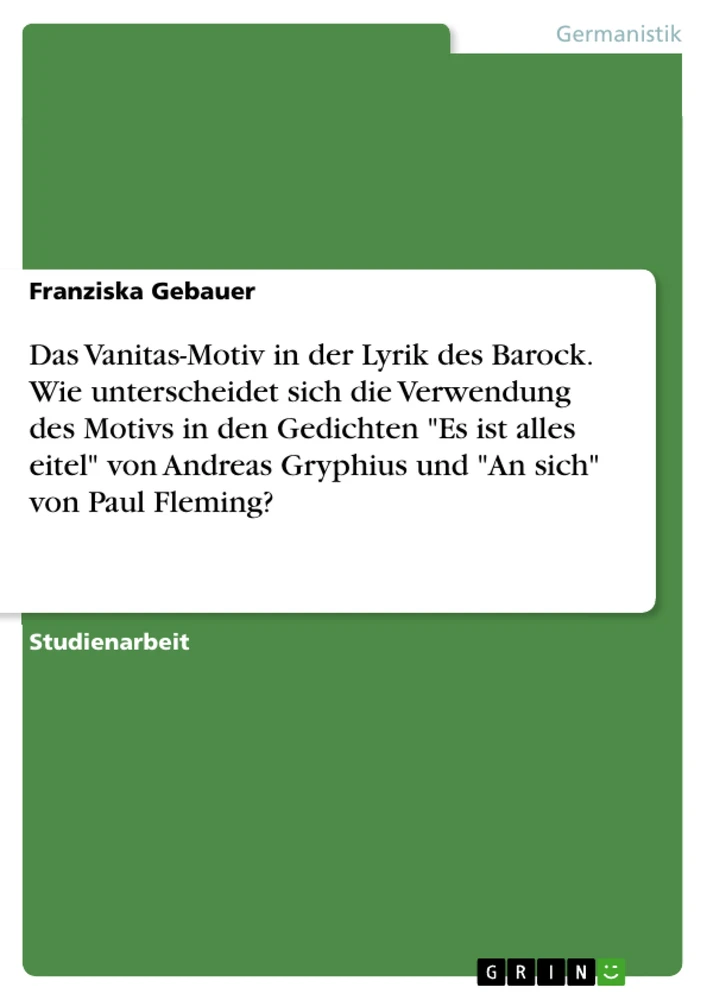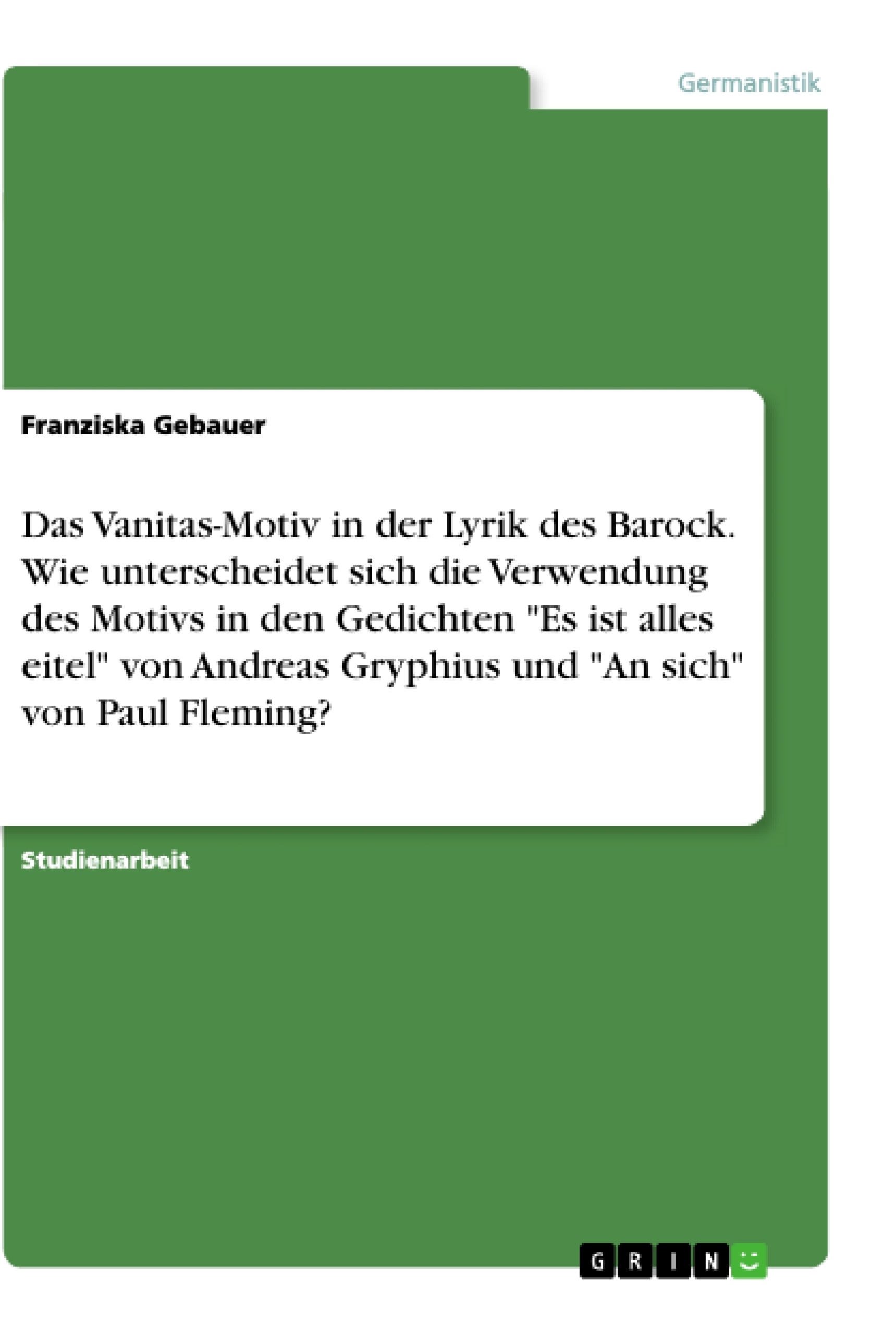Anhand der zwei Gedichte „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius und „An sich“ von Paul Fleming soll in dieser Arbeit die unterschiedliche Verwendungsweise des Vanitas-Motivs beispielhaft verdeutlicht werden. Zunächst werden hierfür das Leitmotiv „Vanitas“ und das damit einhergehende „Memento Mori“ definiert und es wird deren Herkunft erklärt. Die Analysen der Gedichte setzen sich zusammen aus der formalen Analyse und des darauffolgenden Interpretationsansatzes hinsichtlich des oben genannten Leitmotivs. Eine Schlussfolgerung soll abschließend die verschiedenen Verwendungsweisen des Vanitas-Motivs klären. Die in der Analyse genutzten Versangaben werden dabei im Fließtext erwähnt.
Blickt man auf das 17. Jahrhundert zurück, so gibt es kaum einen Abschnitt in der europäischen Geschichte, welcher mehr von Spannungen und Gegensätzen geprägt war, wie dieser. Durch die vorherrschenden Kriege, unter anderem den dreißigjährigen Krieg, waren die Menschen täglich mit den Themen Tod und Vergänglichkeit konfrontiert. Mit den daraus resultierenden Spannungen zwischen dem Verlangen nach einem erfüllten Leben und der Angst vor dem Tod beschäftigte sich auch die Literatur des 17. Jahrhunderts. Dichter und Schriftsteller wie Andreas Gryphius oder Paul Fleming verarbeiteten diese Spannungsverhältnisse in ihren Gedichten. So taucht der Vanitas-Gedanke in der Lyrik des Barock immer wieder auf und wird dabei auf verschiedene Art und Weise und zu unterschiedlichen Zwecken ausgelegt und verarbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärungen
- Vanitas
- Memento Mori
- Interpretation an ausgewählten Gedichten
- Andreas Gryphius: Es ist alles eitel
- Formanalyse
- Interpretationsansatz hinsichtlich des Vanitas-Motivs.
- Paul Fleming: An sich
- Formanalyse
- Interpretationsansatz hinsichtlich des Vanitas-Motivs.
- Andreas Gryphius: Es ist alles eitel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Verwendung des Vanitas-Motivs in der Barocklyrik. Sie soll den verschiedenen Verwendungsweisen des Motivs anhand der Gedichte „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius und „An sich“ von Paul Fleming beispielhaft aufzeigen. Zunächst werden die Begriffe „Vanitas“ und „Memento Mori“ erläutert und ihre historische Bedeutung dargestellt. Anschließend erfolgt eine detaillierte Analyse der beiden Gedichte, wobei sowohl formale Aspekte als auch die Interpretation im Hinblick auf das Vanitas-Motiv berücksichtigt werden.
- Die Bedeutung des Vanitas-Gedankens in der Barocklyrik
- Die unterschiedlichen Verwendungsweisen des Vanitas-Motivs
- Die Verbindung zwischen Vanitas und Memento Mori
- Die Rolle des Todes und der Vergänglichkeit in der Barocklyrik
- Die Analyse der Gedichte „Es ist alles eitel“ und „An sich“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit und den Forschungsgegenstand vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Todes und der Vergänglichkeit in der Barocklyrik und führt die beiden Gedichte „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius und „An sich“ von Paul Fleming als beispielhafte Werke ein.
Das Kapitel „Begriffserklärungen“ definiert die Leitmotive „Vanitas“ und „Memento Mori“ und erläutert ihre historische Herkunft und Bedeutung. Es wird auf die Rolle des Vanitas-Gedankens in der Bibel und in der Antike eingegangen und seine verschiedene Auslegungen und Funktionen im Kontext der Barocklyrik werden beschrieben.
Das Kapitel „Interpretation an ausgewählten Gedichten“ analysiert zunächst formal die Gedichte „Es ist alles eitel“ und „An sich“. Anschließend erfolgt eine detaillierte Interpretation der Gedichte im Hinblick auf das Vanitas-Motiv, wobei die unterschiedlichen Verwendungen des Motivs in den beiden Werken herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Barocklyrik, Vanitas, Memento Mori, Andreas Gryphius, Paul Fleming, „Es ist alles eitel“, „An sich“, Todesmahnung, Vergänglichkeit, Lebensdeutung, Todverfallenheit, formale Analyse, Interpretation.
- Quote paper
- Franziska Gebauer (Author), 2017, Das Vanitas-Motiv in der Lyrik des Barock. Wie unterscheidet sich die Verwendung des Motivs in den Gedichten "Es ist alles eitel" von Andreas Gryphius und "An sich" von Paul Fleming?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464295