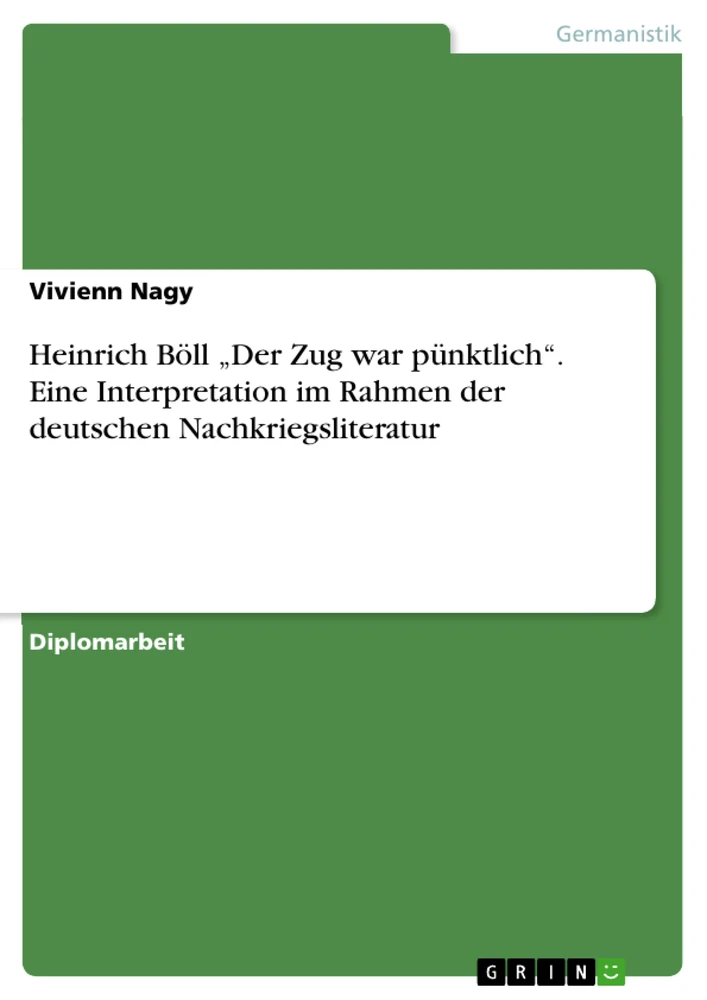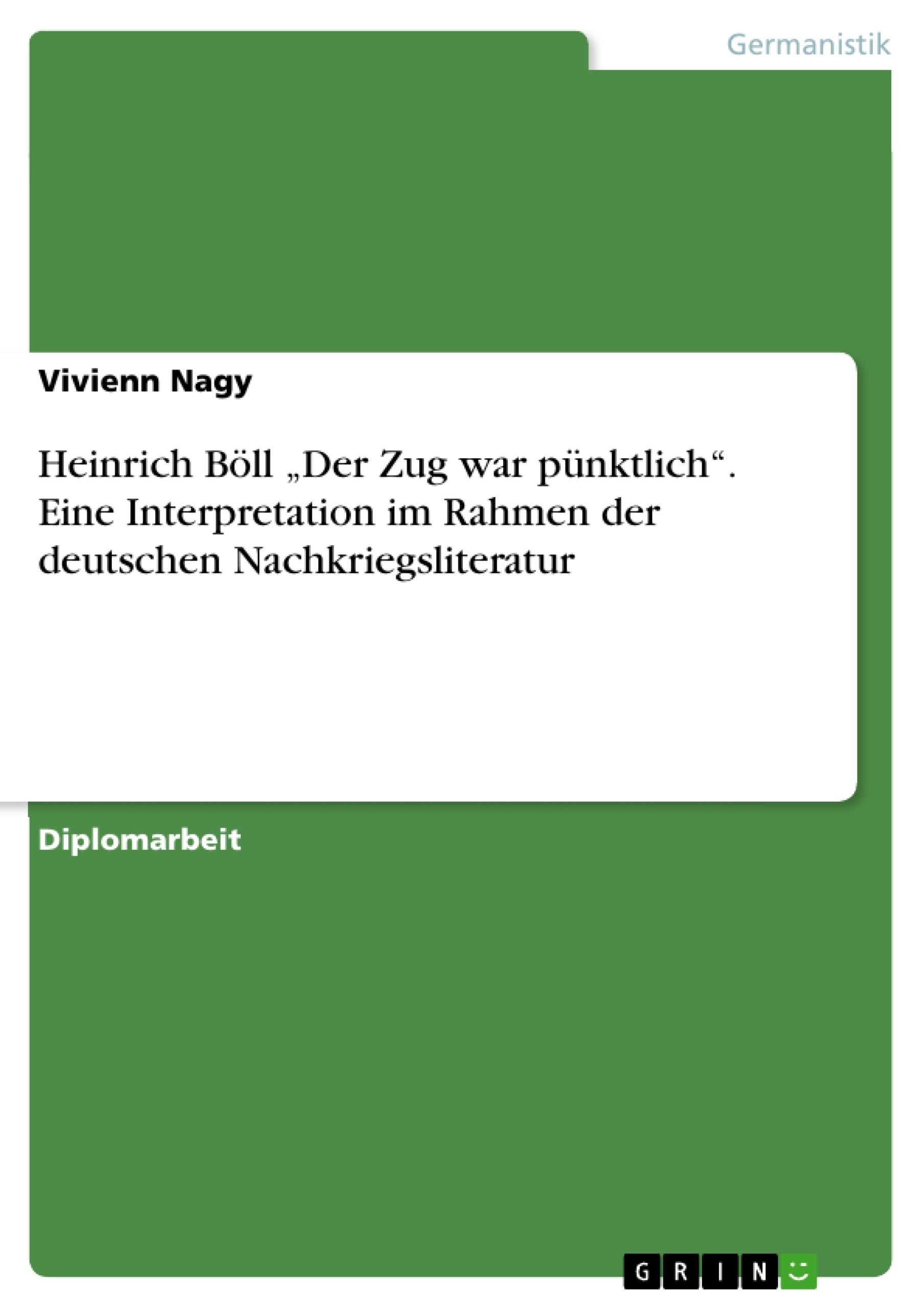Die erste größere Erzählung wurde von Böll im 1946/47 geschrieben, aber sie wurde erst nach der Währungsreform veröffentlicht. Einen ersten Hinweis auf das Entstehen von diesem Werk hat Böll seinem Freund Ernst-Adolf Kunz im Jahr 1948 gegeben. Er schrieb:
„Mein erster Arbeitstag hier oben [im Dachgeschoss seines Hauses] war sehr erfolgreich.
Ich habe eine große Novelle angefangen, die etwa 40 Tippseiten umfassen wird, davon sind gleich in der ersten Nacht zwanzig fertig geworden und heute geht es weiter.“ (BBK, S. 66) Am 28. 04. 1948 wurde das Manuskript mit dem Titel Zwischen Lemberg und Czernowitz beendet. Böll versuchte einen Verlag für das Manuskript finden und der Friedrich Middelhauve-Verlag wollte junge Autoren fördern. Paul Schaaf ein Lektor, der selbst Schriftsteller war, schrieb ein Brief an Böll im Jahr 1949 über die Erzählung Zwischen Lemberg und Czernowitz.
[...]
Ein junger Soldat des Zweiten Weltkrieges verabschiedet sich vor der Rückreise an die Ostfront auf einem Bahnhof von seinem Freund Paul, einem Kaplan, und betont wiederholt, er wolle nicht sterben. „Ich will nicht sterben, schrie er, ich will nicht sterben, aber das Schreckliche ist, daß ich sterben werde … bald!“ Schon bei dem Beginn erfahren wir den Namen des Soldaten, er heißt Andreas. Nach der Abfahrt dachte er immer daran, dass er bald sterben wird, aber er wusste nicht, wann.
[...]
Der pünktliche Zug brachte ihn in diesem Tod, der zwischen Lemberg und Czernowitz eintreffen sollte. „Ich bin irrsinnig, [...] ich bin wahnsinnig, ich müßte ja zwischen Lemberg und Czernowitz sterben!“ Während der Fahrt traf Andreas mit zwei Soldaten zusammen.
Sie waren der Unrasierte und der Blonde, die luden ihn zum Kartenspiel ein, und sie erzählten über ihre Kriegserlebnissen. Als der Zug in Dresden ankam, wollte Andreas fliehen, aber sein Mut verließ ihn, er dachte: „Ich könnte hier aussteigen, irgendwohin gehen […] bis sie mich schnappten […] aber ich bin ganz starr, dieser Zug gehört zu mir, und ich gehöre zu diesem Zug, der mich meiner Bestimmung entgegentragen muß…“ Andreas erinnerte sich während der Zugfahrt aber auch ständig an ein Ereignis, das einige Zeit zurückliegt. Während des Frankreichfeldzuges wurde er verwundet, und als er aus einer Bewusstlosigkeit für kurze Zeit aufwachte, schaute er in die Augen eines Mädchens, das sich über ihn gebeugt hatte.
[...]
Die ersten Figuren von Böll waren einfache, leidende Personen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Deutsche Literatur in der Nachkriegszeit
- 1) Literatur nach 1945
- 2) Die Gruppe 47
- 3) Die Kurzgeschichte
- III. Heinrich Böll
- 1) Kindheit und Jugend
- 2) Kriegszeit und Nachkriegszeit
- 3) Böll in Ungarn während des Krieges
- 4) Das Heinrich-Böll-Archiv der Stadtbibliothek Köln
- 5) Die Kölner Ausgabe
- IV. Der Zug war pünktlich
- 1) Entstehung und Titel der Erzählung
- 2) Das Handlungsmodell der Erzählung
- 3) Die Handlung
- 4) Die Personen
- a) Figuren
- b) Andreas
- c) Der Unrasierte
- d) Der Blonde
- e) Olina
- V. Motive in der Erzählung
- 1) Die Liebe als Motiv
- 2) Der Zug als Motiv
- 3) Das Essen als Motiv
- VI. Die Rolle des Gebetes in der Erzählung
- VII. Zusammenfassung
- Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die deutsche Literatur
- Die literarische Epoche der Nachkriegszeit und die Gruppe 47
- Die Rolle der Kurzgeschichte in der Nachkriegsliteratur
- Heinrich Bölls Biografie und seine Kriegserlebnisse
- Die Analyse der Erzählung "Der Zug war pünktlich" in Bezug auf Handlung, Personen, Motive und religiöse Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Heinrich Bölls Erzählung "Der Zug war pünktlich" im Kontext der deutschen Nachkriegsliteratur. Das Ziel ist es, einen umfassenden Einblick in die Erzählung zu bieten, ihre Entstehung und Bedeutung im Werk des Autors zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Zielsetzung der Analyse von Heinrich Bölls Erzählung "Der Zug war pünktlich" dar. Die Geschichte der deutschen Nachkriegsliteratur wird behandelt, wobei die Gruppe 47 und die Bedeutung der Kurzgeschichte im Vordergrund stehen. In Kapitel III wird die Biografie Heinrich Bölls beleuchtet, mit besonderem Fokus auf seine Kindheit, seine Kriegserlebnisse und seine Verbindung zu Ungarn. Die Entstehung und der Titel der Erzählung "Der Zug war pünktlich" werden im vierten Kapitel besprochen. Die Handlung und die wichtigsten Personen werden dargelegt, wobei die Motive der Liebe, des Zuges und des Essens in der Erzählung untersucht werden. Schließlich wird die Rolle des Gebetes in der Erzählung und ihre Bedeutung in der Geschichte betrachtet.
Schlüsselwörter
Heinrich Böll, Deutsche Nachkriegsliteratur, Gruppe 47, Kurzgeschichte, Kriegserlebnisse, "Der Zug war pünktlich", Handlungsmodell, Liebe, Zug, Essen, Gebet.
- Quote paper
- Vivienn Nagy (Author), 2018, Heinrich Böll „Der Zug war pünktlich“. Eine Interpretation im Rahmen der deutschen Nachkriegsliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464285