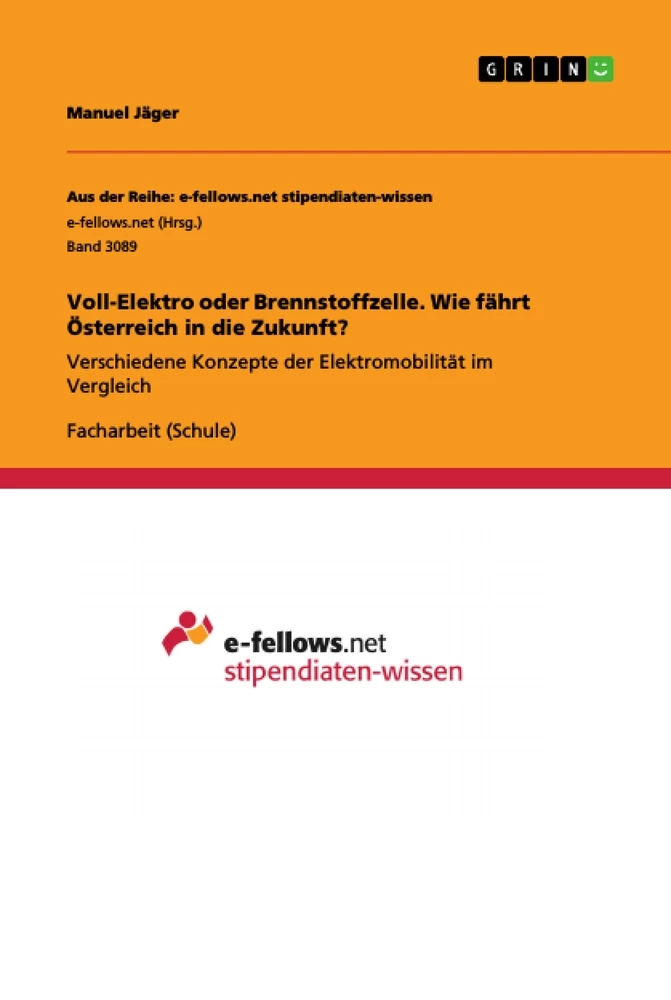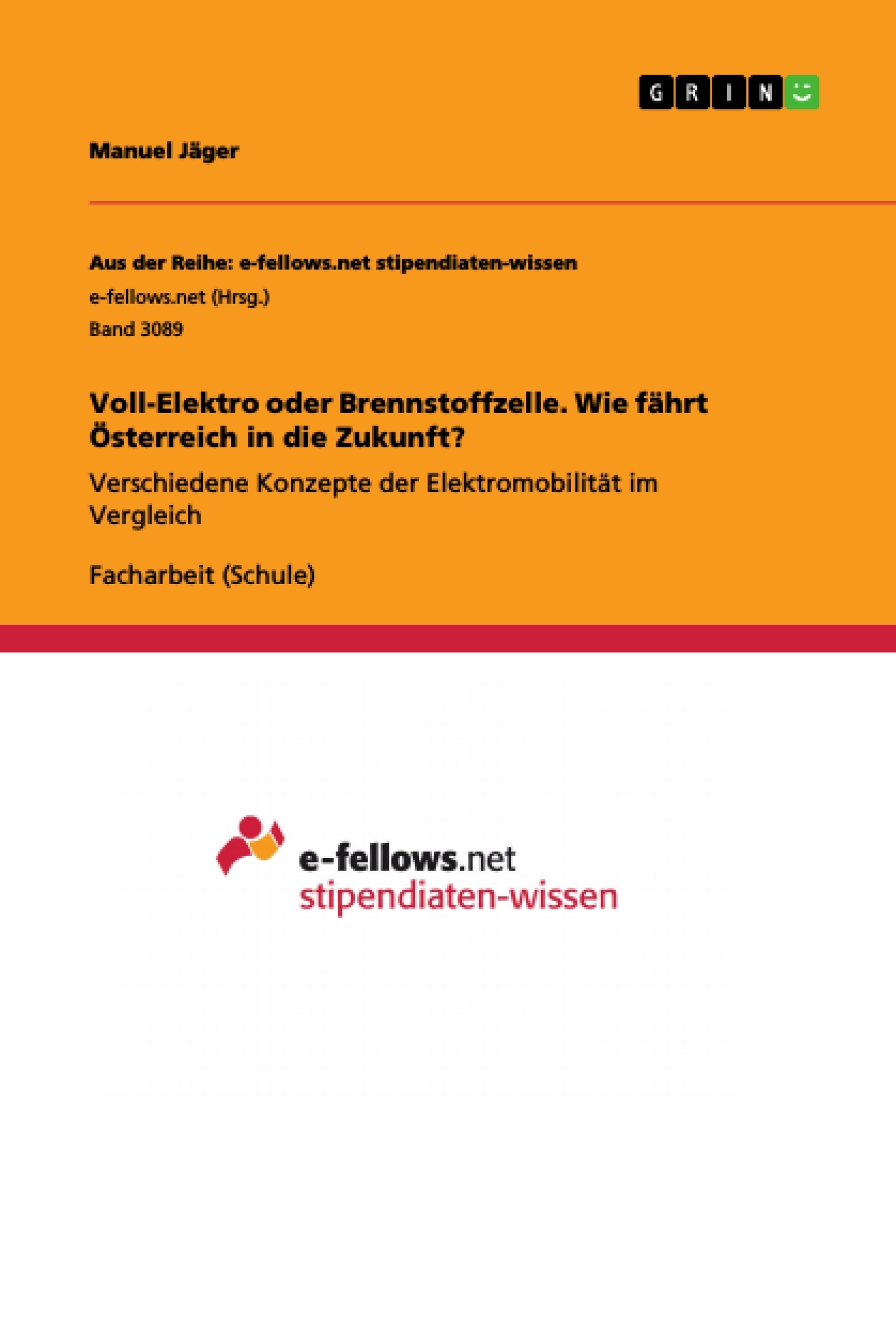Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Automobilbranche und der Elektromobilität in Österreich.
Das wachsende Bedürfnis nach Mobilität bei gleichzeitiger Verknappung von fossilen Treibstoffen wird sich in Zukunft nur mit alternativen Antrieben befriedigen lassen. Wenn man die dynamische Entwicklung der Automobilbranche betrachtet, erkennt man eindeutig, dass das Zeitalter der regenerativen Mobilität bereits begonnen hat.
In dieser Arbeit werden Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge mit ihren wichtigsten Komponenten wie zum Beispiel Elektromotor, Energiespeicher oder Leistungselektronik beschrieben. Auch auf die geschichtliche Entwicklung dieser Fahrzeuge wird eingegangen, da Elektroautos am Anfang des vorherigen Jahrhunderts bereits große Teile der Neuzulassungen ausmachten, und dann plötzlich von den Straßen verschwanden.
Anschließend werden die zwei Antriebsformen auf wirtschaftliche und ökologische Faktoren miteinander verglichen, um die Frage nach der momentan besseren Alternative zu beantworten. Thematisiert werden auch verschiedene Fördermodelle, die Netzintegration und die nötige Infrastruktur in Form von Tankstellen
Abschließend wird eine auf Studien und Expertenmeinungen gegründete Zukunftsprognose für die Entwicklung der Zulassungszahlen jener Fahrzeuge in Österreich und für die generelle Entwicklung dieses Bereichs erstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Geschichtlicher Abriss
- 3. Voll-Elektroauto
- 3.1 Antrieb
- 3.1.1 Synchronmaschine
- 3.1.2 Asynchronmaschine
- 3.1.3 Leistungselektronik
- 3.1.4 Getriebe
- 3.2 Batterien und ihre Leistungsfähigkeit
- 3.2.1 Sicherheit und Batteriemanagement
- 3.2.2 Lebensdauer, Umweltverträglichkeit und Kosten
- 3.3 Leichtbau und andere Sparmaßnahmen
- 3.4 Plug-In-Systeme und Hybrid als Vorstufen
- 3.1 Antrieb
- 4. Das Brennstoffzellenauto
- 4.1 Antrieb
- 4.1.1 Die Brennstoffzelle
- 4.1.2 Der Elektromotor
- 4.2 Wasserstoffspeicherung und Gefahren
- 4.2.1 Gasförmiger Wasserstoff in Drucktanks
- 4.2.2 Flüssiger Wasserstoff in isolierten Tanks
- 4.3 Erzeugung von Wasserstoff
- 4.1 Antrieb
- 5. Vergleich, weitere Entwicklung und Fazit
- 5.1 Bilanz der Energiebereitstellungskette
- 5.2 Ökobilanz
- 5.3 Förderungen in Österreich
- 5.4 Netzintegration
- 5.4.1 Erste Stufe: Netzdienliches Laden
- 5.4.2 Zweite Stufe: Bidirektionaler Stromfluss
- 5.5 Zulassungsstatistik
- 5.6 Entwicklung des Marktes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht alternative Antriebsformen für Fahrzeuge, speziell Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge, im Hinblick auf ihre wirtschaftliche und ökologische Machbarkeit in Österreich. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile beider Technologien zu vergleichen und eine Zukunftsprognose für den österreichischen Markt zu erstellen.
- Vergleich von Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeugen
- Ökologische Aspekte und CO2-Emissionen
- Wirtschaftliche Faktoren und Fördermodelle
- Notwendige Infrastruktur und Netzintegration
- Zukunftsprognose für den österreichischen Markt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der zukünftigen Mobilität in Österreich ein und begründet die Notwendigkeit der Suche nach alternativen Antrieben angesichts der Verknappung fossiler Brennstoffe und des Klimawandels. Es wird die Problematik steigender Treibstoffpreise und die Notwendigkeit eines sanften Übergangs zu erneuerbaren Energien hervorgehoben. Die Arbeit skizziert den Vergleich von Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen als Hauptfokus und die Prognose der zukünftigen Marktentwicklung in Österreich.
2. Geschichtlicher Abriss: Dieses Kapitel bietet einen Rückblick auf die Entwicklung von Elektroautos, von ihren frühen Erfolgen zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu ihrem Rückzug vom Markt und dem erneuten Aufleben des Interesses. Der historische Kontext verdeutlicht die Schwankungen in der Akzeptanz und den technologischen Herausforderungen der Vergangenheit, die für das Verständnis der aktuellen Situation relevant sind.
3. Voll-Elektroauto: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die Funktionsweise von Elektroautos, beginnend mit den verschiedenen Arten von Elektromotoren (Synchron- und Asynchronmaschinen) und der Leistungselektronik. Es werden die Batterien, ihre Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Lebensdauer, Umweltverträglichkeit und Kosten detailliert untersucht. Leichtbaumaßnahmen und die Rolle von Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen als Vorstufen zu rein elektrischen Fahrzeugen werden ebenfalls behandelt. Die Kapitelteile arbeiten die technischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Elektromobilität heraus.
4. Das Brennstoffzellenauto: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Brennstoffzellenfahrzeuge, erklärt die Funktionsweise der Brennstoffzelle und des Elektromotors als Antrieb. Es geht auf die verschiedenen Möglichkeiten der Wasserstoffspeicherung (gasförmig und flüssig) und die damit verbundenen Sicherheitsaspekte ein. Schließlich wird die Erzeugung von Wasserstoff und die damit verbundene Energiebilanz beleuchtet. Die Kapitelteile behandeln die Vor- und Nachteile der Brennstoffzellentechnologie im Vergleich zu den Elektroautos.
5. Vergleich, weitere Entwicklung und Fazit: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Vergleich von Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen, indem es die Energiebereitstellungsketten, die Ökobilanzen und die Fördermodelle in Österreich gegenüberstellt. Es wird die Bedeutung der Netzintegration und die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur (z.B. Wasserstoff-Tankstellen) diskutiert. Schließlich werden die Zulassungsstatistiken analysiert und eine Prognose für die zukünftige Marktentwicklung in Österreich erstellt. Das Kapitel synthetisiert die Ergebnisse der vorherigen Kapitel und gibt einen Ausblick auf die Entwicklung der alternativen Antriebstechnologien.
Schlüsselwörter
Elektroauto, Brennstoffzellenfahrzeug, alternative Antriebe, Mobilität der Zukunft, Österreich, regenerative Energien, CO2-Emissionen, Wasserstoff, Batterien, Netzintegration, Fördermodelle, Zukunftsprognose, wirtschaftliche Faktoren, ökologische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Alternative Antriebsformen für Fahrzeuge in Österreich"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht alternative Antriebsformen für Fahrzeuge, speziell Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge, in Bezug auf deren wirtschaftliche und ökologische Machbarkeit in Österreich. Sie vergleicht die Vor- und Nachteile beider Technologien und erstellt eine Zukunftsprognose für den österreichischen Markt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich von Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeugen, ökologische Aspekte und CO2-Emissionen, wirtschaftliche Faktoren und Fördermodelle, notwendige Infrastruktur und Netzintegration sowie eine Zukunftsprognose für den österreichischen Markt. Die technischen Details der Antriebssysteme (Elektromotoren, Batterien, Brennstoffzellen, Wasserstoffspeicherung) werden ebenfalls ausführlich erklärt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Geschichtlicher Abriss, Voll-Elektroauto, Das Brennstoffzellenauto und Vergleich, weitere Entwicklung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit einer Einführung und einem historischen Überblick, gefolgt von detaillierten Beschreibungen der Elektro- und Brennstoffzellentechnologie und abschließend einem Vergleich und einer Zukunftsprognose.
Wie werden Elektroautos beschrieben?
Das Kapitel über Elektroautos beschreibt ausführlich deren Funktionsweise, inklusive verschiedener Elektromotorentypen (Synchron- und Asynchronmaschinen), Leistungselektronik, Batterien (Leistung, Sicherheit, Lebensdauer, Umweltverträglichkeit, Kosten), Leichtbaumaßnahmen und die Rolle von Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen.
Wie werden Brennstoffzellenfahrzeuge beschrieben?
Das Kapitel über Brennstoffzellenfahrzeuge erklärt die Funktionsweise der Brennstoffzelle und des Elektromotors. Es behandelt verschiedene Wasserstoffspeicherungsmethoden (gasförmig und flüssig) und die damit verbundenen Sicherheitsaspekte. Die Erzeugung von Wasserstoff und die Energiebilanz werden ebenfalls beleuchtet.
Wie werden Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge verglichen?
Der Vergleich der beiden Antriebsformen umfasst die Energiebereitstellungsketten, Ökobilanzen, Fördermodelle in Österreich, die Bedeutung der Netzintegration und die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur. Zulassungsstatistiken und eine Prognose der zukünftigen Marktentwicklung in Österreich werden ebenfalls präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elektroauto, Brennstoffzellenfahrzeug, alternative Antriebe, Mobilität der Zukunft, Österreich, regenerative Energien, CO2-Emissionen, Wasserstoff, Batterien, Netzintegration, Fördermodelle, Zukunftsprognose, wirtschaftliche Faktoren, ökologische Aspekte.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für alternative Antriebsformen, insbesondere Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge, interessieren. Sie eignet sich für akademische Zwecke, z.B. im Rahmen von Studienarbeiten oder Forschungsarbeiten zu Themen der Mobilität und der Energiewende.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die einzelnen Abschnitte. Für detailliertere Informationen ist die vollständige Arbeit einzusehen.
Gibt es eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse?
Das Kapitel "Vergleich, weitere Entwicklung und Fazit" bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit, inklusive eines Vergleichs der beiden Antriebstechnologien und einer Zukunftsprognose für den österreichischen Markt.
- Citation du texte
- Manuel Jäger (Auteur), 2015, Voll-Elektro oder Brennstoffzelle. Wie fährt Österreich in die Zukunft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464257