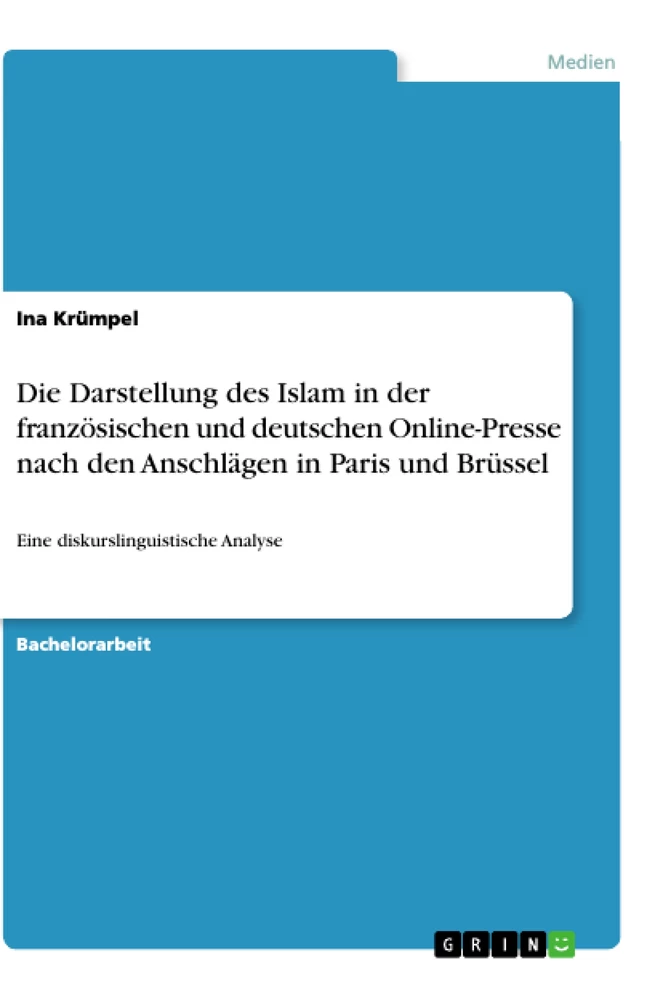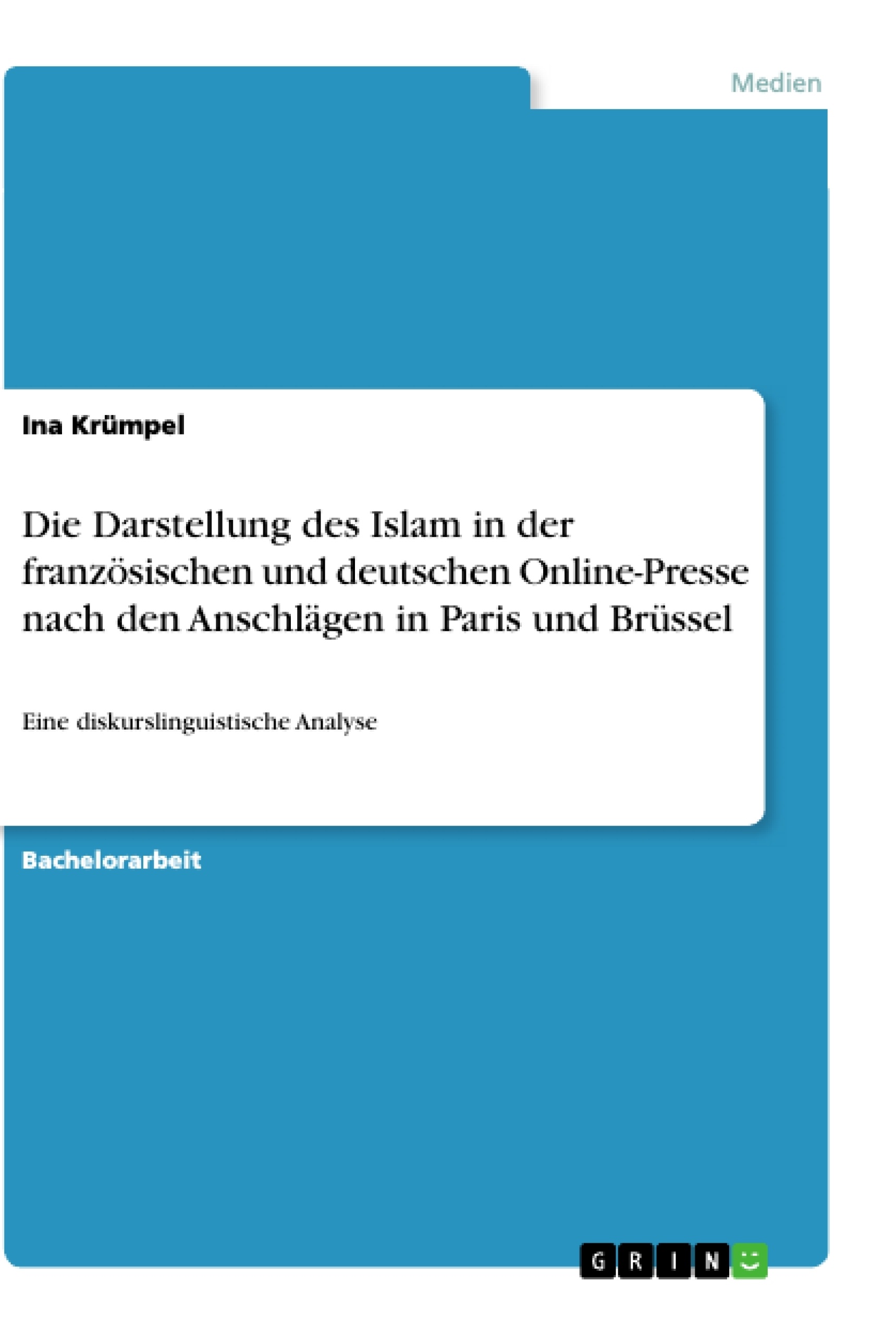Ein Thema, das seit den Pariser und Brüsseler Anschlägen in den Jahren 2015 und 2016 in Europa besonders kontrovers diskutiert und in den Medien präsentiert wurde, ist der Islam und inwiefern er, wenn überhaupt, mit den Terroranschlägen in Verbindung gebracht werden kann. In Europa spielen bei dieser Diskussion besonders die Länder Frankreich und Deutschland durch die Kolonialgeschichte beziehungsweise die aktuelle Flüchtlingssituation und die damit einhergehende Immigrationspolitik eine bedeutende Rolle, wobei in beiden Ländern aus verschiedenen Gründen ein bestimmtes Islambild existiert.
Die Massenmedien haben zu diesem Bild beigetragen und durch ihr eng verknüpftes Nachrichtennetz eine hohe Anzahl an Informationen innerhalb kürzester Zeit nach den Attentaten in Umlauf bringen können, wobei eine Vermischung von „Islam“ und „Islamismus“ leicht auszulösen war. Inwieweit dies in der deutschen bzw. französischen Presse sprachlich geschehen ist, werde ich in dieser Arbeit anhand von zwei verschiedenen Online-Quellen diskurslinguistisch analysieren. Als „typisch“ bezeichne ich an dieser Stelle die in den Medien rekurrierende Lexik, die auf das Sprachthema der Darstellung des Islam Einfluss nimmt, sowie transtextuelle, kulturell verankerte Merkmale, die u.a. auf dem konstituierten Wissen der Medien basieren.
Um dies zu klären, steht daher nicht nur das „Was“, sondern auch primär das „Wie“ im Vordergrund der Analyse, woraus sich folgendes Erkenntnisinteresse ergibt:
Wie werden das Islambild und das damit verbundene kollektive Wissen der Gesellschaft in der deutschen und französischen Presse sprachlich dargestellt?
Nachdem ich demnach zunächst die diskurslinguistische Theorie mit den Analysevorschlägen nach Jürgen Spitzmüller und Ingo H. Warnke vorstelle, werde ich im Anschluss auf die für die Diskursanalyse relevanten soziopolitischen und -kulturellen Hintergründe bzgl. Deutschland, sowie auch Frankreich eingehen und schließlich exemplarische Belege auf der sprachlichen Ebene aus den ausgewählten Online-Artikeln für die Elemente des Diskurses herausarbeiten. Die Ergebnisse werde ich daraufhin in einem zusammenfassenden Abschlusskapitel mit Hinblick auf die Ausgangsfrage, sowie mit dem Wissen, dass die Resultate nur zu einem geringen Maß aufgrund des kleinen Korpus repräsentativ sind, prüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Diskurslinguistik: Das theoretische Modell
- 2.1 Diskursebene
- 2.2 Akteursebene
- 2.3 Textebene
- 3. Der Islamdiskurs auf Diskursebene
- 3.1 Frankreich
- 3.1.1 Zuwanderung nach dem Kolonialismus
- 3.1.2 Laïcité (Laizismus)
- 3.1.3 Islamophobie
- 3.2 Deutschland
- 3.2.1 Die Flüchtlings "krise"
- 3.2.2 Willkommenskultur: „Wir schaffen das!“
- 3.2.3 Islamophobie
- 3.1 Frankreich
- 4. Der Islamdiskurs auf Akteursebene
- 4.1 Die Medien
- 4.2 Frankreich
- 4.2.1 Front National
- 4.2.2 Conseil Français du Culte Musulman
- 4.3 Deutschland
- 4.3.1 Alternative für Deutschland
- 4.3.2 Pegida
- 4.3.3 Zentralrat der Muslime in Deutschland
- 4.3.4 Die Türkei
- 5. Der Islamdiskurs auf Textebene
- 5.1 Journalistische Darstellungsformen
- 5.1.1 Tatsachenbetonte (referierende) Darstellung
- 5.1.2 Meinungsbetonte Darstellung
- 5.2 Medienprofile und Korpusanalyse
- 5.2.1 Süddeutsche Zeitung
- 5.2.1.1 „Litanei der Ausgrenzung“
- 5.2.2 Le Monde
- 5.2.2.1 «La France sans les musulmans ne serait pas la France»
- 5.2.1 Süddeutsche Zeitung
- 5.1 Journalistische Darstellungsformen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung des Islam in der französischen und deutschen Online-Presse nach den Anschlägen in Paris und Brüssel im Jahr 2015 und 2016. Das Ziel der Analyse ist es, die sprachlichen Muster aufzudecken, die zur Konstruktion eines Islambildes in beiden Ländern beitragen. Die Arbeit untersucht, wie das kollektive Wissen der Gesellschaft über den Islam in der Presse vermittelt wird und welche linguistischen Mittel dafür eingesetzt werden.
- Der Einfluss der Kolonialgeschichte auf die Wahrnehmung des Islam in Frankreich
- Die Rolle von Laïcité (Laizismus) und Islamophobie in Frankreich
- Die Auswirkungen der Flüchtlingssituation und der Willkommenskultur auf die Debatte über den Islam in Deutschland
- Die Analyse von Medienprofilen und Korpusanalysen der Süddeutschen Zeitung und Le Monde
- Die Untersuchung von journalistischen Darstellungsformen und ihrer Auswirkungen auf die öffentliche Meinung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Massenmedien für die Konstruktion von Wissen und die Rolle des Islam in der öffentlichen Debatte nach den Anschlägen in Paris und Brüssel.
- Kapitel 2: Diskurslinguistik: Das theoretische Modell: Dieses Kapitel stellt das theoretische Modell der Diskurslinguistik vor und erklärt die drei Ebenen der Analyse (Diskursebene, Akteursebene und Textebene).
- Kapitel 3: Der Islamdiskurs auf Diskursebene: Dieses Kapitel beleuchtet den Islamdiskurs in Frankreich und Deutschland unter Berücksichtigung von relevanten historischen und aktuellen Entwicklungen.
- Kapitel 4: Der Islamdiskurs auf Akteursebene: In diesem Kapitel werden verschiedene Akteure des Islamdiskurses in Frankreich und Deutschland vorgestellt und ihre Positionen analysiert.
- Kapitel 5: Der Islamdiskurs auf Textebene: Dieses Kapitel untersucht die journalistische Darstellung des Islam in zwei ausgewählten Online-Quellen, der Süddeutschen Zeitung und Le Monde.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Islamdiskurs, Diskurslinguistik, Islamophobie, Laïcité, Willkommenskultur, Flüchtlingskrise, Medienanalyse, Korpusanalyse, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Frankreich, Deutschland, Paris, Brüssel.
- Quote paper
- Ina Krümpel (Author), 2016, Die Darstellung des Islam in der französischen und deutschen Online-Presse nach den Anschlägen in Paris und Brüssel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464179