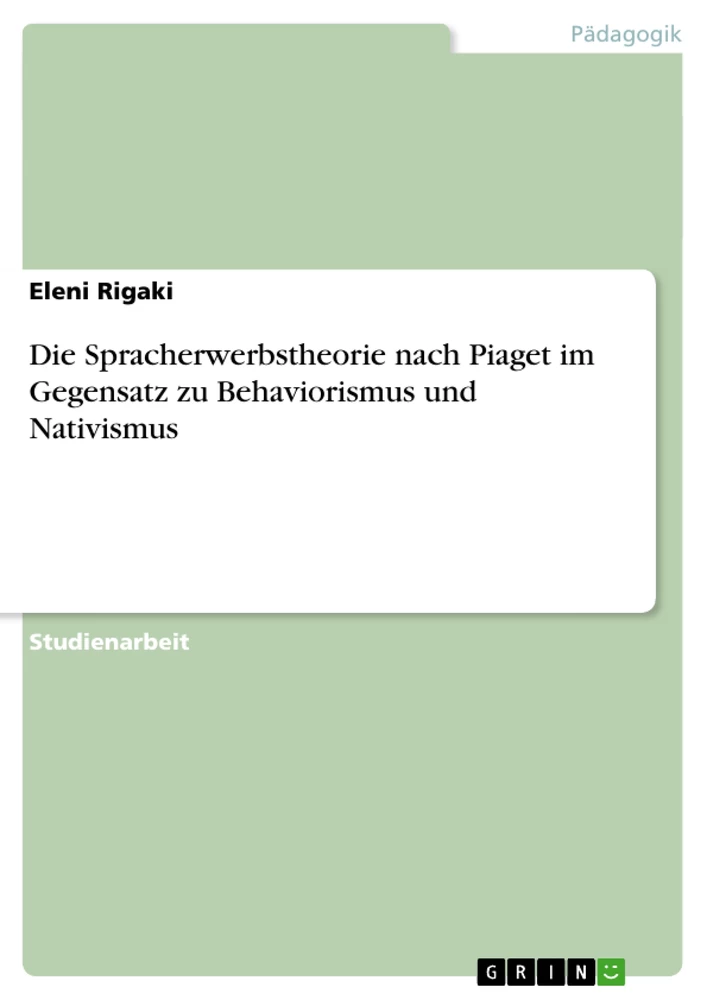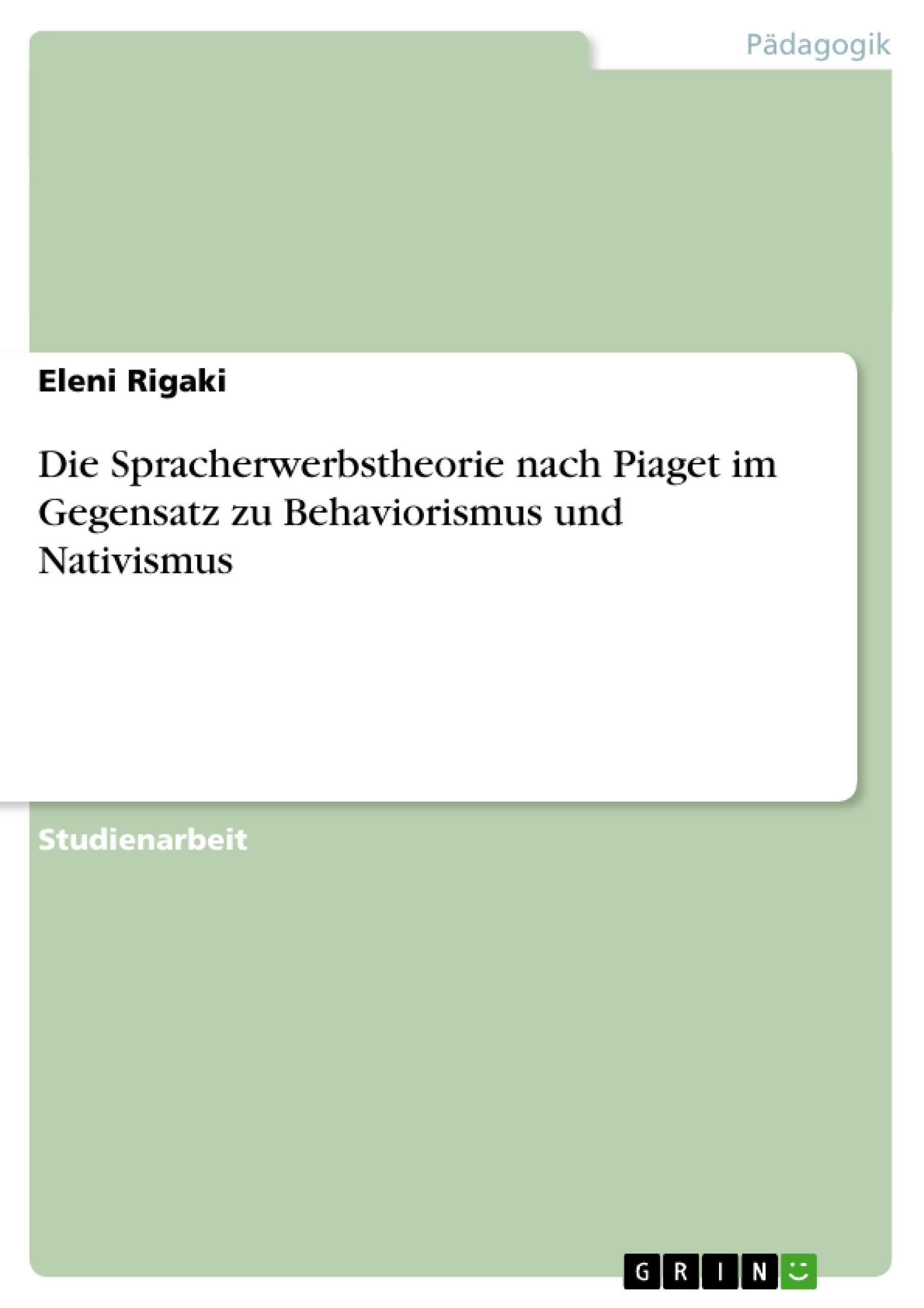Alle Lebewesen auf der Erde kommunizieren miteinander. Diese Kommunikation findet im unterschiedlichen Niveau und in einer sehr differenzierten Weise statt, so Hildebrand - Nilshon (vgl. Sucharowski 1996 19). Laut Keller 1990 (vgl. Sucharowski 1996 19f.) aber bleibt die Feststellung, dass kein anderes Lebewesen etwas dem System Sprache Vergleichbares wie der Mensch entwickelt hat. Manche nennen Sprache die größte Erfindung des Menschen genau deshalb, weil allein der Besitz der Sprache den Menschen vom Tier unterscheidet.
Wissenschaftler beschäftigten sich schon im 19. Jh., wie Wilhelm von Humboldt, mit der Frage, warum und wie man eine Sprache lernt. Um eine Antwort darauf zu geben, musste man zunächst eine andere Frage beantworten: Was ist Sprache? Die ersten Wissenschaftler, die sich damit befassten, waren die Philosophen und die Psychologen. Demzufolge kommen die ersten Theorien über die Herkunft und Bildung der Sprache bei den Menschen aus diesen Bereichen.
Heute redet man von Sprachwissenschaftlern, da Sprachwissenschaft sich bzw. Linguistik als selbstständige Wissenschaft seit der Mitte des 20. Jh. manifestiert hat. Im Vergleich zu den Psychologen, die darüber Daten sammeln, wie sich Sprache als Äußerung darstellt, suchen die Linguisten nach dem System, das die Sprache konstituiert, so Anderson 1998 (vgl. Sucharowski 1996 25ff.).
Demzufolge werden in der vorliegenden Arbeit die Möglichkeiten des Erstspracherwerbs nach Piaget und die biologischen Voraussetzungen, unter denen er realisierbar ist, dargestellt. Des Weiteren wird es auf zwei Theorien eingegangen, die der Theorie Piagets entgegentreten: auf Behaviorismus -Theorie, mit Skinner als ihrer wichtigste Vertreter und auf Nativismus -Universalgrammatik-Theorie, die Chomsky entwickelte .
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Funktion des Gehirns
- 2.1 Sprachlernvoraussetzungen beim Spracherwerb
- 2.1.1 Biologische Voraussetzungen
- 3. Theorie der kognitiven Entwicklung des Menschen nach Piaget
- 3.1 Grundprinzipien von Piagets Theorie
- 3.2 Phasen der Stufentheorie
- 4. Nature vs. Nurture
- 4.1 Skinner und Behaviorismus
- 4.2 Chomsky und Nativismus – Universalgrammatik
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theorie des Spracherwerbs nach Piaget im Vergleich zum Behaviorismus und Nativismus. Ziel ist es, Piagets Ansatz zu erläutern und seine zentralen Aspekte mit den gegensätzlichen Theorien von Skinner und Chomsky zu kontrastieren. Die biologischen Voraussetzungen des Spracherwerbs werden ebenfalls beleuchtet.
- Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und ihre Anwendung auf den Spracherwerb
- Vergleichende Analyse des Behaviorismus (Skinner) und des Nativismus (Chomsky)
- Die Rolle biologischer Faktoren im Spracherwerbsprozess
- Die Interaktion von Anlage und Umwelt beim Spracherwerb
- Der Einfluss kognitiver Entwicklung auf die Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in das Thema Spracherwerb ein und betont die einzigartige Fähigkeit des Menschen zur sprachlichen Kommunikation im Vergleich zu anderen Lebewesen. Sie skizziert die historische Entwicklung der Spracherwerbsforschung von philosophischen und psychologischen Anfängen bis zur Etablierung der Sprachwissenschaft als eigenständige Disziplin. Die Arbeit fokussiert auf Piagets Theorie und deren Gegenüberstellung zu Behaviorismus und Nativismus, wobei die biologischen Grundlagen des Spracherwerbs hervorgehoben werden.
2. Funktion des Gehirns: Dieses Kapitel beleuchtet die neurobiologischen Grundlagen des Spracherwerbs. Es beginnt mit einem Vergleich des menschlichen Gehirns mit dem von Tieren, wobei die komplexere Struktur und Entwicklung des menschlichen Gehirns hervorgehoben werden. Der Entwicklungsprozess des Gehirns, insbesondere die Reifung der neuronalen Verbindungen durch die Interaktion von genetischer Prädisposition und Umwelteinflüssen, wird detailliert beschrieben. Die Bedeutung des Gehirns als Organ für die Sprachverarbeitung und -produktion wird betont.
2.1 Sprachlernvoraussetzungen beim Spracherwerb: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die biologischen Voraussetzungen des Spracherwerbs. Die beeindruckende Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit der Kinder ihre Muttersprache erlernen, wird als Ausgangspunkt genommen. Die verschiedenen Bereiche des Gehirns und ihre Entwicklung im Zusammenhang mit dem Spracherwerb werden erläutert, insbesondere die anfängliche Dominanz der rechten und die spätere der linken Gehirnhälfte. Die Entwicklung von Wahrnehmung, motorischen Fähigkeiten und der ersten sprachlichen Äußerungen wird im Kontext der neuronalen Entwicklung beschrieben.
3. Theorie der kognitiven Entwicklung des Menschen nach Piaget: Dieses Kapitel präsentiert Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und ihre Relevanz für den Spracherwerb. Die Grundprinzipien von Piagets Theorie, wie Assimilation, Akkommodation und Äquilibration, werden erklärt und ihre Anwendung auf die sprachliche Entwicklung illustriert. Die verschiedenen Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget werden beschrieben und deren Einfluss auf den Spracherwerbsprozess dargelegt. Es wird erläutert, wie sich die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes mit zunehmendem Alter auf seine Sprachfähigkeiten auswirken.
4. Nature vs. Nurture: Dieses Kapitel setzt sich mit der Debatte um die relative Bedeutung von Anlage (Nature) und Umwelt (Nurture) beim Spracherwerb auseinander. Der Behaviorismus nach Skinner mit seinem Fokus auf Lernen durch Verstärkung und Konditionierung wird vorgestellt und im Gegensatz zu Chomskys Nativismus gesetzt. Chomskys Theorie der Universalgrammatik, die von einer angeborenen sprachlichen Kompetenz ausgeht, wird detailliert erläutert. Die Diskussion vergleicht die beiden Ansätze und zeigt deren Vor- und Nachteile auf.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Piaget, Behaviorismus, Nativismus, Universalgrammatik, kognitive Entwicklung, biologische Voraussetzungen, Gehirn, Sprache, Skinner, Chomsky.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Spracherwerb nach Piaget, Behaviorismus und Nativismus
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text untersucht die Theorie des Spracherwerbs nach Jean Piaget und vergleicht sie mit dem Behaviorismus (Skinner) und dem Nativismus (Chomsky). Er beleuchtet die Rolle biologischer Faktoren, die Interaktion von Anlage und Umwelt und den Einfluss der kognitiven Entwicklung auf die Sprachentwicklung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die behandelten Themen umfassen: Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und ihre Anwendung auf den Spracherwerb; eine vergleichende Analyse des Behaviorismus und des Nativismus; die Rolle biologischer Faktoren im Spracherwerb; die Interaktion von Anlage und Umwelt; und der Einfluss kognitiver Entwicklung auf die Sprachentwicklung. Der Text beinhaltet auch eine Einführung in die neurobiologischen Grundlagen des Spracherwerbs.
Welche Theorien werden verglichen?
Der Text vergleicht die Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget mit dem Behaviorismus von B.F. Skinner und dem Nativismus von Noam Chomsky. Der Schwerpunkt liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen zum Verständnis des Spracherwerbs: Lernen durch Verstärkung (Behaviorismus) vs. angeborene Sprachfähigkeit (Nativismus) im Vergleich zu Piagets kognitiver Entwicklungstheorie.
Welche Rolle spielt die Biologie im Spracherwerb laut diesem Text?
Der Text betont die Bedeutung biologischer Voraussetzungen für den Spracherwerb. Er beschreibt die neurobiologischen Grundlagen der Sprache, die Entwicklung des Gehirns und die Rolle spezifischer Hirnareale in der Sprachverarbeitung. Die beeindruckende Geschwindigkeit des Spracherwerbs bei Kindern wird als Hinweis auf biologische Prädispositionen interpretiert.
Wie erklärt Piaget den Spracherwerb?
Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung wird als relevant für den Spracherwerb dargestellt. Konzepte wie Assimilation, Akkommodation und Äquilibration werden erläutert und auf die sprachliche Entwicklung angewendet. Der Text beschreibt die verschiedenen Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget und deren Einfluss auf den Spracherwerbsprozess.
Was ist der Unterschied zwischen Behaviorismus und Nativismus?
Der Text kontrastiert den Behaviorismus (Skinner), der den Spracherwerb als Lernprozess durch Verstärkung und Konditionierung beschreibt, mit dem Nativismus (Chomsky), der von einer angeborenen Sprachfähigkeit (Universalgrammatik) ausgeht. Die Vor- und Nachteile beider Ansätze werden diskutiert.
Welche Kapitel beinhaltet der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Einführung, Funktion des Gehirns (inkl. Sprachlernvoraussetzungen), Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget, Nature vs. Nurture (Behaviorismus vs. Nativismus), und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Spracherwerb, Piaget, Behaviorismus, Nativismus, Universalgrammatik, kognitive Entwicklung, biologische Voraussetzungen, Gehirn, Sprache, Skinner, Chomsky.
- Quote paper
- Eleni Rigaki (Author), 2003, Die Spracherwerbstheorie nach Piaget im Gegensatz zu Behaviorismus und Nativismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46384