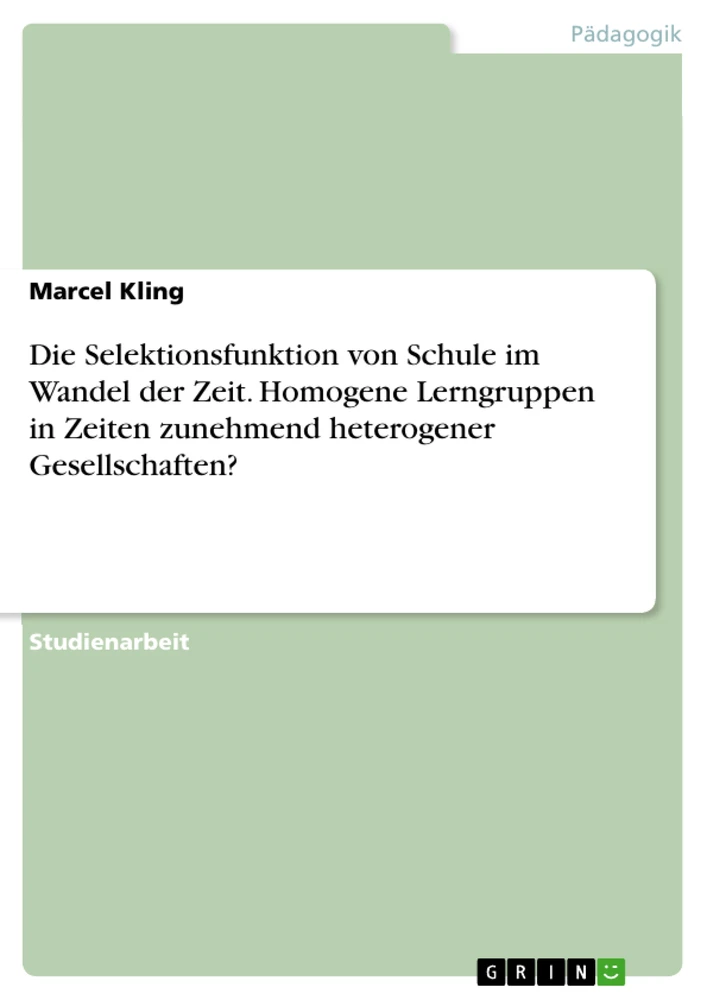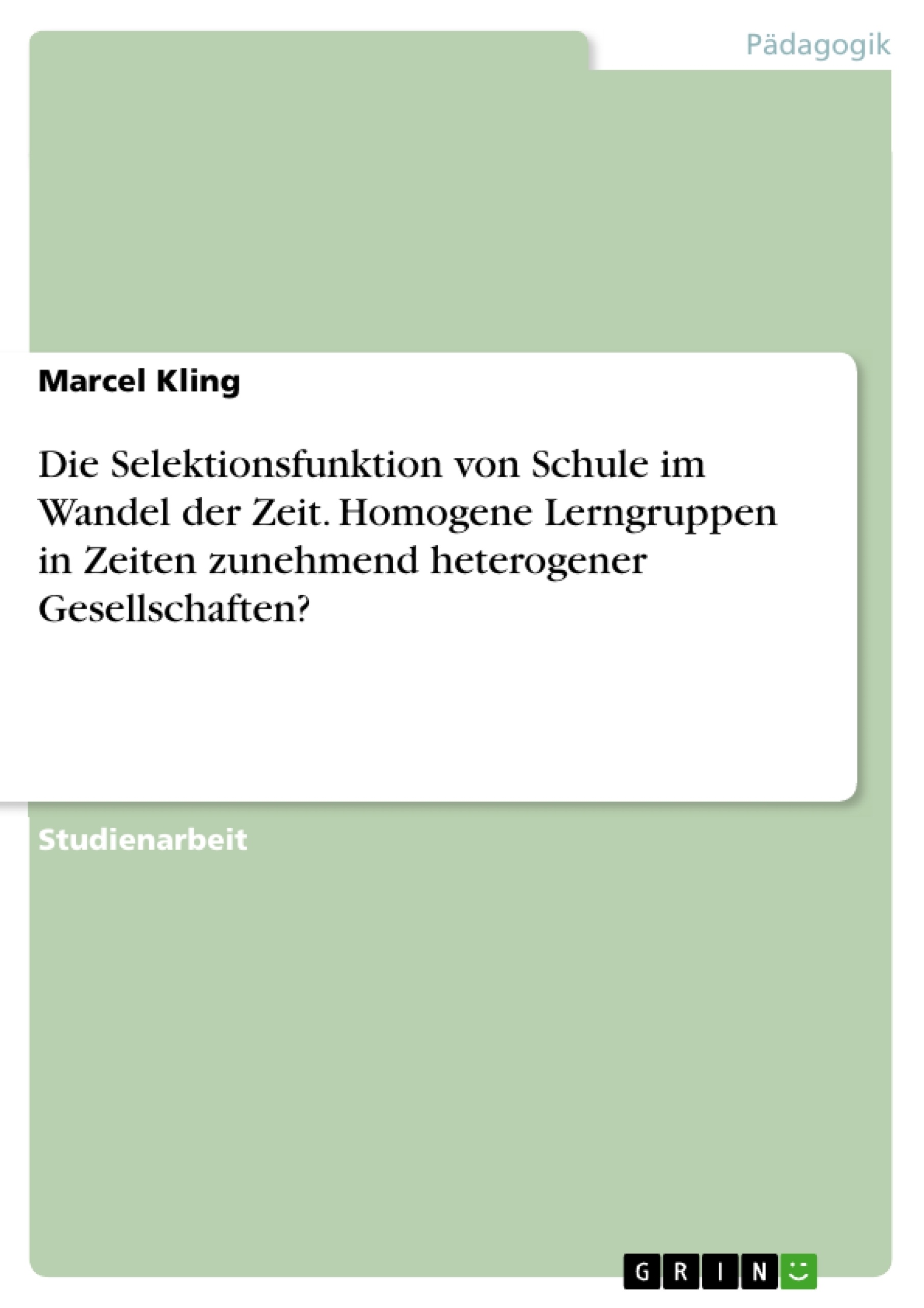Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob das deutsche Schulsystem mit seinen Selektionsmechanismen tatsächlich allen Schülern aus allen sozialen Schichten die gleichen Bildungschancen einräumt, so wie es nach dem im Grundgesetz verankerten Prinzip der Chancengleichheit eigentlich Standard sein müsste. Dieser Frage wurde nicht zuletzt durch den PISA-Schock 2000 große Bedeutung in der Forschung zuteil, sie hat zudem heute wohl größere Bedeutung denn je.
Zurecht wird hinterfragt, ob homogene Lerngruppen aufgrund der anwachsenden kulturellen und sozialen Heterogenität in der deutschen Gesellschaft noch zeitgemäß sind, während in vielen anderen Bereichen Integration eine immer bedeutsamere Position einnimmt. Man muss sich also fragen, ob schulische Selektion gleichzeitig soziale Segregation bedeutet und ob in Deutschland zu wenig Wert auf integratives Unterrichten gelegt wird. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema, seit 2000 hat sich Forschungslage stark verbessert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schulische, rechtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen
- 2.1 Gesellschaftliche Funktionen von Schule
- 2.2 Die Selektionsfunktion und ihre Mechanismen
- 2.3 Das Recht auf Chancengleichheit
- 2.4 Soziale Herkunft
- 3. Chancen und Risiken der Bildungsselektion
- 3.1 Zusammensetzung der Schülerschaft
- 3.2 Beurteilungen beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe
- 3.3 Die weiteren Aussichten ab Jahrgangsstufe 5
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob das deutsche Schulsystem mit seinen Selektionsmechanismen Chancengleichheit für Schüler aller sozialen Schichten gewährleistet. Der Fokus liegt auf der Vereinbarkeit von homogenen Lerngruppen mit der zunehmenden gesellschaftlichen Heterogenität und dem im Grundgesetz verankerten Prinzip der Chancengleichheit. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen sozialer Herkunft auf Bildungschancen und hinterfragt die Durchlässigkeit des Systems.
- Die gesellschaftlichen Funktionen von Schule, insbesondere die Selektionsfunktion.
- Der Einfluss sozialer Herkunft auf Bildungschancen.
- Die Selektionsmechanismen im deutschen Schulsystem und deren Auswirkungen.
- Die Vereinbarkeit von Selektion und Chancengleichheit.
- Die Durchlässigkeit des deutschen Schulsystems.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit von Selektionsmechanismen im deutschen Schulsystem mit dem Prinzip der Chancengleichheit. Sie betont die Bedeutung dieser Frage im Kontext des PISA-Schocks und der wachsenden gesellschaftlichen Heterogenität. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Begriffe, die im weiteren Verlauf erläutert werden.
2. Schulische, rechtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe. Es beschreibt die gesellschaftlichen Funktionen von Schule nach Fend (Qualifikation, Selektion/Allokation, Integration/Legitimation), wobei der Schwerpunkt auf der Selektions- und Allokationsfunktion liegt. Es beleuchtet den rechtlichen Rahmen der Chancengleichheit und definiert den Begriff der sozialen Herkunft. Das Kapitel legt die Basis für die spätere Analyse der Selektionsmechanismen.
3. Chancen und Risiken der Bildungsselektion: Dieses Kapitel analysiert die Chancen und Risiken der Bildungsselektion im deutschen Schulsystem. Es untersucht die Zusammensetzung der Schülerschaft, die Beurteilungsprozesse beim Übergang in die Sekundarstufe und die weiteren Aussichten der Schüler ab der Jahrgangsstufe 5. Hier werden empirische Studien herangezogen, um den Einfluss von Selektionsmechanismen auf Bildungschancen in verschiedenen sozialen Schichten zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Selektion zu Auf- und Abstiegen führt oder ob sie eher zu sozialer Ausgrenzung beiträgt.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungsselektion, sozialer Herkunft, Schulsystem, Selektionsmechanismen, homogene Lerngruppen, soziale Segregation, Integration, PISA-Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Bildungsselektion im deutschen Schulsystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob das deutsche Schulsystem mit seinen Selektionsmechanismen Chancengleichheit für Schüler aller sozialen Schichten gewährleistet. Der Fokus liegt auf der Vereinbarkeit von homogenen Lerngruppen mit der zunehmenden gesellschaftlichen Heterogenität und dem im Grundgesetz verankerten Prinzip der Chancengleichheit. Analysiert werden die Auswirkungen sozialer Herkunft auf Bildungschancen und die Durchlässigkeit des Systems.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesellschaftlichen Funktionen von Schule (insbesondere Selektion), den Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungschancen, die Selektionsmechanismen im deutschen Schulsystem und deren Auswirkungen, die Vereinbarkeit von Selektion und Chancengleichheit sowie die Durchlässigkeit des deutschen Schulsystems. Es werden empirische Studien herangezogen, um den Einfluss von Selektionsmechanismen auf Bildungschancen in verschiedenen sozialen Schichten zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Schulische, rechtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen, 3. Chancen und Risiken der Bildungsselektion und 4. Fazit. Kapitel 2 erläutert die gesellschaftlichen Funktionen von Schule (nach Fend), den rechtlichen Rahmen der Chancengleichheit und den Begriff der sozialen Herkunft. Kapitel 3 analysiert die Zusammensetzung der Schülerschaft, Beurteilungsprozesse beim Übergang in die Sekundarstufe und die weiteren Aussichten der Schüler ab der Jahrgangsstufe 5.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Chancengleichheit, Bildungsselektion, soziale Herkunft, Schulsystem, Selektionsmechanismen, homogene Lerngruppen, soziale Segregation, Integration und PISA-Studie.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist die Vereinbarkeit von Selektionsmechanismen im deutschen Schulsystem mit dem Prinzip der Chancengleichheit gegeben?
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Es werden theoretische Konzepte erläutert und empirische Studien herangezogen, um die Auswirkungen der Selektion auf Bildungschancen zu untersuchen.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen (grob)?
(Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da die Zusammenfassung des vierten Kapitels ("Fazit") fehlt.)
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für alle relevant, die sich mit dem deutschen Schulsystem, Bildungsgerechtigkeit und sozialer Ungleichheit auseinandersetzen, insbesondere für Wissenschaftler, Pädagogen und alle Interessierten an bildungspolitischen Fragen.
- Quote paper
- Marcel Kling (Author), 2015, Die Selektionsfunktion von Schule im Wandel der Zeit. Homogene Lerngruppen in Zeiten zunehmend heterogener Gesellschaften?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463745