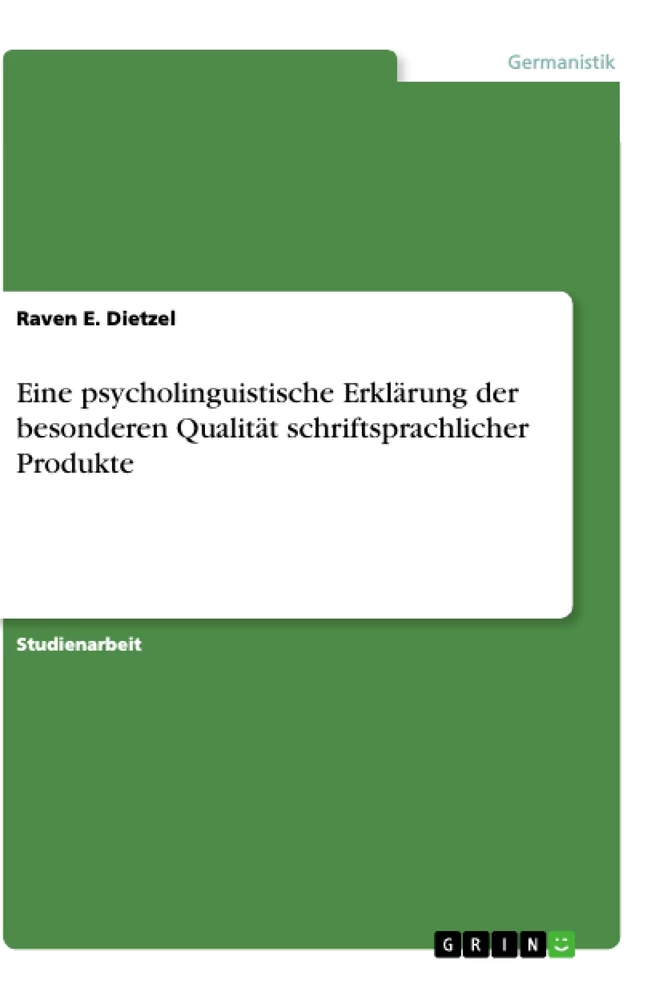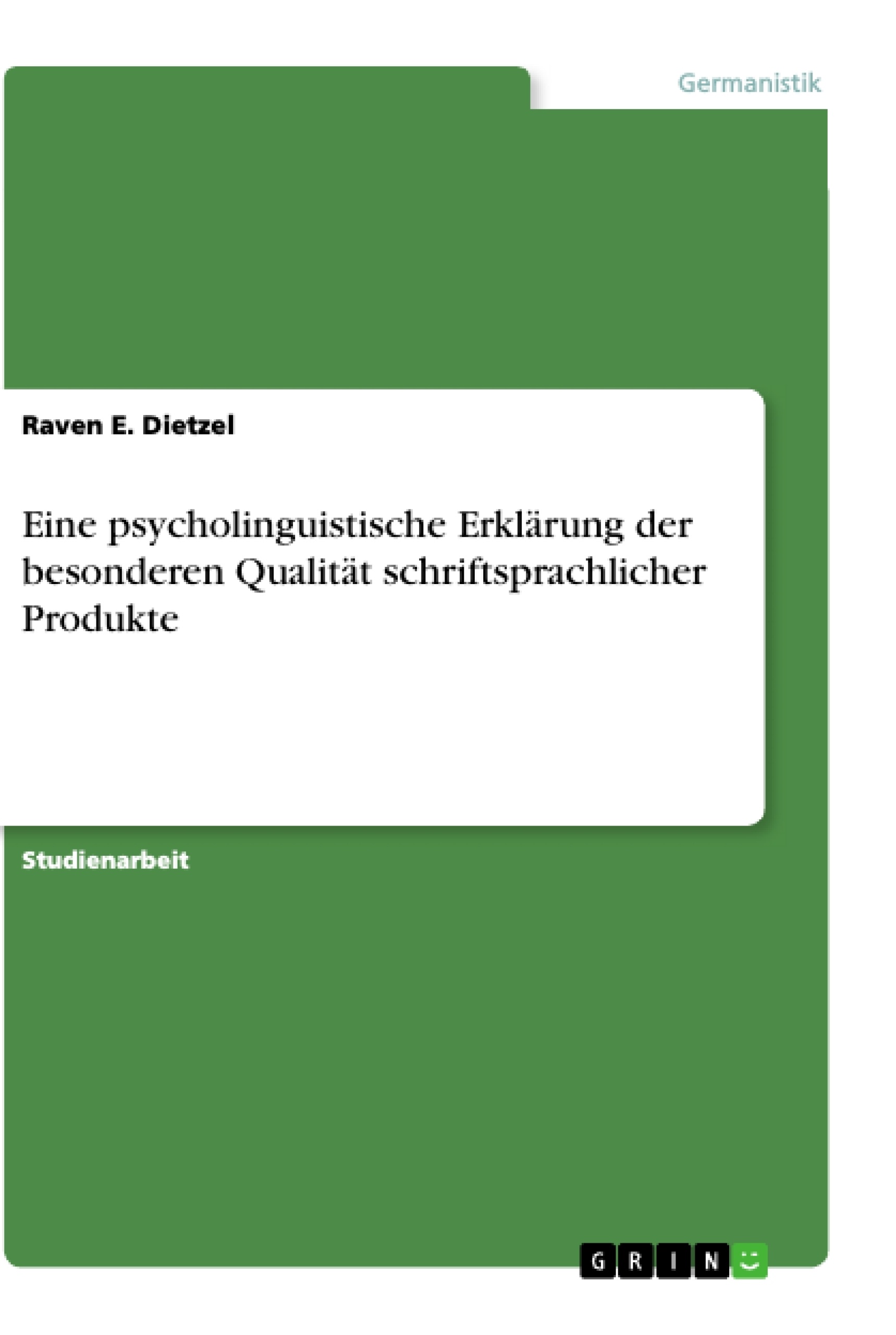Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit schriftlicher Sprachproduktion in Bezug auf diejenigen Aspekte, die sie wesentlich von der mündlichen unterscheiden. Das Ziel ist, die üblicherweise höhere Qualität schriftsprachlicher Produkte zu erklären, und dabei unter Einbezug der klassischen Modelle nach Morton und Levelt ein eigenes Modell zur Erklärung des Schriftsprachlichkeitüberlegenheitseffekts zu entwickeln.
Während in der Psycholinguistik Lesen und Hören in einem einander ähnlichen Umfang thematisiert werden, findet sich in Bezug auf die Sprachproduktion ein starkes Ungleichgewicht, das heißt eine Konzentration der Forschung auf das Sprechen, und darüber die deutliche Vernachlässigung des Schreibens. Ein Grund dafür mag lange Zeit gewesen sein, dass die schriftliche Sprachproduktion sich vom Sprechen, Hören und auch Lesen insofern unterschied, dass sie gesellschaftlich eigentlich keine Kernkompetenz darstellte. Die grundlegende Fähigkeit des Schreibens wurde zwar allgemein vermittelt, eine regelmäßigen Ausübung fand sich allerdings auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt, vor allem solche mit akademischem Hintergrund, entweder im universitären Kontext selbst, oder außerhalb davon, indem akademisch Ausgebildete ihre erworbenen Fähigkeiten entgeltlich zur Verfügung stellten. Zur Form der Sprachproduktion galt außerdem, dass die schriftliche im Gegensatz zur dialogischen mündlichen üblicherweise nur monologisch auftrat.
Durch die rasante Entwicklung neuer Medien insbesondere im vergangenen Jahrzehnt, und die damit einhergehende Etablierung von Schriftlichkeit in Alltagssituationen und -kommunikation darf diese Einschätzung allerdings als überholt gesehen werden. Ob als Kurznachrichten an Einzelpersonen und spezifische oder unspezifische Personengruppen, in Form eingeschränkt oder öffentlich zugänglicher Kommentare zu jedweden Inhalten, oder als eigenständiges Postulat – Schreiben ist für die breite Gesellschaft inzwischen längst selbstverständliche Ausdrucksform. Und obwohl die technischen Möglichkeiten sie überhaupt nicht mehr voraussetzen – man denke zum Beispiel an unaufwendig versendbare Sprachnachrichten, oder an Informationsvideos, wie es sie auf vielen Internetseiten gibt – hält der Großteil der Menschen an der eigentlich umständlichen Schriftlichkeit fest. Der Grund dafür ist, dass sie ihnen Ausdrucksmöglichkeiten bietet, die mündlich nicht zur Verfügung stehen. Aber warum ist das so?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagenklärung
- Das Vier-Phasen-Modell nach Levelt
- Das Logogenmodell nach Morton
- Innere Lexika
- Kognitive Instanzen in der Sprachproduktion
- Das Arbeitsgedächtnis
- Zentrale Kontrolle
- Das systemische Verhältnis von Sprechen und Schreiben
- Schreiben und Sprechen im kritischen Vergleich
- Pragmatik
- Inhaltsvalidität
- Komplexität
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der schriftlichen Sprachproduktion und beleuchtet die Unterschiede zur mündlichen Sprache. Das Ziel ist es, die spezifischen Eigenschaften und die Qualität schriftsprachlicher Produkte zu erklären.
- Psycholinguistische Grundlagen der Sprachproduktion
- Die Rolle des Arbeitsgedächtnisses bei der Sprachproduktion
- Systemische Eigenschaften der schriftlichen Sprachproduktion im Vergleich zur mündlichen Sprache
- Formale und qualitative Unterschiede zwischen mündlichen und schriftlichen Sprachprodukten
- Außersprachliche Aspekte wie Sprechkontext, Adressaten, Planung und Komplexität der Äußerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und beleuchtet die traditionelle Vernachlässigung der schriftlichen Sprachproduktion in der Psycholinguistik. Im Anschluss werden wichtige Grundlagen der Sprachproduktion erläutert, wobei das Vier-Phasen-Modell nach Levelt und das Logogenmodell nach Morton vorgestellt werden. Außerdem wird die Bedeutung der inneren Lexika für die Sprachproduktion betont. Der Fokus liegt auf den kognitiven Instanzen, insbesondere auf dem Arbeitsgedächtnis und der zentralen Kontrolle, die eine entscheidende Rolle in der Sprachproduktion spielen.
Die Arbeit geht dann auf das systemische Verhältnis von Sprechen und Schreiben ein und analysiert Unterschiede zwischen diesen beiden Sprachformen im Hinblick auf pragmatische Aspekte, Inhaltsvalidität und Komplexität.
Schlüsselwörter
Schriftliche Sprachproduktion, Psycholinguistik, Sprachproduktion, Sprachverarbeitung, Vier-Phasen-Modell, Levelt, Logogenmodell, Morton, Arbeitsgedächtnis, Zentrale Kontrolle, Pragmatik, Inhaltsvalidität, Komplexität.
- Quote paper
- Raven E. Dietzel (Author), 2017, Eine psycholinguistische Erklärung der besonderen Qualität schriftsprachlicher Produkte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463595