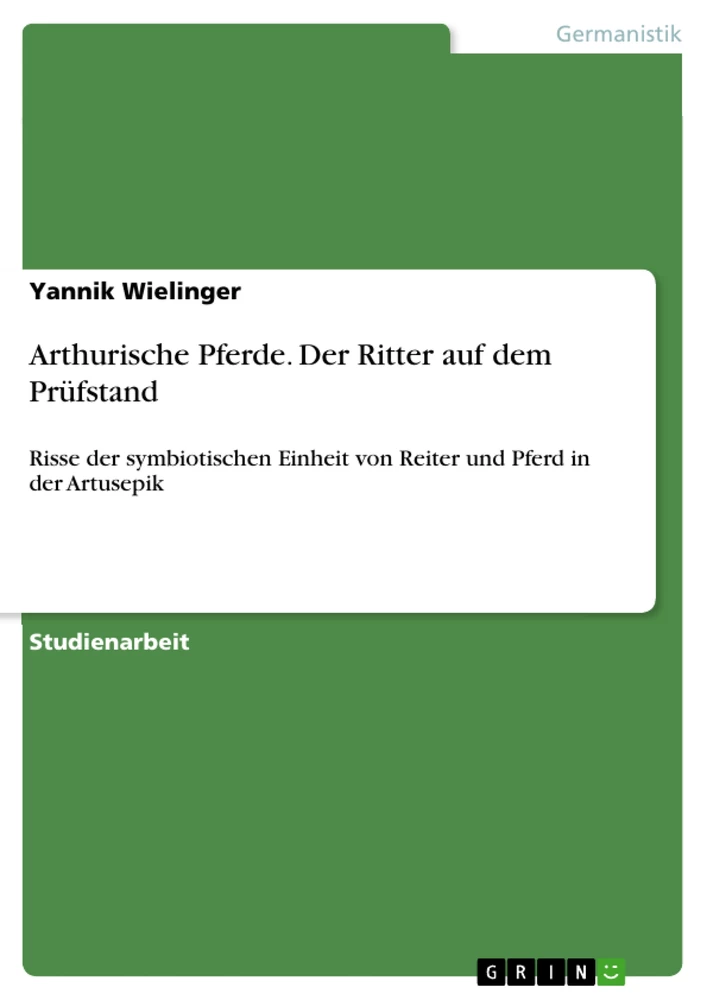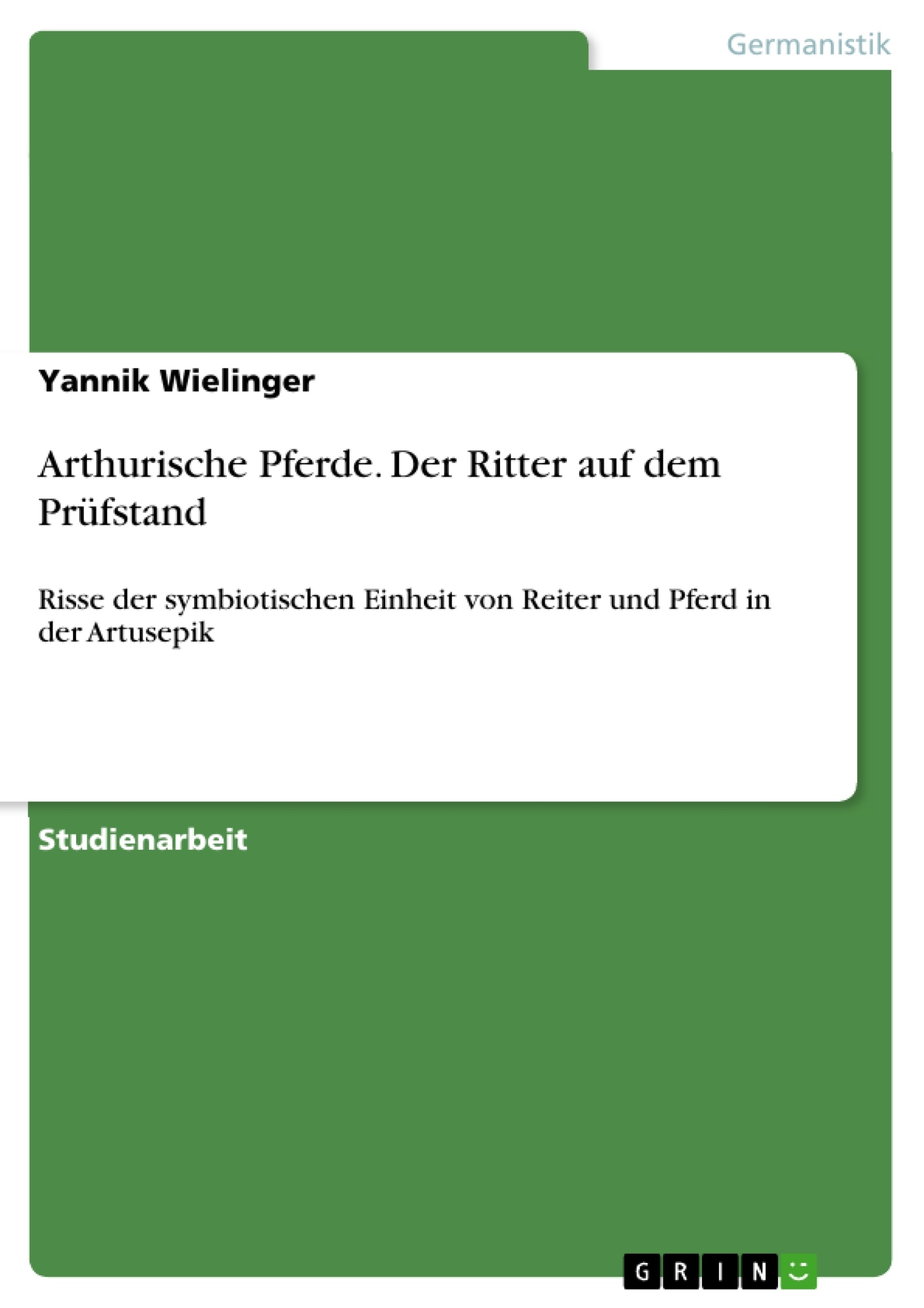Im Fokus dieser Arbeit werden König Artus' Tafelritter stehen. Die mittelalterliche Artusepik erzählt die Geschichte von mutigen Helden und ritterlichem Verhalten. Auf dem Weg ihrer Entwicklung werden die Ritter der Tafelrunde dabei immer wieder vor Probleme gestellt, deren souveräne Lösung ein gesteigertes Ansehen zur Folge haben wird und der charakterlichen
Weiterbildung dient. Allerdings können diese Aufgaben situationsbedingt schwierig zu erledigen sein, wenn die Ritter in einem ungünstigen Moment mit ihnen konfrontiert werden.
In dieser Arbeit soll der Fokus auf die Rolle des Pferdes als signifikante und identitätsstiftende Einheit gelegt werden. In diesem Zusammenhang soll daher der Frage nachgegangen werden, wie ein Ritter handelt, wenn die Einheit aus Ritter und Pferd nicht eingesetzt werden kann. Dafür werden exemplarisch verschiedene Werke aus der Artusepik untersucht, um ein möglichst breites Spektrum an Untersuchungsmöglichkeiten zu bieten. Dabei soll auch die These überprüft werden, ob ein Ritter ohne Pferd schwach und überfordert ist.[...] Es folgt eine Zusammenstellung der Entwicklung von Rittern und Pferden im Mittelalter und deren Auseinandersetzung zwischen der symbiotischen Beziehung und der Tragik des Pferdeverlustes. Danach werden verschiedene Textstellen, in denen die Ritter Situationen ohne ihr Pferd lösen müssen, analysiert. Dabei werden verschiedene Arten des Pferdeverlustes festgestellt und die individuellen Strategien untersucht. Zu vorgefundenen Positionen in der Sekundärliteratur wird Stellung genommen und versucht, diese einzuordnen. Danach findet im Fazit die Bewertung der Analyse statt, in der auch die Fragestellung beantwortet und die These überprüft werden.
König Artus – kaum eine andere Sagengestalt wird mit so vielen Mythen in Verbindung gebracht wie er. Dabei spielt er in den Werken, die zur Artusepik zählen, selten eine große Rolle. Es sind Erzählungen über die Ritter, die würdig genug waren, an seiner legendären Tafelrunde Platz zu nehmen. Seine Burg Camelot oder der Ort Avalon stehen für die in der Literatur besonders idealisierte höfische Welt und Ritterzeit mit dem nahezu perfekten Herrscher Artus. Daneben ist natürlich auch noch Artus' Schwert Excalibur zu nennen, welches wiederum unweigerlich mit dem legendären Zauberer Merlin in Verbindung steht. Der Stoff dieser Sage hat eine lange Tradition in Europa und wurde auf viele verschiedene Weisen adaptiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die mittelalterliche Artus-Epik
- 3. Ritter und Pferde
- 3.1 Symbiose
- 3.2 Pferdeverlust
- 4. Textstellen
- 4.1 Erec und der Zwerg
- 4.2 Iwein und Kalogrenant
- 4.3 Gawan und Gringuljete
- 4.4 Parzival - wild und unerfahren
- 4.5 Tristan, der Drache und der herrliche Ritter zu Pferd
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Pferdes in der mittelalterlichen Artusepik und beleuchtet, wie Ritter mit Situationen umgehen, in denen die symbiotische Einheit von Reiter und Pferd gestört ist. Die zentrale Fragestellung lautet: Wie handelt ein Ritter, wenn er sein Pferd nicht einsetzen kann? Die Arbeit analysiert exemplarisch verschiedene Texte, um diese Frage zu beantworten und die These zu überprüfen, ob ein Ritter ohne Pferd schwach und überfordert ist.
- Die symbiotische Beziehung zwischen Ritter und Pferd
- Die Folgen des Pferdeverlustes für den Ritter
- Strategien der Ritter im Umgang mit dem Pferdeverlust
- Die Darstellung ritterlicher Tugenden und deren Herausforderungen
- Vergleichende Analyse verschiedener Artusromane
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Handeln von Rittern bei Verlust ihres Pferdes in der mittelalterlichen Artusepik vor. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse verschiedener Artusromane umfasst, um ein breites Spektrum an Situationen zu untersuchen. Die These, dass ein Ritter ohne Pferd schwach und überfordert ist, soll im Verlauf der Arbeit überprüft werden. Die Einleitung gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
2. Die mittelalterlichen Artusromane: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des mittelalterlichen Artusromans, beginnend mit Chrétien de Troyes und dessen Einfluss auf die spätere Rezeption des Stoffes. Es werden die wichtigsten Autoren und ihre Adaptionen des Artusstoffes im mittelhochdeutschen Raum erwähnt (Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Strassburg). Das Kapitel analysiert die idealisierte und romantische Darstellung der höfischen Welt in den Artusromanen und deren Relevanz für das damalige Publikum. Die Diskussion über die Auftragsarbeiten und die Zielgruppe (Herrscher) erweitert den Kontext der Romane.
3. Ritter und Pferde: Dieses Kapitel analysiert die komplexe Beziehung zwischen Rittern und ihren Pferden im mittelalterlichen Kontext. Es wird auf die Symbiose zwischen Reiter und Pferd eingegangen und erläutert, wie diese Beziehung zur Identität des Ritters beitrug. Darüber hinaus wird der Pferdeverlust als zentrales Problem thematisiert und die verschiedenen Gründe und Auswirkungen auf die Ritter untersucht. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Textanalyse, indem es die Bedeutung des Pferdes als Teil der ritterlichen Identität und Ausrüstung betont.
4. Textstellen: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse ausgewählter Textstellen aus verschiedenen Artusromanen. Es untersucht verschiedene Szenarien des Pferdeverlustes und die individuellen Strategien der Ritter im Umgang mit dieser Situation. Die Analyse der Texte soll die These der Arbeit überprüfen, indem sie die Handlungsweisen der Ritter im Kontext des Pferdeverlustes beleuchtet. Der Vergleich verschiedener Romanfiguren und Situationen trägt zum Verständnis der komplexen Beziehung zwischen Ritter, Pferd und gesellschaftlichen Erwartungen bei.
Schlüsselwörter
Artusepik, Ritter, Pferd, Symbiose, Pferdeverlust, Mittelalter, höfische Gesellschaft, Identität, Textstellenanalyse, Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, âventiure.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Artusepik und die Rolle des Pferdes
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Pferdes in der mittelalterlichen Artusepik und analysiert, wie Ritter mit Situationen umgehen, in denen die symbiotische Beziehung zwischen Reiter und Pferd gestört ist, insbesondere durch Pferdeverlust. Die zentrale Frage lautet: Wie handelt ein Ritter, wenn er sein Pferd nicht einsetzen kann?
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch verschiedene Textstellen aus mittelhochdeutschen Artusromanen, darunter Beispiele von Erec und dem Zwerg, Iwein und Kalogrenant, Gawan und Gringuljete, Parzival und Tristan. Der Fokus liegt auf Szenarien, in denen der Ritter seinen treuen Gefährten, das Pferd, verliert.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die symbiotische Beziehung zwischen Ritter und Pferd, die Folgen des Pferdeverlustes für den Ritter, die Strategien der Ritter im Umgang mit dem Verlust, die Darstellung ritterlicher Tugenden im Kontext des Pferdeverlustes und bietet eine vergleichende Analyse verschiedener Artusromane.
Welche Autoren werden berücksichtigt?
Die Arbeit erwähnt und analysiert Werke von wichtigen Autoren der mittelhochdeutschen Artusepik, wie Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Strassburg und Chrétien de Troyes, um ein breites Spektrum an literarischen Darstellungen zu erfassen.
Welche These wird aufgestellt und überprüft?
Die Arbeit überprüft die These, dass ein Ritter ohne Pferd schwach und überfordert ist. Die Analyse der Textstellen soll diese These bestätigen oder widerlegen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur mittelalterlichen Artus-Epik, ein Kapitel zu Rittern und Pferden, ein Kapitel mit der detaillierten Textstellenanalyse und ein Fazit. Der Aufbau ist logisch und systematisch, um die Forschungsfrage schrittweise zu beantworten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Artusepik, Ritter, Pferd, Symbiose, Pferdeverlust, Mittelalter, höfische Gesellschaft, Identität, Textstellenanalyse, Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, âventiure.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Textstellenanalyse verschiedener Artusromane, um die Forschungsfrage zu beantworten und die These zu überprüfen. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung des Pferdeverlusts und die Reaktionen der Ritter darauf.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die mittelalterliche Literatur, die Artusepik und die Rolle des Pferdes in der höfischen Gesellschaft interessiert. Sie eignet sich für Studenten und Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen können dem vollständigen Text der Arbeit entnommen werden (hier nicht vollständig wiedergegeben).
- Quote paper
- Yannik Wielinger (Author), 2018, Arthurische Pferde. Der Ritter auf dem Prüfstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463372