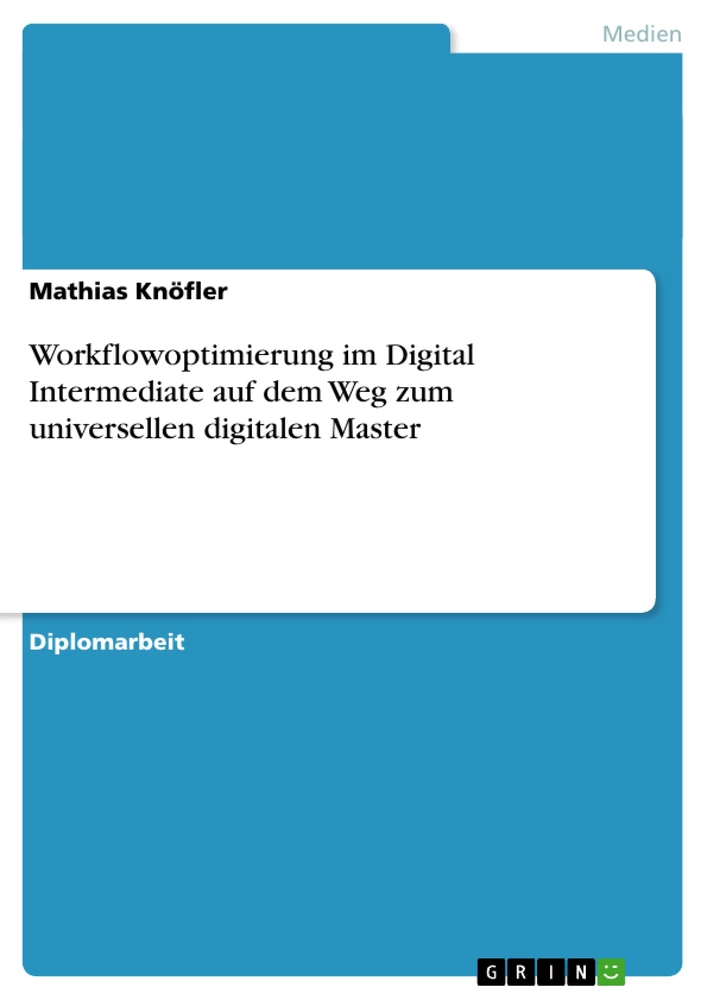Noch vor wenigen Jahren wurde die Postproduktion von Kinofilme fast ausschließlich im Kopierwerk realisiert. Der traditionelle Kopierwerksprozess umfasst dabei wichtige Aufgaben, wie Schnitt, optische Effektebearbeitung und Farbgebung. Mit steigender Rechnerleistung und Speicherkapazität wird es jedoch Filmproduzenten möglich, ganze Filme zu digitalisieren und Arbeitsschritte, die vorher ausschließlich dem Kopierwerk vorbehalten waren, in der digitalen Ebene zu vollziehen.
Der Begriff Digital Intermediate bezieht sich auf einen Prozess, bei dem ein Film in voller Länge gescannt, digital bearbeitet und wieder auf Film ausbelichtet wird. Während das für die einen eine ernste Bedrohung ihrer Geschäftsgrundlage bedeutet, stellt es für die anderen eine Revolution in der Filmproduktion dar. Es ergaben sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, sowohl kreative, als auch ökonomische. Was vorher schon lange im Video- und Broadcastbereich möglich war, konnte jetzt für den „großen Bruder“ Kino adaptiert werden. Digital Intermediate stellt jedoch massive Anforderungen an Technik und Projektmanagement.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Lösungsansätze für Postproduzenten existieren, ein Digital Intermediate zu realisieren und welche Möglichkeiten es gibt, damit verbundene Prozesse zu optimieren, um am Ende ein universelles Master zu erhalten, von dem alle erdenklichen Distributionsformate abgeleitet werden können. Im theoretischen Teil der Diplomarbeit sollen zunächst Grundlagen des Filmmediums und der traditionellen Filmverarbeitung behandelt werden, technische Grundlagen und Bestandteile des Digital Intermediate Prozesses vorgestellt und ihre Funktionsweisen erläutert werden. Ziel im praktischen Teil ist es, Infrastrukturen zu analysieren und hinsichtlich Qualität, Effektivität und Aufwand zu vergleichen, sowie die Teilprozesse und deren Zusammenspiel im Digital Intermediate Prozess zu erläutern und Optimierungsansätze zu geben. Welche Systemanforderungen bestehen bei der Realisierung eines 2K-Workflows? Wie kann man bestehende Infrastrukturen nutzen? Welcher Workflow ist für welche Projektanforderung angemessen? Fragen, die der Autor im Laufe der Arbeit beantworten wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DAS MEDIUM FILM
- 2.1. Entstehung
- 2.2. Photographische Grundlagen
- 2.2.1. Filmschwärzung
- 2.2.2. Entwicklung
- 2.2.3. Negativ-Positiv-Verfahren und Umkehrverfahren
- 2.2.4. Farbfilm
- 2.3. Filmformate
- 2.3.1. Filmabmessungen
- 2.3.2. Perforation und Filmkennzeichnung
- 2.3.3. Bildfeldgrößen
- 2.4. Filmeigenschaften
- 2.4.1. Photometrische Größen
- 2.4.2. Dichtekennlinie und Gradation
- 2.4.3. Lichtempfindlichkeit und Filmkorn
- 2.4.4. Auflösungsvermögen
- 3. KOPIERWERKSPROZESSE
- 3.1. Erstellung der Musterkopie
- 3.1.1. Entwicklungsverfahren
- 3.1.2. Lichtbestimmung
- 3.1.3. Kopierung
- 3.2. Erstellung von Massenkopien
- 3.2.1. Negativschnitt
- 3.2.2. Massenkopierung
- 3.2.3. Optische Effekte
- 4. EINFÜHRUNG IN DEN DIGITAL INTERMEDIATE PROZESS
- 4.1. Entwicklung des Digital Intermediate Prozesses
- 4.2. Definition Digital Intermediate
- 4.3. Das digitale Labor
- 4.4. Vorteile eines Digital Intermediates
- 4.4.1. Qualität
- 4.4.2. Onlineschnitt
- 4.4.3. Effekte und Titel
- 4.4.4. Digitale Farbgebung
- 4.4.5. Restauration
- 4.4.6. Mastering und Distribution
- 4.4.7. Marketing
- 4.4.8. Fazit
- 5. QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN EIN DIGITAL INTERMEDIATE
- 5.1. Bildauflösung
- 5.2. Dynamikumfang
- 5.3. Farbauflösung
- 5.4. Dateiformate
- 5.5. Kalibrierung und Bildbewertung
- 5.5.1. Kalibrierung der Produktionskette
- 5.5.2. Monitorkalibrierung
- 6. EINZELKOMPONENTEN DER DI-PRODUKTIONSKETTE
- 6.1. Schnittstellen und Übertragungswege
- 6.1.1. HD-SDI
- 6.1.2. HSDL
- 6.1.3. HiPPI und GSN
- 6.1.4. LVDS
- 6.1.5. Ethernet
- 6.1.6. Fibre Channel
- 6.2. Filmabtaster
- 6.2.1. Samplingfrequenz und Abtastgeschwindigkeit
- 6.2.2. CRT-Abtastung
- 6.2.3. CCD-Abtastung
- 6.2.4. CMOS-Abtastung
- 6.3. Hardware Farbkorrektur- und Gradationssysteme
- 6.4. Bildspeicherung
- 6.4.1. Festspeicher
- 6.4.1.1. DAS Direct Attached Storage
- 6.4.1.2. NAS Network Attached Storage
- 6.4.1.3. SAN Storage Area Network
- 6.4.2. DDR Digital Disk Recorder
- 6.4.3. DVTR - Digital Video Tape Recorder
- 6.4.3.1. D6
- 6.4.3.2. HD-D5
- 6.4.3.3. HDCAM
- 6.4.3.4. HDCAM SR
- 6.5. Bildbearbeitungssysteme
- 6.5.1. Onlineschnitt- und Finishingsysteme
- 6.5.1.1. Autodesk Fire und Smoke
- 6.5.1.2. Quantel iQ
- 6.5.1.3. DVS Clipster 2.0
- 6.5.2. Compositing- und VFX-Systeme
- 6.5.2.1. Autodesk Inferno und Flame
- 6.5.2.2. Apple Shake und Adobe After Effects
- 6.5.3. Gradingsysteme
- 6.5.3.1. da Vinci Resolve
- 6.5.3.2. Autodesk Lustre
- 6.6. Filmbelichter
- 6.6.1. CRT-Belichter
- 6.6.2. Laserbelichter
- 7. INFRASTRUKTUREN UND WORKFLOWS
- 7.1. HD-SDI-Infrastruktur
- 7.1.1. Aufbau
- 7.1.2. Arbeitsprozesse
- 7.2. SAN-Infrastruktur
- 7.2.1. Aufbau
- 7.2.2. Arbeitsprozesse
- 7.3. Workflowvergleich
- 7.3.1. Qualität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Optimierung von Workflows im Digital Intermediate-Prozess, der die digitale Verarbeitung von Kinofilmen ermöglicht. Ziel ist es, die Entstehung eines universellen digitalen Masters zu ermöglichen, der für diverse Distributionsversionen genutzt werden kann. Dabei werden die Vorteile des Digital Intermediate im Vergleich zum klassischen Kopierwerk beleuchtet und die Qualitätsanforderungen sowie technische Komponenten des Prozesses erläutert.
- Entwicklung und Definition des Digital Intermediate Prozesses
- Vorteile des Digital Intermediate im Vergleich zum Kopierwerk
- Qualitätsanforderungen an ein Digital Intermediate
- Analyse von Einzelkomponenten der DI-Produktionskette
- Vergleich verschiedener Workflows hinsichtlich Qualität, Effektivität und Aufwand
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Digital Intermediate-Prozesses für die Filmproduktion heraus und beschreibt den Aufbau der Diplomarbeit.
- Kapitel 2: Das Medium Film
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Mediums Film und erläutert die photographischen Grundlagen der Filmproduktion. Es befasst sich mit Filmformaten und Filmeigenschaften.
- Kapitel 3: Kopierwerksprozesse
Hier werden die traditionellen Kopierwerksprozesse der Filmproduktion beschrieben. Es werden die Schritte der Muster- und Massenkopienerstellung sowie der Einsatz von optischen Effekten erklärt.
- Kapitel 4: Einführung in den Digital Intermediate Prozess
Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung des Digital Intermediate-Prozesses nach und definiert den Begriff. Es erläutert die Vorteile eines digitalen Labors und die Vorzüge des Digital Intermediate im Vergleich zum Kopierwerk.
- Kapitel 5: Qualitätsanforderungen an ein Digital Intermediate
Hier werden die technischen Anforderungen an ein Digital Intermediate bezüglich Bildauflösung, Dynamikumfang, Farbauflösung und Dateiformaten dargestellt. Das Kapitel befasst sich zudem mit der Kalibrierung und Bildbewertung innerhalb der Produktionskette.
- Kapitel 6: Einzelkomponenten der DI-Produktionskette
Dieses Kapitel analysiert die einzelnen Komponenten des Digital Intermediate-Prozesses, darunter Schnittstellen und Übertragungswege, Filmabtaster, Hardware Farbkorrektur- und Gradationssysteme, Bildspeicherung und Bildbearbeitungssysteme.
- Kapitel 7: Infrastrukturen und Workflows
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Infrastrukturen und Workflows des Digital Intermediate-Prozesses. Es werden HD-SDI- und SAN-Infrastrukturen sowie verschiedene Workflows im Hinblick auf Qualität, Effektivität und Aufwand verglichen.
Schlüsselwörter
Digital Intermediate, Workflowoptimierung, Filmproduktion, Kopierwerk, Postproduktion, Kinofilm, Qualität, Effektivität, Aufwand, HD-SDI, SAN, Filmabtaster, Farbkorrektur, Bildspeicherung, Bildbearbeitung, Mastering, Distribution
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Prozess „Digital Intermediate“ (DI)?
Digital Intermediate bezeichnet einen Workflow, bei dem ein auf Film gedrehter Kinofilm komplett gescannt, digital bearbeitet (Schnitt, Effekte, Farbe) und anschließend wieder auf Film ausbelichtet wird.
Welche Vorteile bietet DI gegenüber der traditionellen Kopierwerksarbeit?
Vorteile sind die enorme kreative Freiheit bei der digitalen Farbgebung, einfachere Integration von visuellen Effekten, Onlineschnitt-Möglichkeiten und die Erstellung eines universellen digitalen Masters.
Was ist ein „universelles digitales Master“?
Es ist eine hochwertige digitale Ausgangsdatei, von der alle benötigten Distributionsformate – vom Kinofilm über Blu-ray bis hin zu Streaming-Versionen – verlustfrei abgeleitet werden können.
Welche technischen Anforderungen bestehen an einen 2K-Workflow?
Ein solcher Workflow erfordert hohe Rechnerleistung, spezialisierte Filmabtaster (Scanner), kalibrierte Monitore und massive Speicherkapazitäten (z.B. SAN-Infrastrukturen).
Wie unterscheiden sich Filmabtaster (Scanner) in der DI-Kette?
Es gibt verschiedene Technologien wie CRT-Abtastung, CCD-Abtastung und CMOS-Abtastung, die sich in Samplingfrequenz, Geschwindigkeit und Bildqualität unterscheiden.
Welche Rolle spielt die Kalibrierung im DI-Prozess?
Die Kalibrierung der gesamten Produktionskette ist essenziell, um sicherzustellen, dass die Farben auf dem Monitor exakt so aussehen wie später bei der Ausbelichtung auf Film oder im Kino.
- Quote paper
- Mathias Knöfler (Author), 2005, Workflowoptimierung im Digital Intermediate auf dem Weg zum universellen digitalen Master, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46328