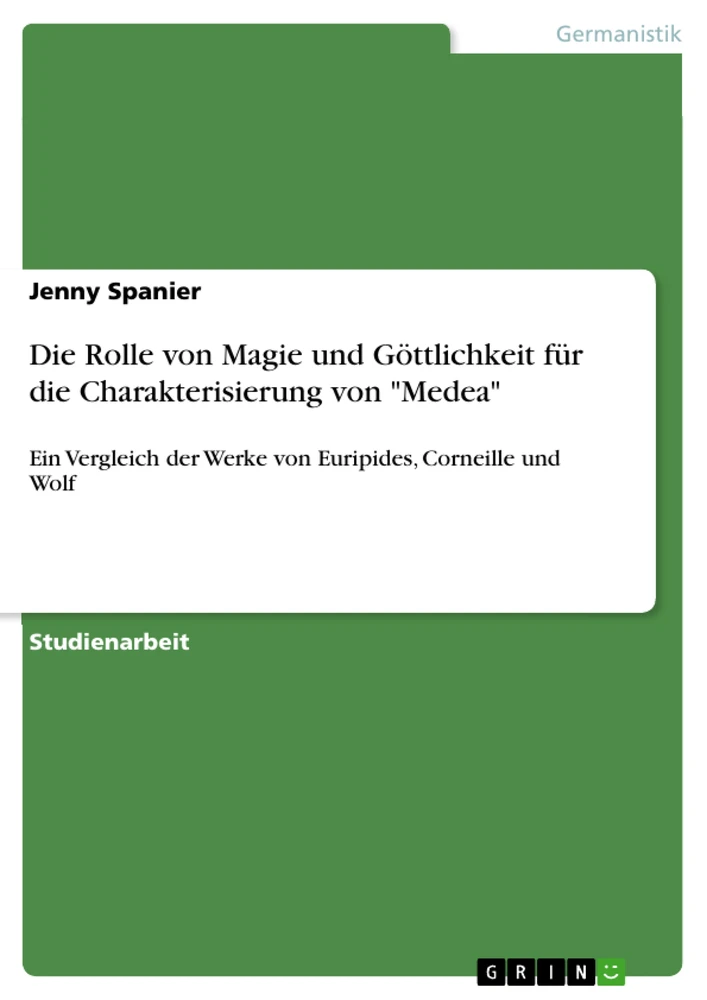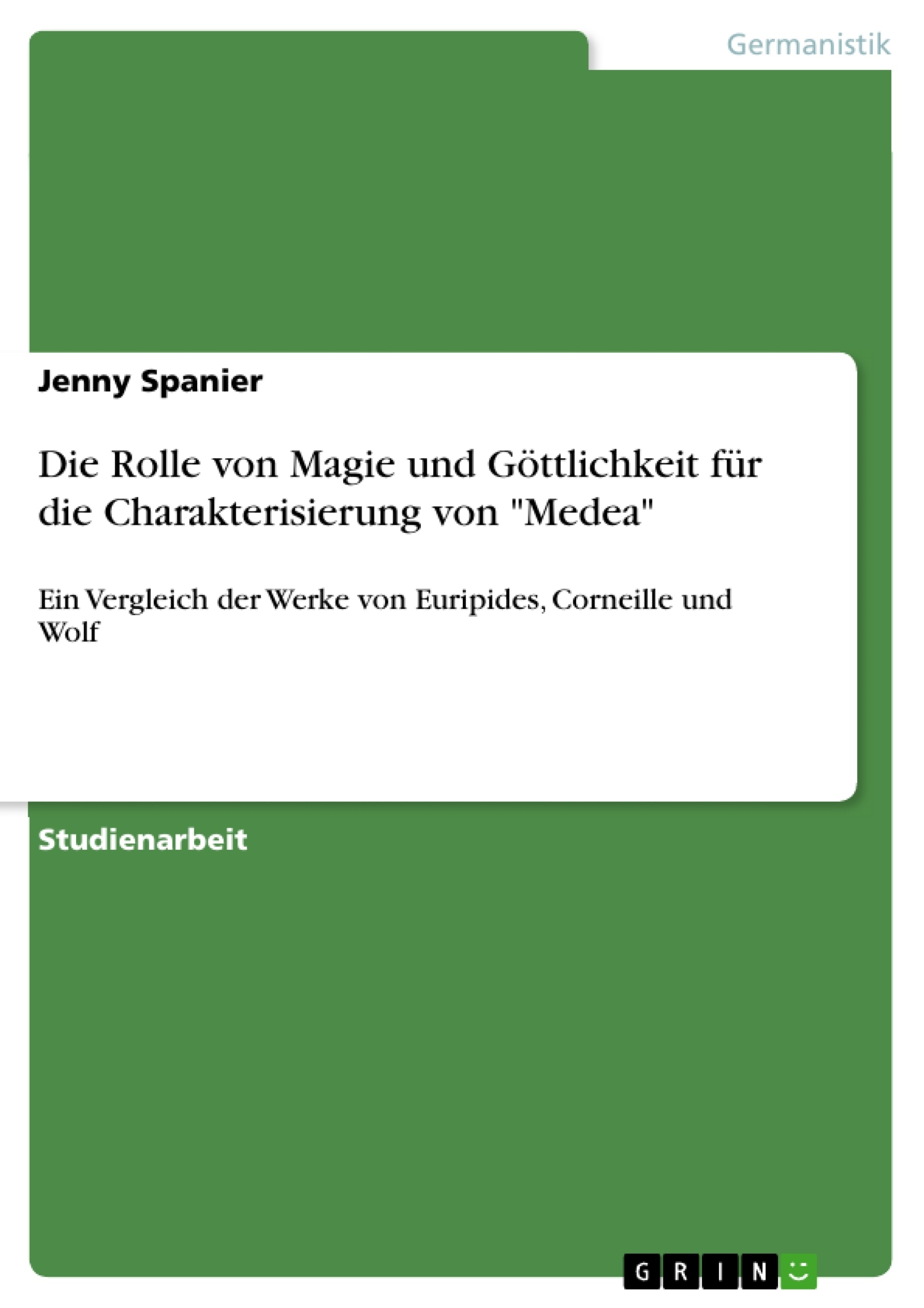Der Fokus der vorliegenden Untersuchung ist es, auf inhaltlicher Ebene zu ergründen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es bei dem Umgang mit Magie in den Vergleichswerken gibt. Dadurch soll eine Antwort auf die Frage gegeben werden, ob sich die Charakterisierung von Medea mit der differenzierten Rolle der Magie oder dem Götterglauben in ihrer Geschichte verändert.
Eine Figur, deren Geschichte seit der Antike in Literatur und nicht-literarischen Medien kontinuierlich wiedergegeben und neuinterpretiert wurde, ist Medea. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Charakterisierung der Figur Medea in verschiedenen Rezeptionswerken des Mythos. Als Vergleichsgrundlage wurden bewusst drei Werke ausgewählt, die sich in Gattung, Entstehungszeit und -ort deutlich voneinander unterscheiden und in ähnlicher Gestaltung einen differenzierten Umgang mit dem Mythosgeschehen üben: "Medea" (431 v. Chr.) von Euripides, "Médée" (1635, dt. Medea) von Pierre Corneille und "Medea. Stimmen." (1996) von Christa Wolf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Einführung
- 2.1 Definition von Mythos
- 2.2 Das Verhältnis von Mythos und Göttlichkeit
- 3. Analyse
- 3.1 Euripides
- 3.2 Pierre Corneille
- 3.3 Christa Wolf
- 4. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Charakterisierung der Medea-Figur in drei verschiedenen literarischen Werken: Euripides' "Medea", Corneilles "Médée" und Wolfs "Medea. Stimmen". Ziel ist der Vergleich des Umgangs mit Magie und Göttlichkeit in diesen Werken und die Klärung der Frage, ob sich Medeas Charakterisierung durch die unterschiedliche Darstellung dieser Elemente verändert. Die Arbeit analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit dem Mythos und erörtert mögliche Intentionen der Autoren in Bezug auf die gewählte Darstellung von Magie.
- Die Charakterisierung der Medea-Figur in verschiedenen literarischen Adaptionen.
- Der Einfluss von Magie und Göttlichkeit auf die Darstellung Medeas.
- Vergleich der Darstellung von Magie in den drei ausgewählten Werken.
- Unterschiede im Umgang mit dem Mythos in antiker, klassischer und moderner Literatur.
- Mögliche Intentionen der Autoren in Bezug auf die Darstellung von Magie und Göttlichkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die weitreichende Rezeptionsgeschichte der Medea-Figur in Literatur und anderen Medien. Sie hebt die Kontrastierung der Interpretationen hervor und benennt die drei ausgewählten Vergleichswerke: Euripides' "Medea", Corneilles "Médée" und Wolfs "Medea. Stimmen". Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Umgang mit Magie und Göttlichkeit in diesen Werken und deren Einfluss auf die Charakterisierung Medeas. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
2. Theoretische Einführung: Dieses Kapitel bietet eine Definition des Begriffs "Mythos" und beleuchtet dessen Ursprung und Rezeptionsgeschichte. Es wird erläutert, dass Mythen "vorwissenschaftliche Erklärungen und Beschreibungen der Lebenswelt" liefern und oft übernatürliche Elemente enthalten. Des Weiteren wird das Verhältnis von Mythos zu Magie, Göttern und Göttlichkeit im Kontext der gewählten Analyse betrachtet, um ein theoretisches Fundament für die anschließende Analyse der drei Werke zu schaffen. Die Kapitel 2.1 und 2.2 legen den theoretischen Rahmen für die Analyse fest.
3. Analyse: Kapitel 3 bildet den Kern der Arbeit und analysiert den Umgang mit Magie und Göttlichkeit in Euripides' "Medea", Corneilles "Médée" und Wolfs "Medea. Stimmen". Jedes Unterkapitel (3.1, 3.2, 3.3) widmet sich einem Werk, beleuchtet dessen Entstehungskontext und analysiert die Darstellung von Medea unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2. Der Fokus liegt dabei auf dem Vergleich der jeweiligen Interpretationen und der Rolle von Magie und Göttlichkeit in der Charakterisierung der Figur.
Schlüsselwörter
Medea, Mythos, Magie, Göttlichkeit, Euripides, Corneille, Wolf, Charakterisierung, Literaturvergleich, Rezeptionsgeschichte, Antike, Moderne, Tragödie, Roman.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Medea: Eine vergleichende Analyse von Euripides, Corneille und Wolf"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Medea-Figur in drei literarischen Werken: Euripides' "Medea", Corneilles "Médée" und Wolfs "Medea. Stimmen". Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Umgangs mit Magie und Göttlichkeit in diesen Werken und deren Einfluss auf die Charakterisierung Medeas.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit Magie und Göttlichkeit in den drei ausgewählten Werken und deren Einfluss auf die Charakterisierung der Medea-Figur. Es wird geprüft, ob und wie sich die Darstellung Medeas durch die unterschiedliche Darstellung dieser Elemente verändert.
Welche Werke werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Euripides' "Medea", Corneilles "Médée" und Christa Wolfs "Medea. Stimmen". Diese drei Werke repräsentieren unterschiedliche Epochen und literarische Stile, was einen vielschichtigen Vergleich ermöglicht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakterisierung der Medea-Figur, den Einfluss von Magie und Göttlichkeit auf ihre Darstellung, den Vergleich der Darstellung von Magie in den drei Werken, die Unterschiede im Umgang mit dem Mythos in antiker, klassischer und moderner Literatur sowie die möglichen Intentionen der Autoren in Bezug auf die Darstellung von Magie und Göttlichkeit.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine theoretische Einführung, eine Analyse der drei Werke und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Die theoretische Einführung definiert den Begriff "Mythos" und beleuchtet das Verhältnis von Mythos zu Magie und Göttlichkeit. Die Analyse untersucht die drei Werke im Detail. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist der Inhalt der theoretischen Einführung?
Die theoretische Einführung bietet eine Definition des Begriffs "Mythos" und untersucht dessen Ursprung und Rezeptionsgeschichte. Sie beleuchtet das Verhältnis von Mythos zu Magie, Göttern und Göttlichkeit, um ein theoretisches Fundament für die Analyse der drei Werke zu schaffen.
Wie wird die Analyse der drei Werke durchgeführt?
Die Analyse untersucht den Umgang mit Magie und Göttlichkeit in jedem der drei Werke separat. Sie beleuchtet den Entstehungskontext jedes Werkes und analysiert die Darstellung von Medea unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen aus der Einführung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Interpretationen und der Rolle von Magie und Göttlichkeit in der Charakterisierung der Figur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Medea, Mythos, Magie, Göttlichkeit, Euripides, Corneille, Wolf, Charakterisierung, Literaturvergleich, Rezeptionsgeschichte, Antike, Moderne, Tragödie, Roman.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die Rezeptionsgeschichte der Medea-Figur, den Umgang mit Mythen in der Literatur und den Vergleich literarischer Werke interessieren. Sie eignet sich besonders für Studierende der Literaturwissenschaft und vergleichender Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Jenny Spanier (Author), 2018, Die Rolle von Magie und Göttlichkeit für die Charakterisierung von "Medea", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463123