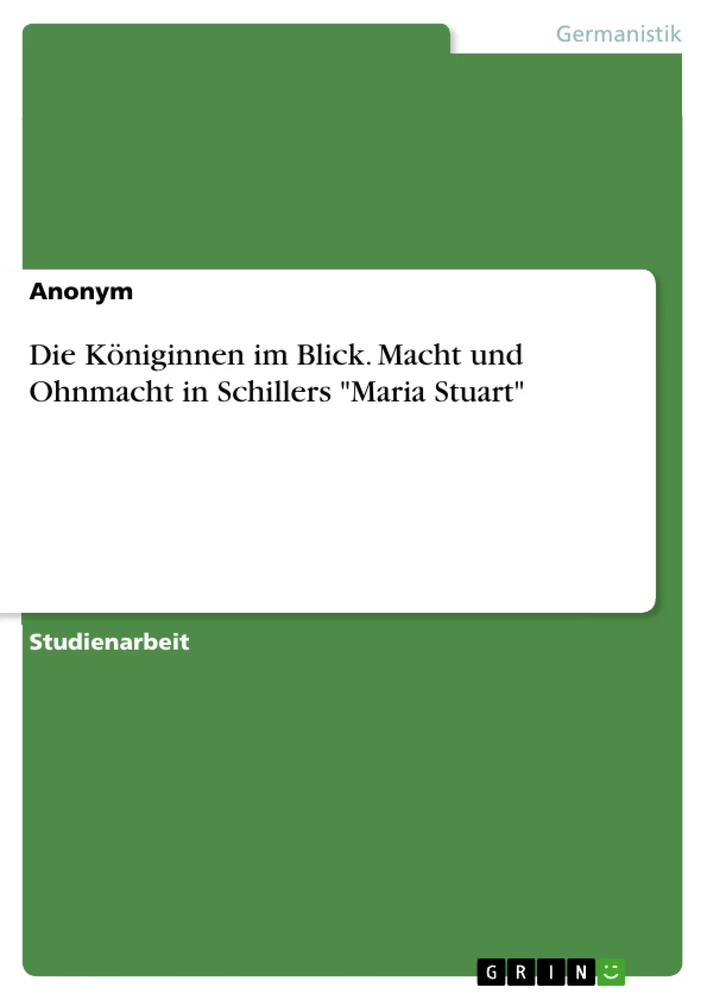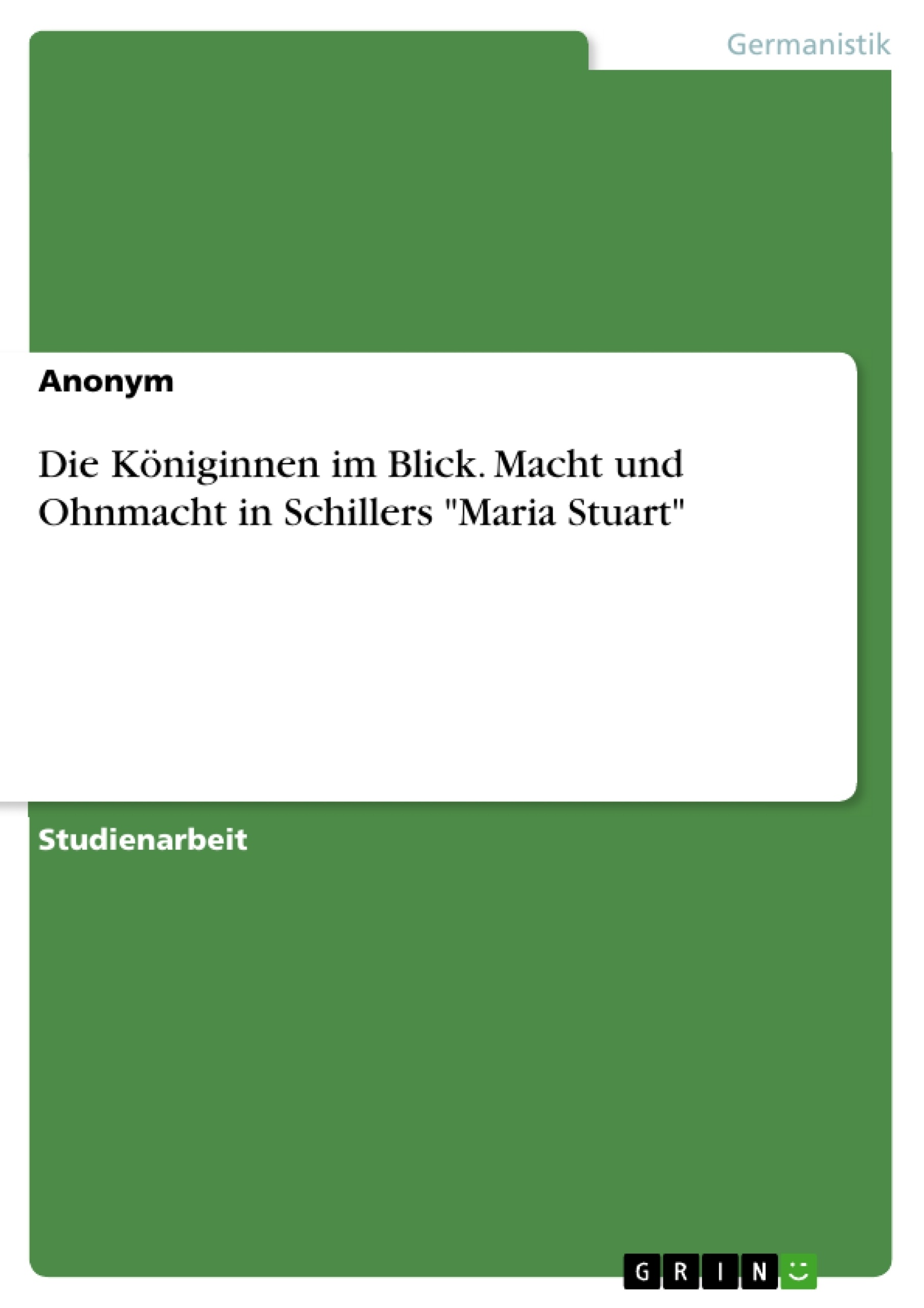Dem Ende des Werkes „Maria Stuart“ zufolge stirbt die schottische Königin Maria und die englische Königin Elisabeth erreicht ihr langersehntes Ziel der alleinigen Thronherrschaft. Doch bereits innerhalb der Handlung werden feste Machtstrukturen aufgehoben und verschiedene Arten der Macht herauskristallisiert. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, inwiefern eine Königin mächtiger als die andere war und welche externen Machteinflüsse das Geschehen anregen.
Zu diesem Zwecke wird zunächst Heinrich Popitz’ Machtdefinition erläutert. Darauf folgt der Höhe- und Wendepunkt des Dramas: Das Zusammentreffen der Rivalinnen Maria und Elisabeth. Dabei wird unter anderem der Dialog der Königinnen und seine Strukturen mit Hilfe der vorausgehenden theoretischen Grundlage vorgeführt, aber auch handlungsleitende Elemente wie die Regieanweisung analysiert. Den externen Rollen wird ein eigenes Kapitel gewidmet in dem nochmals fokussierter das Einflussvermögen der Männerwelt auf die Macht der Frauen thematisiert werden soll. Abschließend wird die Arbeit mit einem Fazit rekapituliert, worin auch die Aufarbeitung des Maria Stuart- Stoffes und die Veränderung seitens Friedrich Schillers aufgezeigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Macht nach Heinrich Popitz
- Grundformen der Macht
- Durchsetzungsformen der Macht
- Die Rivalität der Königinnen
- Die Rivalität und die Macht
- Der Dialog und ihre Struktur: Macht und Ohnmacht
- Die liebenden Männer zwischen der Rivalität der Königinnen
- Graf von Leicester
- Mortimer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse von Friedrich Schillers Drama „Maria Stuart“ und der Frage, wie Macht und Ohnmacht in der Rivalität der beiden Königinnen Maria Stuart und Elisabeth dargestellt werden. Dabei werden insbesondere die von Schiller erfundenen Dialoge und ihre Struktur untersucht, um die komplexen Machtverhältnisse zwischen den Protagonisten aufzuzeigen.
- Macht und Ohnmacht in Schillers „Maria Stuart“
- Die Rivalität der Königinnen und ihre Auswirkungen
- Die Rolle der Männer in der Rivalität der Königinnen
- Die Bedeutung von Dialogen und ihrer Struktur im Drama
- Die Veränderung des Maria Stuart-Stoffes durch Schiller
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die zentralen Fragen der Arbeit. Kapitel 2 erläutert den Begriff der Macht nach Heinrich Popitz, der als theoretische Grundlage für die Analyse des Dramas dient. Kapitel 3 analysiert die Rivalität der beiden Königinnen und untersucht ihre Machtverhältnisse, insbesondere im Kontext des Dialogs. Kapitel 4 widmet sich den männlichen Figuren und ihren Einfluss auf die Macht der Frauen. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die Bedeutung der Veränderung des Maria Stuart-Stoffes durch Schiller.
Schlüsselwörter
Schiller, Maria Stuart, Macht, Ohnmacht, Rivalität, Königinnen, Dialog, Struktur, Männer, Frauen, Einfluss, Veränderung, Drama, Tragödie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Die Königinnen im Blick. Macht und Ohnmacht in Schillers "Maria Stuart", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463114