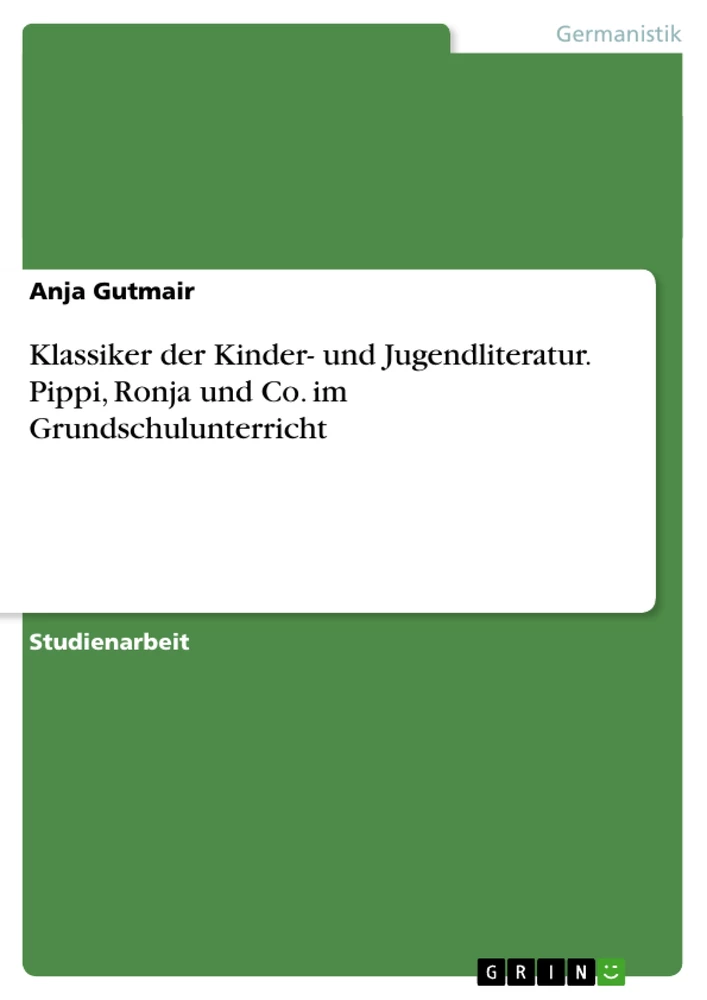Die folgende Arbeit widmet sich Fragen rund um Einstellungen und Bewertungskriterien gegenüber nicht- muttersprachlicher Sprachkompetenz. Dies kann die Bewertungsmaßstäbe bei der Benotung von fremdsprachlichen Arbeiten durch Sprachlehrer/innen im schulischen oder universitären Kontext ebenso umfassen, wie z.B. die Untersuchung der Reaktionen und Einstellungen von Muttersprachlern gegenüber Äußerungen in ihrer Sprache, die von nichtmuttersprachlichen Sprechern produziert werden.
Klarerweise handelt es sich bei 'Bewertungen und Einstellungen' um schwer messbare, teilweise subjektive Größen und es wird zu untersuchen sein, wie die gefundenen Ergebnisse in der Praxis des Sprachlernens umgesetzt werden können. Zwar soll es hier nicht in erster Linie um 'Fehlerlinguistik oder Sprachbewertung' als solches gehen, sondern vielmehr um die Einstellungen verschiedener (Sprach-)Gruppen wie Muttersprachlern, Nicht-Muttersprachlern, Lehrern und Laien etc. gegenüber mündlichen oder schriftlichen Äußerungen von nichtmuttersprachlichen Personen. Bei den Untersuchungen zu diesem Themenfeld, auf die ich mich im Folgenden stützen werde, spielt jedoch der 'Fehler' zumeist eine zentrale Rolle: Beinahe sämtliche Studien, die ab den späten Siebzigern und frühen Achtzigern zu Fragen der Sprachbewertung von fremdsprachlichen (L2-) (vom Englischen "second language", d.h. die erste Fremdsprache neben der Muttersprache) Äußerungen angestellt wurden, gingen vom Fehler des Fremdsprachensprechers als Gegenstand der Bewertung aus und untersuchten zumeist anhand von Bewertungsskalen dessen Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Kommunikation. Solche Aspekte können z.B. sein:
1) Inwieweit leidet die Verständlichkeit eines Satzes durch typische Fehler von Fremdsprachenlernenden?
2) Welche Arten von Fehlern gibt es und nach welchen Kriterien können sie typologisiert werden?
3) Ist ein Fehler wie jeder andere zu bewerten oder gibt es so etwas wie "schwere" und "leichte" Fehler? Daraus folgt weiters:
4) Welche Fehler sind im Sprachunterricht vernachlässigbar und auf welche muss besonders Acht gegeben werden?
5) Wie reagieren Lehrer auf Abweichungen von der Norm und wie reagieren Laien?
6) Gibt es Unterschiede in den Reaktionen von Muttersprachlern und jenen von Nicht-Muttersprachlern?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Kindheitserinnerungen
- Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur
- Was sind Kinderbuchklassiker?
- Kinderbuchklassiker – beliebte Kinderbücher?
- Popularität und Langlebigkeit als Kennzeichen eines Klassikers
- Ästhetische Qualität als Hauptkriterium und ihre Merkmale
- Innovativität
- Repräsentativität
- Ästhetische Gestaltung der Sprache
- Einfachheit
- Darstellung der kindlichen Erlebniswelt
- Phantasie
- Polyvalenz
- Vorstellung einiger Kinderbuchklassiker
- Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren)
- Ronja Räubertochter (Astrid Lindgren)
- Heidi (Johanna Spyri)
- Das doppelte Lottchen (Erich Kästner)
- Räuber Hotzenplotz (Otfried Preußler)
- Froschkönig oder der eiserne Heinrich (Gebrüder Grimm)
- Unterrichtsvorschläge für die Grundschule
- Froschkönig
- Pippi Langstrumpf
- Was sind Kinderbuchklassiker?
- Leseförderung in der Grundschule durch Kinderbuchklassiker
- Anlagen
- Kurzzusammenfassungen der Kinderbuchklassiker
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff „Kinderbuchklassiker“ und beleuchtet verschiedene Kriterien zur Definition dieser Kategorie. Ziel ist es, die Merkmale von Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur zu erörtern und anhand ausgewählter Beispiele zu veranschaulichen. Des Weiteren werden didaktische Überlegungen für den Einsatz im Grundschulunterricht präsentiert.
- Definition und Kriterien von Kinderbuchklassikern
- Analyse ausgewählter Kinderbuchklassiker
- Didaktische Ansätze für den Einsatz im Unterricht
- Bedeutung der Leseförderung durch Klassiker
- Popularität und Langlebigkeit von Kinderbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
Kindheitserinnerungen: Die Einleitung beschreibt die persönlichen Kindheitserinnerungen der Autorin an das Lesen von Kinderbüchern, die heute als Klassiker gelten. Diese persönliche Erfahrung dient als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Definition und den Kriterien von Kinderbuchklassikern. Die Autorin beschreibt ihre Vorliebe für das Lesen und nennt einige Titel, die später im Text näher beleuchtet werden. Der Bezug zur eigenen Leseerfahrung verdeutlicht die emotionale Bedeutung und die Langlebigkeit von Klassikern.
Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition von Kinderbuchklassikern. Es werden zwei gegensätzliche Ansätze vorgestellt: einer, der Popularität und Langlebigkeit betont, und ein zweiter, der die ästhetische Qualität und literarische Innovation in den Vordergrund stellt. Die Diskussion dieser verschiedenen Perspektiven verdeutlicht die Komplexität der Thematik und die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition zu finden. Es werden verschiedene Kriterien, wie Innovativität, Repräsentativität, ästhetische Gestaltung der Sprache, Einfachheit, Darstellung der kindlichen Erlebniswelt, Phantasie und Polyvalenz, detailliert erläutert und mit Beispielen illustriert. Die Kapitelstruktur dient der systematischen Auseinandersetzung mit den komplexen Aspekten, die die Einordnung eines Buches als Klassiker bestimmen.
Schlüsselwörter
Kinderbuchklassiker, Jugendliteratur, ästhetische Qualität, Popularität, Langlebigkeit, Innovativität, Repräsentativität, kindliche Erlebniswelt, Phantasie, Didaktik, Grundschulunterricht, Leseförderung, Astrid Lindgren, Erich Kästner, Gebrüder Grimm, Johanna Spyri, Otfried Preußler.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur"
Was ist der Inhalt des Textes "Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur"?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Er beinhaltet eine Einleitung mit Kindheitserinnerungen der Autorin, eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Definition von Kinderbuchklassikern, eine Vorstellung verschiedener Klassiker mit Unterrichtsvorschlägen für die Grundschule, sowie Abschnitte zur Leseförderung und ein Quellenverzeichnis. Der Text analysiert Kriterien wie Popularität, Langlebigkeit und ästhetische Qualität, um den Begriff "Klassiker" zu definieren.
Welche Kinderbuchklassiker werden im Text vorgestellt?
Der Text stellt mehrere Kinderbuchklassiker vor, darunter Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren, Heidi von Johanna Spyri, Das doppelte Lottchen von Erich Kästner, Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler und den Froschkönig der Gebrüder Grimm. Diese Bücher dienen als Beispiele zur Veranschaulichung der im Text diskutierten Kriterien für Kinderbuchklassiker.
Welche Kriterien werden zur Definition eines Kinderbuchklassikers verwendet?
Der Text diskutiert verschiedene Kriterien zur Definition eines Kinderbuchklassikers. Neben Popularität und Langlebigkeit werden vor allem ästhetische Kriterien wie Innovativität, Repräsentativität, ästhetische Gestaltung der Sprache, Einfachheit, die Darstellung der kindlichen Erlebniswelt, Phantasie und Polyvalenz betrachtet. Es wird deutlich, dass keine einheitliche Definition existiert und die Kriterien oft im Kontext zueinander betrachtet werden müssen.
Welche didaktischen Ansätze für den Einsatz im Unterricht werden vorgestellt?
Der Text enthält didaktische Überlegungen zum Einsatz von Kinderbuchklassikern im Grundschulunterricht. Es werden konkrete Unterrichtsvorschläge für den Froschkönig und Pippi Langstrumpf gegeben, wobei implizit auch die didaktische Verwendung anderer vorgestellter Klassiker angeregt wird. Die Leseförderung durch den Einsatz von Klassikern im Unterricht wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in verschiedene Kapitel gegliedert: Eine Einleitung mit Kindheitserinnerungen, ein Kapitel zur Definition und Analyse von Kinderbuchklassikern mit Beispielen, ein Kapitel mit Unterrichtsvorschlägen, sowie ein Kapitel mit Kurzzusammenfassungen der behandelten Klassiker. Zusätzlich enthält der Text ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Die Zielsetzung des Textes ist die Untersuchung des Begriffs "Kinderbuchklassiker" und die Erörterung verschiedener Kriterien zur Definition dieser Kategorie. Es soll gezeigt werden, welche Merkmale Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur auszeichnen, und dies anhand ausgewählter Beispiele veranschaulicht werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf didaktischen Überlegungen für den Einsatz im Grundschulunterricht.
Welche Schlüsselwörter sind für den Text relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Kinderbuchklassiker, Jugendliteratur, ästhetische Qualität, Popularität, Langlebigkeit, Innovativität, Repräsentativität, kindliche Erlebniswelt, Phantasie, Didaktik, Grundschulunterricht, Leseförderung, Astrid Lindgren, Erich Kästner, Gebrüder Grimm, Johanna Spyri, Otfried Preußler.
- Citar trabajo
- Anja Gutmair (Autor), 2005, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Pippi, Ronja und Co. im Grundschulunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46259